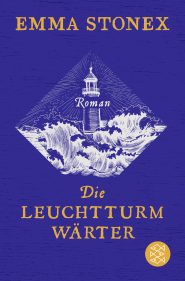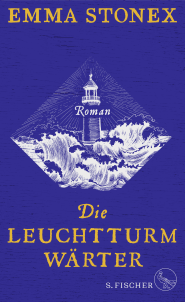Die Leuchtturmwärter
Drei Männer, die spurlos von einem Leuchtturm verschwinden. Drei Frauen, die ihr Leben lang mit diesem Rätsel kämpfen.
In der Silvesternacht verschwinden vor der Küste Cornwalls drei Männer spurlos von einem Leuchtturm. Die Tür ist von innen verschlossen. Der zum Abendessen gedeckte Tisch unberührt. Die Uhren sind stehen geblieben. Zurück bleiben drei Frauen, die auch zwei Jahrzehnte später von dem rätselhaften Geschehen verfolgt werden. Die Tragödie hätte Helen, Jenny und Michelle zusammenbringen sollen, hat sie aber auseinandergerissen. Als sie zum ersten Mal ihre Seite der Geschichte erzählen, kommt ein Leben voller Entbehrungen zutage – des monatelangen Getrenntseins, des Sehnens und Hoffens. Und je tiefer sie hinabtauchen, desto dichter wird das Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, Realität und Einbildung.
Emma Stonex hat in ihrem Roman »Die Leuchtturmwärter« ein fesselndes Drama über Verlust und Trauer geschaffen – und über die Liebe, die es braucht, um das Licht am Brennen zu halten, wenn alles andere von Dunkelheit verschlungen wird.
Die Leuchtturmwärter
Drei Männer, die spurlos von einem Leuchtturm verschwinden. Drei Frauen, die ihr Leben lang mit diesem Rätsel kämpfen.
In der Silvesternacht verschwinden vor der Küste Cornwalls drei Männer spurlos von einem Leuchtturm. Die Tür ist von innen verschlossen. Der zum Abendessen gedeckte Tisch unberührt. Die Uhren sind stehen geblieben. Zurück bleiben drei Frauen, die auch zwei Jahrzehnte später von dem rätselhaften Geschehen verfolgt werden. Die Tragödie hätte Helen, Jenny und Michelle zusammenbringen sollen, hat sie aber auseinandergerissen. Als sie zum ersten Mal ihre Seite der Geschichte erzählen, kommt ein Leben voller Entbehrungen zutage – des monatelangen Getrenntseins, des Sehnens und Hoffens. Und je tiefer sie hinabtauchen, desto dichter wird das Geflecht aus Geheimnissen und Lügen, Realität und Einbildung.
Emma Stonex hat in ihrem Roman »Die Leuchtturmwärter« ein fesselndes Drama über Verlust und Trauer geschaffen – und über die Liebe, die es braucht, um das Licht am Brennen zu halten, wenn alles andere von Dunkelheit verschlungen wird.
Die Leuchtturmwärter
Der Tag ist hell und grau, als Jory die Vorhänge aufzieht, im Radio läuft ein vage bekanntes Lied. Er hört die Nachrichten, es geht um ein Mädchen, das oben im Norden an einer Bushaltestelle verschwunden ist, und trinkt aus einer Tasse braunen Tee. Die arme Mutter ist außer sich – na ja, natürlich. Kurze Haare, kurzer Rock, große Augen, so stellt er sich das Mädchen vor, zitternd in der Kälte, und eine verlassene Haltestelle, an der jemand hätte stehen sollen, winkend oder klatschnass, und der Bus hält an und fährt wieder ab, niemand ahnt etwas, und der Gehweg schimmert im schwarzen Regen. Das Meer ist ruhig und so spiegelglatt wie oft nach schlechtem Wetter. Er öffnet das Fenster, und die frische Luft wirkt beinahe fest, wie etwas Greifbares, Essbares, das zwischen den Fischercottages knackt wie ein Eiswürfel in einem warmen Getränk. An den Geruch des Meeres kommt nichts heran, nicht annähernd: salzig, sauber, wie Essig aus dem Kühlschrank. Heute ist es geräuschlos. Jory kennt das Meer laut und auch still, wogend und spiegelglatt, er kennt das Meer, in dem das eigene Boot wie der letzte Wimpernschlag der Menschheit wirkt, mit so entschlossenen, grimmigen Wellen, dass man glaubt, woran man nicht glaubt, etwa dass das Meer dieser Ort auf halbem Weg zwischen Himmel und Hölle ist oder zwischen dem, was auch immer dort oben liegt, und dem, was in der Tiefe lauert. Ein Fischer hat ihm einmal gesagt, das Meer habe zwei Gesichter. Man müsse sie annehmen, sagte er zu ihm, das gute wie das böse, und darf keinem von beiden je den Rücken zuwenden. Heute ist das Meer nach langer Zeit endlich auf ihrer Seite. Heute werden sie es tun.