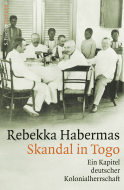
Fünf Fragen an Rebekka Habermas
Zum diesjährigen Historikertag stellen wir fünf renommierten HistorikerInnen Fragen zur Geschichte und ihrer Wirkung. Rebekka Habermas erzählt uns, wie sie zur Geschichtswissenschaft gefunden hat und welche drei Genres das ideale historische Sachbuch vereint.
1. Was kann Geschichte als Wissenschaft leisten, welche Funktionen hat die Geschichte (einerseits als Wissenschaft, andererseits als Bezug auf das Vergangene) heute?
Geschichte hat unendlich viele Funktionen: Sie ist Teil von – eventuell sogar regelrecht gelenkter – Erinnerungspolitik, kann der Selbstvergewisserung dienen oder auch neue Fragen aufwerfen. In der bundesrepublikanischen Öffentlichkeit wurde spätestens seit den 1960er Jahren vor allem die Geschichte des Nationalsozialismus immer wieder neu diskutiert und dadurch auch immer wieder neu aufgearbeitet. Diese Geschichtsaufarbeitung diente der Selbstvergewisserung, hat mit dazu beigetragen, ein neues Bild von Deutschland zu entwerfen, hatte teilweise juristische Folgen und hat zu einer wahren Bücherflut zum Thema Erinnerungskultur geführt.
Andere Kapitel der Geschichte, wie etwa die Kolonialgeschichte, werden kaum öffentlich verhandelt. Gewiss hatte Deutschland eine, verglichen mit England und Frankreich, vergleichsweise kurze Kolonialzeit, und die Spuren derselben sind weit weniger deutlich zu erkennen. Und doch könnte eine Auseinandersetzung mit diesem Kapitel europäischer Geschichte gerade angesichts neuer globaler Herausforderungen eine wichtige Funktion haben. Eine intensivere Beschäftigung mit den Spuren, die Kolonialgeschichte etwa in deutschen Museen hinterlassen hat, fördert nicht nur wunderschöne Artefakte zutage. In fast allen ethnologischen Sammlungen, sei es in großen Städten wie Frankfurt, Hamburg und Berlin, sei es in den kleineren Sammlungen wie Göttingen oder Braunschweig, findet man ebenso zahlreiche schriftliche Quellen, die Auskunft darüber geben, wie wer unter welchen Umständen diese Objekte erworben, getauscht, geraubt oder gestohlen hat. Das wiederum wirft Fragen auf, die das neue Selbstverständnis der Bundesrepublik als global player im Weltkulturbetrieb in verschiedener Hinsicht problematisieren.
2. Was fasziniert Sie an der Arbeit des Historikers, warum sind Sie Historiker geworden? Was wollen Sie als Historiker mit der Geschichte erreichen oder beitragen?
Ich fand Geschichte im Unterschied etwa zur Ethnologie lange vor allem unendlich langweilig. Erst als der wahrscheinlich beste Geschichtslehrer, den es in ganz München gab, eine Miniaturdampfmaschine in den Unterricht mitbrachte und ich das erste Mal verstand, was genau an der industriellen Revolution so revolutionär war, begann ich, mich für Geschichte zu interessieren. Heute ist mir klar, dass sich Geschichte und Ethnologie eigentlich nur unwesentlich unterscheiden: Will man in der Ethnologie geographisch entfernte Räume verstehen, so geht es in der Geschichte um zeitlich entfernte Zusammenhänge.
In der Kolonialgeschichte genauso wie in der Kriminalitätsgeschichte und selbst in der Geschichte des Bürgertums – um nur die wichtigsten Themen zu nennen, die mich in den letzten Jahren beschäftigt haben – kommen noch viele andere Fremdheitsmomente dazu, was zweifellos einen Teil meiner Faszination erklärt. Geschichte ist aber nicht nur deshalb faszinierend, weil sie kleine Fluchten aus dem Hier und Jetzt erlaubt, sondern auch, weil dadurch das Hier und Jetzt in einem anderen Licht erscheint.
Wenn ich mich frage, was ich als Historikerin erreichen will, so ist es wahrscheinlich erst einmal kaum mehr als die schändlich vortheoretische, ja geradezu kindliche Neugier, herauszufinden, wie es eigentlich gewesen ist. Im Laufe der Beschäftigung mit einem Thema entwickelt diese Neugier dann einen ganz eigenen Sog: Trotz der in der Regel langjährigen und zuweilen auch langatmigen Suche, in deren Verlauf man viele Quellen findet, die entweder von etwas ganz anderem handeln, oder schlicht belanglos oder – noch schlimmer – trotz unendlicher Anstrengungen nicht zu entziffern sind, bleibt die Spannung so hoch wie sonst wahrscheinlich nur noch beim sonntäglichen Tatort. Trotz kritischer Methodenreflexion und obschon wir alle wissen, wie schwer das Verhältnis zwischen res factae und res fictae zu bestimmen und wie trügerisch die Vorstellung ist, man würde etwas Neues entdecken – am Ende ist es genau das, was mich antreibt. Carlo Ginzburg hat die Historiker und Historikerinnen mit Detektiven verglichen – durchaus treffend, aber auch mit einem gewissen Maß an Selbstmythologisierung.
3. Wieso mischen sich so wenige HistorikerInnen in das Zeitgeschehen und in aktuelle Debatten ein? Kann die Vergangenheit uns überhaupt etwas über die Gegenwart lehren oder zur Analyse aktueller Probleme beitragen?
Salopp formuliert würde ich zweierlei sagen: Gute Geschichtswissenschaft liefert nicht die Antworten, die weite Teile der Öffentlichkeit hören wollen. Und: Weite Teile der Geschichtswissenschaft interessieren sich nur wenig für die aktuellen Fragen, die im Feuilleton verhandelt werden.
Beides ist schade, da die aktuellen Probleme ohne historische Kenntnisse nicht verstanden werden können. Die Frage etwa, wie sich europäische Gesellschaften verändern in einer Situation, in der Grenzen sich verschieben, und die daraus resultierende Frage, welche Maßnahmen die Politik ergreifen sollte, können ohne einen Blick in die Geschichte nicht beantwortet werden. Hier spielt für Deutschland die koloniale Vergangenheit durchaus eine Rolle, wenn auch in geringerem Umfang als für Frankreich und England. Zentral sind natürlich auch die Erfahrungen mit Vertriebenen nach dem Zweiten Weltkrieg, ebenso wie die Ängste und Hoffnungen, die Veränderungen und Erfahrungen, die mit dem Zuzug der sogenannten Gastarbeiter, in Deutschland, England oder Frankreich verbunden waren . All das ist aufschlussreich, wenn man verstehen will, wie Islamophobie entsteht, warum der Front National so erfolgreich ist und welche Maßnahmen zur sogenannten Integration sinnvoll sind. Überhaupt fragt sich, ob ein Begriff wie Integration benutzt werden sollte, denn Menschen integrieren sich nicht, sondern sie verändern sich selbst und die Gesellschaft, in der sie leben.
4. Welche Rolle spielt für Sie Narrativität in der Geschichtswissenschaft?
Narrativität ist das, was die Geschichtswissenschaft mit ganz wenigen anderen Kulturwissenschaften teilt. Geschichtswissenschaft analysiert Geschichte und schreibt auch Geschichten. Dabei ist es unermesslich schwer, gute Geschichten zu schreiben: Zum einen weil möglichst viele Stimmen Gehör finden sollten. Dann müssen diese so miteinander in Beziehung gesetzt werden, dass auch Dissonanzen sichtbar werden. Und – noch schwieriger – es sollte auch das erzählt werden, was zu der Zeit, die untersucht wird, nicht thematisiert wurde, weil es verschwiegen, tabuisiert oder auch einfach schnell vergessen wurde. Das ist etwa bei dem Skandal der Fall gewesen, den ich untersuche: ein Skandal, in dem prügelnde und sexbesessene Kolonialbeamte zwar lautstark angeklagt werden, der am Ende aber die Brutalitäten von Kolonialpolitik eher verschweigt als sie zutage zu fördern.
Überdies verheimlicht gute geschichtswissenschaftliche Erzählung nicht, dass die Geschichte auch ganz anders erzählt werden kann und dass wir vieles einfach nicht wissen. Das alles dann noch in gutem Deutsch und spannend zusammengefügt – kaum je erreicht – ist eine hohe Kunst.
5. Was wünschen Sie sich von einem historischen Sachbuch? Welches historische Sachbuch hat Sie zuletzt besonders beeindruckt und warum?
Das letzte historische Sachbuch, das alle meine Erwartungen erfüllt hat, war Bernhard Schärs Studie über zwei Schweizer, die im ausgehenden 19. Jahrhundert Forschungsreisen ins Außereuropäische unternommen haben. Die beiden kamen aus dem besten Baseler Patriziat – eine Stadt, die sich in Schärs Darstellung plötzlich als unendlich viel kosmopolitischer entpuppt als man bisher erahnen konnte. Die Reisen dieser beiden, die überdies auch noch ein Paar waren (was nicht minder überraschend ist), werden so dargestellt, dass man zum einen unbedingt wissen, will, ob sie es schafften, lebend wieder nach Hause zu kommen. Gleichzeitig wird aber genau analysiert, welch eigentümlichen Rassetheorien sie auf diesen Reisen zu erklären versuchten, wie genau der Alltag auf solchen Reisen aussah und warum sie ohne die Unterstützung der Einheimischen wahrscheinlich schon nach wenigen Wochen gestorben wären. Das vielleicht überraschendste ist aber, dass deutlich wird, wie kräftig die Schweizer in der europäischen Kolonialpolitik mitmischten, ohne je Kolonien gehabt zu haben. Kurzum, es ist eine gekonnte Mischung aus klugen Beobachtungen und klarer Analyse, zudem voller Überraschungen, die neue Fragen zutage fördern: etwa die, was es bedeutet, dass auch Länder, die gar keine Kolonien hatten, wichtige Aufgaben als koloniale player übernehmen konnten.
Aber auch das beste historische Sachbuch hat Schwierigkeiten, seine beiden stärksten Konkurrenten zu schlagen: Literatur und Film. Beiden gelingt zuweilen eine Mischung von Dokumentarischem und Fiktionalem, die selbst leicht zu Besserwisserei neigende Historiker und Historikerinnen in die Knie gehen lässt. Margarets Atwoods Roman ›Alias Grace‹ ist so ein Beispiel. Hier geht es um einen Kriminalfall im Kanada des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Im Mittelpunkt stehen sowohl eine junge Magd als auch die noch junge Wissenschaft der Kriminologie. Atwood gelingt es mit den Mitteln der Fiktion, Einblicke in die Entstehung einer Siedlerkolonie zu geben und gleichzeitig eine Sprache für die inneren Konflikte derjenigen zu finden, die hier nicht nur sozial am Rande standen. Ein anderes Beispiel ist die AMC-Serie Mad Men, die für alle, die nach zeitgeschichtlichen Dokumenten zum New York der 1960er und 1970er Jahre suchen, alles Wichtige liefert, und das anschaulicher als jedes historische Sachbuch. Das ideale historische Sachbuch vereint diese drei Genres und deckt bildreich und scharfsinnig historische Zusammenhänge auf, die so noch nicht gesehen wurden, ohne die Erfahrungen und Gefühle der Hauptakteure und -akteurinnen außen vor zu lassen.
