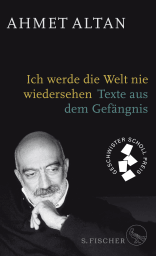
»Wir werden niemals begnadigt werden, wir werden in einer Gefängniszelle sterben.«
Seit beinahe zwei Jahren ist unser Autor Ahmet Altan in der Türkei inhaftiert, verurteilt zu lebenslanger Haft. Der Autor und Anwalt Philippe Sands richtet sich in einem berührenden und aufrüttelnden Brief an seinen abwesenden Freund.
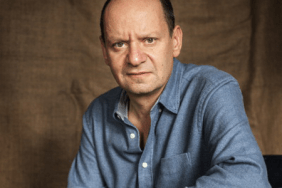
Mein lieber Freund, gestatte mir, in Deiner Abwesenheit einige Worte an Dich zu richten. Als Erstes will ich Dir von dem Vergnügen erzählen, das ich bei der Rückkehr in »Deine« Stadt empfinde. Istanbul ist ein Ort, der mir nur gute Erinnerungen ins Gedächtnis ruft; wir haben darüber gesprochen.
Ich weiß, dass Deine derzeitige persönliche Situation es Dir nicht erlaubt, mich hier zu empfangen. Ich verzeihe Dir, auch wenn wir uns schon eine Weile nicht gesehen haben. Erinnerst Du Dich an Deinen Besuch in London im August 2015? Wir saßen zusammen in einem sonnenbeschienenen Garten, Du hast den Rasen bewundert, meinen Rasen, und ich habe mich darüber gefreut. Ich habe von meinem Nachbarn gesprochen, dem Richter, der 1998 den Haftbefehl gegen Senator Augusto Pinochet unterzeichnet hat. Du hast gelächelt, als ich bemerkte, er habe nicht einmal genau gewusst, wer Pinochet war – »die Justiz ist blind«, hatte mir der Richter gesagt. Du sogst begierig die Details auf und auch den Gedanken an sich, dass es eine unabhängige Rechtsprechung gibt oder zumindest, dass man einen ehemals Mächtigen zur Rechenschaft ziehen konnte. Wir sprachen über die Welt, Dein neues Buch, meines. Wir lachten, aßen und wir beunruhigten uns. All diese Dinge teilten wir. Einige Monate später kehrte ich in Deine wunderbare Stadt zurück.
Da warst Du mitgenommen worden. Man sagte mir, es sei aufgrund der Worte geschehen, die Du öffentlich geäußert hattest, was sie noch schlimmer machte. Man sagte mir, dass diese Worte von Händen handelten, die in eine Tasche gleiten und sie dann verlassen. Diese Worte seien schädlich, hat man Dir gesagt. Wir wussten, Du und ich jeder auf seine Weise, in welchem Maße Worte verdreht werden können. Wir wissen, dass darin ihre Schönheit besteht, aber auch ihre Gefahr. Die Worte, die Dir unterstellt wurden, waren so schädlich, dass ein Richter entschied, Dich Deiner Freiheit zu berauben – nicht für einen Tag, eine Woche oder einen Monat, auch nicht für ein Jahr… sondern für immer. »Lebenslänglich ohne vorzeitige Entlassung«, sagte der Richter. »Wir werden niemals begnadigt werden, wir werden in einer Gefängniszelle sterben«, schriebst Du kürzlich.
Dann warst Du also weg. Zugegebenermaßen war das Timing vorbildlich. Es war ein Trick, eine List, um nichts zu meinem Buch sagen zu müssen, an dem ich sechs Jahre lang geschrieben und das ich auf Englisch veröffentlicht hatte, während Du Deine unglückseligen Worte sprachst. Das Buch nimmt den Leser mit in eine Zeit vor 1945, als die persönliche Freiheit nicht durch das Internationale Recht geschützt war, als der König, die Königin, der Kaiser oder der Präsident ein oder mehrere Individuen ihrer Meinungs- oder Versammlungsfreiheit und sogar ihrer Existenz berauben konnten. Aber vielleicht erzählt mein Buch von unserer Zeit.
Einmal mehr fließt das Gift der Fremdenfeindlichkeit und des Nationalismus durch die Adern der Welt. Der »starke Mann« ist zurück, aber das muss ich Dir nicht erklären, mein lieber abwesender Freund. Ich sehe es auf meinen Reisen durch Mittel- und Osteuropa, Ungarn, Polen, die Ukraine.
Ich bin auch Zeuge des Gifts der Fremdenfeindlichkeit und des Nationalismus in England, im Votum für den Brexit, im politischen Geschehen, das daraus resultiert. Ich bin Zeuge der Stellungnahmen der Premierministerin, die kürzlich den Wunsch zum Ausdruck brachte, das Vereinigte Königreich solle aus der Europäischen Menschenrechtskonvention austreten. Kannst Du Dir vorstellen, dass sie auf dem Parteitag ihrer Partei im Oktober 2016 gesagt hat, »wenn Sie glauben, ein Weltbürger zu sein, dann sind Sie Bürger keines Landes«?
Ihre Worte ‒ ob ihr bewusst war, was sie da sagte? ‒ erinnern mich an eine Passage aus dem wunderbaren Buch von Stefan Zweig, »Die Welt von gestern« ‒ zu dessen Lektüre unsere Zeit beharrlich aufruft ‒, posthum veröffentlicht 1942 nach dem Doppelselbstmord Zweigs und seiner Frau: »Es hat mir nicht geholfen, daß ich fast durch ein halbes Jahrhundert mein Herz erzogen, weltbürgerlich als das eines ›citoyen du monde‹ zu schlagen. Nein, am Tage, da ich meinen Paß verlor, entdeckte ich mit achtundfünfzig Jahren, daß man mit seiner Heimat mehr verliert als einen Fleck umgrenzter Erde.«
Wohin gehen wir?
Die USA haben Donald Trump zum Präsidenten gewählt. Vor zwei Jahren forderte er »eine totale und vollständige Schließung der US-amerikanischen Grenzen für Muslime«. Was für eine originelle Idee! Menschen auf ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe festzulegen.
In Wirklichkeit hat diese Idee eine verschlungene und dunkle Geschichte, wie der italienische Schriftsteller Primo Levi uns in Erinnerung rief, nachdem es ihm gelungen war, einem Ort namens Auschwitz zu entkommen, an dem er über ein Jahr zugebracht hatte. Er erklärt es deutlich im Vorwort seines 1947 veröffentlichten Buchs »Ist das ein Mensch?«.
Er schreibt: »Viele, ob Individuen oder Völker, können mehr oder minder bewußt dem Glauben anheimfallen, daß ›jeder Fremde ein Feind ist‹.« Und er fährt fort: »Wenn das unausgesprochene Dogma zur oberen Prämisse eines Syllogismus wird, dann steht am Ende der Gedankenkette das Lager.«
Eine Sache führt zur nächsten. Im Spiegel dieser Vergangenheit ist die Idee besorgniserregend, Individuen aufgrund ihrer Nationalität oder Religion den Eintritt in ein bestimmtes Territorium zu verweigern. So besorgniserregend wie die, einen Schriftsteller aufgrund einiger Worte einzusperren. Die jüngste Erfahrung lehrt uns, wohin es führen kann, wenn man mit dem Finger auf Personen zeigt nicht aufgrund dessen, was sie getan haben, sondern weil sie einer bestimmten Gruppe zugehören oder weil sie etwas gesagt haben, was uns missfallen hat.
Wohin gehen wir?
Du verfügst über einen privilegierten Standpunkt, mein lieber abwesender Freund, Du erlebst das, was Du in Deinem Roman geschrieben hast. Die Schönheit ist abwesend in der Landschaft, die Dir dargeboten wird. Und trotzdem bist Du immer in der Lage zu träumen, Du kannst ihn noch sehen, »den weiten Himmel, der dich überragt«. Auf eine oder andere Weise gelingt es Dir auf Deinen Reisen, Hoffnungsschimmer wahrzunehmen.
Da der Aufstieg rassistischer und identitärer Politik auf die Bühne zurückkehrt, jener Erfahrung, die das Schreiben von »Rückkehr nach Lemberg« (East West Street) bedeutet hat, das Eintauchen in die Welt zwischen zwei Kriegen, ist es schwer, angesichts dessen, was sich anbahnt, in uns das starke Gefühl der Angst auszurotten. Deine Situation, mein lieber abwesender Freund, schwächt dieses Gefühl nicht ab.
Dennoch lehrt uns die Erfahrung auch, dass es, in den Worten des Dichters, »einen Riss in allen Dingen gibt, durch den das Licht einfällt«. Bewundern wir beide nicht den, der das geschrieben und für uns gesungen hat? »Ich kann nicht mehr mit der außer Kontrolle geratenen Menge laufen, während die Mörder an der Macht mit lauter Stimme beten«, hat er uns gesagt.
Zwei Schritte vor. Ein Schritt zur Seite. Ein weiterer zurück. Und so geht es, durch Zeit und Raum.
Er wird lang sein, der Kampf um Gerechtigkeit, um Rechte und Meinungsfreiheit. Es ist nicht leicht, sich den Moment vorzustellen, in dem diese Werte den Sieg davontragen. Und dennoch.
Auf lokaler Ebene kann es dabei Fortschritte geben. Ich bin selbst Zeuge gewesen im vergangenen November, als ich nach Lwiw gereist bin, um die Denkmäler der Gebäude zu sehen, die einmal die geplünderten Häuser von Lauterpacht und Lemkin waren.
Auf nationaler Ebene kann es Fortschritte geben. Ich war selbst Zeuge, 1998, 25 Jahre nach dem Beginn der Verbrechen des Senators Pinochet, zehn Jahre nachdem er die Macht verloren hatte. Auf plötzliche, unerwartete Weise entschied ein englisches Gericht, dass er sich nicht auf Immunität berufen konnte für seine massiven Menschenrechtsverletzungen.
Auf regionaler Ebene kann es Fortschritte geben. Zeugen dafür sind die vergangenen und aktuellen Urteile von Gerichten wie dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Ich traue ihm auch zukünftige Urteile zu.
Auf globaler Ebene kann es Fortschritte geben. Ich sehe das in der Angst derjenigen, die internationale Verbrechen begangen haben und deren Reisefreiheit ins Ausland eingeschränkt ist. Ich sehe es im langsamen, aber stetigen Fortschritt der Anklagen vor dem Internationalen Strafgerichtshof und anderen juristischen Instanzen. Ich sehe es in den schwankenden Bewegungen, die uns einem wirklichen System von internationalem Recht entgegen trägt.
Die Macht der Erinnerung und der Vorstellungskraft – wie auch ihre Schatten und ihre Folgen – können nicht so einfach entsorgt werden. Das Erbe von 1945 besteht fort. Ich bezweifle, dass es so einfach zerstört werden kann.
Pass auf Dich auf, mein lieber abwesender Freund. Hör nicht auf zu träumen. Laufe weiter auf der Straße der Hoffnungsschimmer. Wenn sie Dich begleiten, werden sie auch für uns leuchten, die wir bei Dir sind.
Aus dem Französischen von Karen Genschow
-
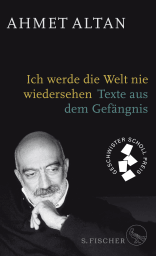 »Ich werde die Welt nie wieder sehen. Ich werde nie wieder den Himmel ohne den Rahmen sehen, den die Wände des Gefängni ...
»Ich werde die Welt nie wieder sehen. Ich werde nie wieder den Himmel ohne den Rahmen sehen, den die Wände des Gefängni ...
