Das Establishment in der Kritik
Am 15. März finden in den Niederlanden Parlamentswahlen statt. Der in der Nähe von Groningen lebende Schriftsteller Thorsten Palzhoff nimmt dies zum Anlass, um für uns über die politische Situation im Land zu schreiben. In seinem Beitrag schildert er, wie SchriftstellerInnen und Kulturschaffende auf die Auftritte Geert Wilders' reagieren.
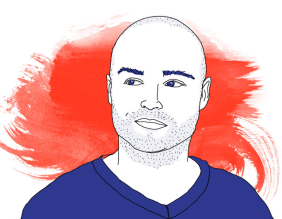
Ich erinnere mich noch an die gehässigen Reaktionen auf die von Julia Franck und Moritz Rinke initiierte Wahlkampfinitiative »Steinmeier wird Kanzler« vor der Bundestagswahl 2009. Mal gründete sich die Ablehnung auf die Absurdität, überhaupt einer politischen Partei eine Empfehlung auszusprechen, mal auf die unbeholfene Idolatrie, mal auf die Anmaßung, sich selbst derart wichtig zu nehmen. Nicht nur in meinem privaten Umfeld, auch in der Öffentlichkeit wurde die politische Meinungsäußerung als unpassender, wenn nicht gar unredlicher Akt der Aufmerksamkeitsgenerierung empfunden. Wie es schien, wurde über den Einzelfall hinaus dem Rollenverständnis des Schriftstellers als einem sich überpersönlich zu Wort meldenden Beobachter die Luft herausgelassen.
Ermüdet vom ritualisierten Schulterschluss zwischen Kulturschaffenden und der Sozialdemokratie, abgestoßen von der Marktliberalisierung des SPD-Parteiprogramms seit Schröders Agenda 2010, deren Konsequenzen immer deutlicher den neoliberalen Zeitgeist bestätigten, hielt man sich bei der nächsten Bundestagswahl im Jahr 2013 mit Wahlaufrufen zurück. Wer heute noch einmal die politischen Stellungnahmen liest, welche die ZEIT damals als Ergebnis einer Umfrage unter 48 Kulturschaffenden und Intellektuellen veröffentlichte, kann den Antworten ihren politischen Zeitgeist anmerken. 2013 war nicht nur eine Periode der Ratlosigkeit angesichts zweier Volksparteien ohne politischen Gestaltungswillen, sondern auch eine Zeit vor dem grenzüberschreitenden Erfolg der Rechtspopulisten. Spätestens seit dem Brexit hat der Aufstieg der nationalkonservativen Kräfte die Frage nach der Konstitution und dem Zusammenhalt der EU stärker ins Bewusstsein gerückt.
2016 war das Jahr der Wählerabkehr vom politischen Establishment, ob nun beim Brexit, der Präsidentschaftswahl in Österreich mit einem starken Abschneiden von Hofers FPÖ, dem Erstarken der AfD bei Landtagswahlen in Deutschland, der Abstimmung gegen Renzis Referendum, bei der sich die Opposition um Beppo Grillos Fünf-Sterne-Populisten behauptete, oder natürlich der Wahl Donald Trumps zum Präsidenten der USA. Mit der niederländischen Parlamentswahl beginnt nun das europäische Wahljahr 2017, und angesichts der glänzenden Umfragewerte des Rechtspopulisten Geert Wilders darf man sich fragen, ob sich die Tendenzen des Vorjahres fortsetzen werden.
Als zugezogener Ausländer nehme ich die letzten Zurüstungen vor der Parlamentswahl weder ganz von Innen noch von Außen wahr; halb erwarte ich sie als kommenden Eingriff in die eigenen Lebensumstände, halb als womöglich richtungsweisendes Vorspiel zu den Wahlen in Frankreich und Deutschland. Jene Partei, die den Demoskopen zufolge von jedem vierten Wahlberechtigten Zuspruch erhält, will die Niederlande allein für die Niederländer haben und mich des Landes verweisen. Geert Wilders‘ PVV will das Land von allen Spuren islamischer Religionskultur, von Zuwanderung und der EU befreien. Angesichts der schweren Verfassungsbrüche, die das absurde Wahlprogramm von nur einer Seite Umfang impliziert, befremdet mich der Umgang der öffentlichen Kritik mit Wilders‘ antidemokratischen Plänen. Der liberale Geist der Niederlande, so scheint mir, lässt noch die haltlosesten Behauptungen und Forderungen dieses Mannes zu, deren Begründung er konsequent verweigert.
Vielleicht muss man um den Erfolg und die Ermordung des Rechtspopulisten Pim Fortuyn wissen, um die gesellschaftlichen Brüche zu erahnen, die zur jetzigen Situation geführt haben. Fortuyn wurde 2002 von einem Umweltaktivisten ums Leben gebracht – also einem Vertreter jener linken Gesellschaftsschicht, die von den Rechtspopulisten als fahrlässige Verursacherclique heutiger Krisenzustände angegriffen wird. Ich frage mich, ob es einen Zusammenhang zwischen Fortuyns Ermordung und dem verhältnismäßig vorsichtigen journalistischen Umgang mit jenem Mann gibt, der die vakante Stelle Fortuyns eingenommen hat und seit 2004 unter ständigem Personenschutz lebt.
Wie begegnen die Schriftsteller und Kulturschaffenden des Landes der Situation?
Literatur und Politik werden in den Niederlanden weitaus weniger selbstverständlich zusammengedacht als in Deutschland, wo durch Goethe, Thomas Mann und Günter Grass dem Amt des Dichterfürsten eine über das rein Literarische hinausweisende Repräsentationsfunktion zugefallen ist. Als repräsentativ für die niederländische Literatur des 20. Jahrhunderts gelten vor allem die »Groten Drie«. Neben W.F. Hermans und Harry Mulisch zählt auch Gerard Reve zu den Großen Drei, ein stets auf Knalleffekte setzender Autor, der nicht allein mit seinem rassistischen Gedicht ›Voor Eigen Erf‹ im Jahr 1974 zeigte, wessen Geistes Kind er war; das Gedicht schließt mit den Zeilen: »Oh Niederlande, erwache / Wirf all den schwarzen Abschaum raus / Unser Land für uns / Auf zur Weißen Macht!« (Meine Übersetzung.) Auch wenn Harry Mulisch unter dem Titel ›Het ironische van de ironie‹ Einspruch gegen Reves auf Publikumswirksamkeit bedachten Faschismus erhob: Die Neigung zu öffentlichem Widerspruch scheint unter den niederländischen Autoren nicht besonders ausgeprägt zu sein. Den liberalen und toleranten Geist, für den die Niederlande so lange bekannt waren, nehme ich gegenwärtig eher als ein Geltenlassen von extremistischen Auffassungen in der Öffentlichkeit wahr.
Natürlich schreibt Arnon Grunberg täglich seine Volkskrant-Kolumne; natürlich tritt Leon de Winter vor allem seit 9/11 als Gesprächspartner in Talkshows und regelmäßiger Kolumnist in verschiedenen Zeitungen und Wochenmagazinen auf; natürlich hat A.F.Th. van der Heijden im vergangenen Jahr im NRC Handelsblad unter dem Titel ›President Tsaar op Obama Beach‹ einen sechzigteiligen Fortsetzungsroman über den Abschuss des Flugzeugs MH17 in der Ukraine veröffentlicht, bei dem 192 niederländische Passagiere ums Leben kamen; und natürlich gibt es weitere Autoren, die sich in Glossen politischen und gesellschaftlichen Themen widmen, aber all das geschieht eher aus einem persönlichen Habitus heraus und im Bewusstsein der Folgenlosigkeit. Eine politische Umfrage unter Autoren und Intellektuellen wie jene der ZEIT vor der letzten Bundestagswahl liegt in den Niederlanden außerhalb des Erwartungshorizonts.
Sicher, es gibt Ausnahmen. Zu ihnen zählt der Autor Özcan Akyol, der 2014, angewidert von Wilders’ Marokkanerhetze und seiner Forderung, alle Bürger mit einem Ausweis aus einem islamischen Land müssten eine Anti-Scharia-Erklärung unterzeichnen, im Rundfunk und via Twitter verkündete, seinen abgelaufenen türkischen Pass zu verlängern. Die Autorin Elle van Rijn stellte im November 2014 in einer Talkshow ihren Roman vor und fand sich in einer Gesprächsrunde mit dem ebenfalls als Gast geladenen Geert Wilders wieder. Weil der Moderator es nicht tat, widersprach sie Wilders‘ mit fragwürdigen Statistiken untermauerter Stimmungsmache gegen Islam und Marokkaner. Dafür erntete van Rijn Morddrohungen von Wilders-Anhängern. Von öffentlichen Solidaritätserklärungen oder Stellungnahmen zu den Vorfällen ist mir nichts bekannt.
Gegenwärtig macht ein Videoclip die Runde, der den Kommentaren zufolge das Versagen der niederländischen Journalistik demonstriert. In dem Videointerview macht der BBC-Journalist John Sweeney den niederländischen Kollegen vor, wie leicht Wilders mit einfachen Fakten und Argumenten in Bedrängnis gebracht wird. In die gleiche Kerbe schlägt jetzt, kurz vor der Wahl, der Autor und Musikproduzent Arjen Lubach, der in seiner satirischen Fernsehshow ›Zondag met Lubach‹ so humorvoll wie seriös Wilders‘ dilettantische Konzeptlosigkeit und notorische Lügenhaftigkeit bloßgestellt hat. In den zwölf Jahren seiner parlamentarischen Tätigkeit in der eigenen Partei hat Wilders es weder gegenüber dem Parlament noch gegenüber der Öffentlichkeit geschafft, auch nur eine einzige konkret benennbare politische Maßnahme vorzustellen. Lubach ruft seine Zuschauer dazu auf, Wilders‘ Verweigerungshaltung mit dem Hashtag #HOEDAN? (etwa: #WIE DENN JETZT?) zu beantworten.
Lubach nimmt auch Wilders‘ Polemiken gegen die Eliten aufs Korn, die blind seien für den Willen des Volkes. Die niederländische Presse arbeitet sich seit einiger Zeit an dem Thema einer wachsenden Kluft zwischen dem Volk und seinen Vertretern sowie den Medien ab. Ihnen vorgearbeitet haben Rechte wie Martin Bosma, ein Wilders-Mitstreiter der ersten Stunde, der sich in seinem 2010 erschienenen Buch ›De schijn-élite van de valse munters‹ über ein Zuviel an Multikulti und Einwanderern beklagt, das sich gegen den Willen des Volkes etabliert habe. Schuld daran seien die 68er, die nun als Elite in den Schlüsselstellen der Entscheidungsgewalt säßen und mit erhobenem Zeigefinger das Narrativ der political correctness durchsetzten. Die linken Eliten seien ähnlich blind für die Gefahren, die der Islam mit sich bringe, wie vormals für die Schattenseiten des Kommunismus.
Ein anderes Beispiel: Der noch recht junge Publizist, Jurist und Rechtspopulist Thierry Baudet – 2016 hat er seinen im Vorjahr gegründeten, nationalistisch-konservativen Thinktank Forum voor Democratie in eine Partei umgewandelt und sich selbst in einen Parteiführer – wird nicht müde, die EU als ein zum Scheitern verurteiltes, elitär-technokratisches Projekt zu verdammen wie überhaupt jede Lebens- und Erscheinungsform der Multikulturalität. In einem 2013 von ihm im Rahmen einer Bürgerinitiative mitveranlassten Referendum zur Zukunft der Niederlande in der EU heißt es, die Niederlande würden für den Überkonsum und die fehlende Steuermoral in den südeuropäischen Staaten geradestehen. Dass es zu keinem Volksaufruhr komme, wird einer schleichenden Form der Zensur angelastet: Weil beispielsweise Kritik an der Eurowährung bei den Eliten – den Hochschullehrern, der Finanz, den Journalisten und Bürokraten – auf Widerstand stoße, komme sie für jeden Andersdenkenden einem Karriereselbstmord gleich.
Die Rhetorik des Kulturkampfs zwischen Elite und Volk eint die Rechtspopulisten aller Länder, darunter absurderweise auch jene, die in Budapest oder Washington die Regierung anführen. Wie gesehen, gaben vor der Bundestagswahl 2013 viele der von der ZEIT befragten Kulturschaffenden an, keinen substanziellen Unterschied mehr zwischen CDU und SPD ausmachen zu können. Inzwischen zeigt sich, dass die Frontlinien nicht mehr zwischen Links und Rechts, sondern zwischen Liberal und Nationalkonservativ verlaufen. Die Krise der Repräsentation, von der in der politischen Literatur schon länger die Rede ist, drückt sich nicht allein in einem Misstrauensverhältnis zwischen Regierenden und Regierten, sondern auch in einer kulturell konnotierten Spaltung der Gesellschaft aus.
Krise der Repräsentation, heißt das auch, dass sich das Rollenverständnis der Literatur unter der Signatur unserer Zeit wandelt? Man denke an den eingangs erwähnten Widerstand gegen politische Meinungsäußerungen von Schriftstellern oder an jene Kulturkämpfer, die sich von dem deutschen Preis- und Stipendienwesen provoziert fühlen (eine Kritik, die in geringerem Maße auch in den Niederlanden geübt wird); in einem Ton, als würden Bankenrettungen verhandelt, wird von der Autoren-Überlebensförderung nichts Geringeres als der Untergang lesbarer Literatur erwartet. Oder man denke an die Feuilletondebatte über die Bildungsbürgerkinderliteratur, an die Ätzereien gegen den Literaturbetrieb, zu dem selbstverständlich niemand selbst gehört, sondern immer eine Kritiker- und Juryelite gemeint ist, in deren hermetisch gedachtem Cliquenkreis eine wenig volksnahe Literatur künstlich am Leben erhalten werde.
Statt Verdammungen bräuchte es eine Kritik, die zur Debatte einlädt: etwa über ein bestimmtes Repräsentationsverständnis politischer Literatur, demzufolge weniger der Autor politisch wach als vielmehr die Romaninhalte sozial relevant zu sein hätten – ganz so, als ließe sich ein gesellschaftsmoralisches Anliegen nach Belieben in eine künstlerische Form bringen. Wie schnell werden dann alte Gemeinplätze für die Gestaltung neuer Verhältnisse bemüht und der Leser zum Automaten einer abzurufenden Bewertung degradiert: Literatur als Kompensierung eines Mangels an der öffentlichen Auseinandersetzung. Das alles spricht natürlich nicht gegen die Möglichkeit von politischer Literatur in ästhetisch gelungener Form, und so soll jedem Leser ein Rest kritischer Hoffnung auf den Erzählband ›Als dit zo doorgaat‹ (›Wenn das so weitergeht‹) zugestanden sein, für den gegenwärtig rund zwanzig Autoren literarische Negativvisionen einer vom Rechtspopulismus regierten Welt beitragen. Das Projekt wurde vom Autor und Journalisten Auke Hulst initiiert und soll im Eiltempo umgesetzt werden, damit der Band kurz vor der Wahl am 15. März erscheinen kann.
Aber muss sich das gesellschaftliche Engagement, der politische Erkenntnis- und Vermittlungswille eines Schriftstellers unbedingt in literarischer statt in faktisch-argumentativer Form ausdrücken?