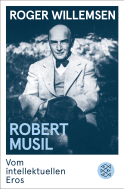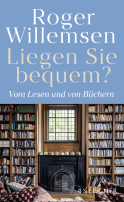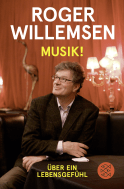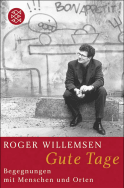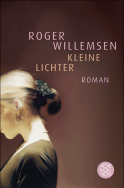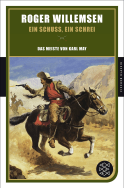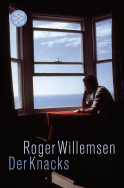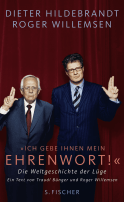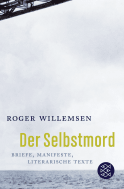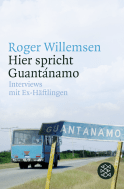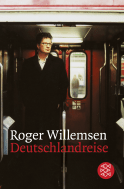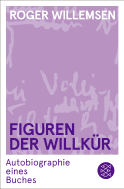
Die Kunst, ein Gespräch zu bewohnen
Vor vier Jahren starb Roger Willemsen. Zum Todestag erinnert Oliver Klemp an dessen ganz besondere Art, Gespräche zu führen.
Am 7. Februar 2020 ist es vier Jahre her, dass Roger Willemsen im Alter von sechzig Jahren starb. Willemsen war Interviewer, Schriftsteller, Moderator, Honorarprofessor, Kulturvermittler und Möglichkeitsweitender. Möglichkeitsweitender? Möglichkeitsweitender in dem Sinne, dass Roger Willemsen ein Interesse daran hatte, die Rahmen der Begegnungsformen zu weiten und durchlässiger zu machen.
In der posthum nach seinem Tod erschienenen »Zukunftsrede« »Wer wir waren« sagte Willemsen: »Von den Prozessen der Kultur kann nicht gesprochen werden, ohne zu fragen, unter welchen Bedingungen Bewusstsein heute überhaupt zustande kommt.« Es ist die Frage danach, wie sich das Bewusstsein bildet, aus dem heraus gesehen wird. Wie sich der Blick konstituieren konnte, der sieht, was er sieht und wie er sieht. Es ist die Frage danach, weshalb Möglichkeitsräume kleiner werden, sich gar aufzulösen scheinen und Aussprüche wie »Ich kann mir eher das Ende der Welt vorstellen als das Ende des Kapitalismus« überhaupt erst entstehen.
In den 1990er Jahren interviewte Roger Willemsen geschätzt zweitausend Personen in den Fernsehsendungen »0137«, »Willemsen – Das Fernsehgespräch«, »Willemsens Woche«, »Willemsens Musikszene«, »Das Gipfeltreffen« und »Nachtkultur mit Willemsen«. Als er in den 2000ern nicht mehr zu seinen Bedingungen beim Fernsehen arbeiten konnte, zog er sich aus dem Medium zurück. Den Umbruch markiert jener Punkt, als Willemsen ein »Gipfeltreffen« zwischen Eva Herman und Hansi Hinterseer moderieren sollte und befand: »Das können andere besser. Ihr irrt euch auch unter professionellen Gesichtspunkten. Das kann ich nicht gut. Lasst das jemand anderen machen.«
Nach der schmerzlichen Erfahrung und Erkenntnis, dass sich das Medium Fernsehen in Verbindung mit einem qualitativ hochwertigen Inhalt vom selbigen abwendet und sich quoten- und contentorientiert positioniert, begann Willemsen sich auf das zu konzentrieren, dem er sich verpflichtet fühlte: Dem Schreiben, der Literatur – dem Umgang mit Sprache.
Willemsen hatte ein Verständnis von Kommunikation, das über die linguistische Konstituierbarkeit hinausging. Willemsens Kommunikationsverständnis zielte darauf umfassend zu sein und wesentlich zu werden. Wesentlich in jener Auffassung, dass das sprechende Wesen, verbal oder nonverbal, selbst von Kommunikation durchdrungen, in seiner seienden Existenz selbst Kommunikation ist.
»Die Sprache muss ja nicht gesprochen, sie muss bewohnt werden, und wir haben also nicht uns in der Sprache, wir haben die Sprache in uns auszuprägen«, sagte Roger Willemsen in der Trauerrede für seinen Weggefährten, Freund und Komplizen, den Kabarettisten Dieter Hildebrandt, mit dem er den Dialog »›Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort!‹ Die Weltgeschichte der Lüge auf die Bühne« brachte. Willemsens Sicht auf Sprache zielt auf einen Blickwinkel, Sprache nicht bloß als Träger von Informationen zu begreifen, sondern als etwas Weltschaffendes und Welterschaffendes zu sehen. Sprache stellt durch ihre Verwendung im Konkreten Konkretheiten her, d. h. Gefühle und Empfindungen, Assoziationen und Denkzusammenhänge sowie Vergegenwärtigungen und Erfahrungen werden maßgeblich mitbestimmt. Sprache formt den Blick und ist zugleich dessen Sprachrohr.
Willemsen nahm die Dinge und die Sprache wörtlich. Er nahm ernst, und er nahm genau. Das Wörtlich-Nehmen des Gesprochenen bildet hierbei ein Ernst-Nehmen des Gesagten, weil durch das Gesagte und die Art von Betonung und verwendeter Sprache sich Bilder malen. Bilder, die eine Realität erzeugen und dadurch Welt-Bilder entstehen lassen, die möglicherweise selbst einmal Welt werden. Einen Ausspruch und einen Gedanken wörtlich zu nehmen, heißt somit, ihn ernst zu nehmen, in seiner Möglichkeit auf Verschiebung und Veränderung von Wahrnehmung und Bewusstsein.
Roger Willemsen hing, im wörtlichen und bildlichen Sinne, an der Form des verbindlichen Gesprächs, d. h. an einem, das nicht Flüchtigkeit ist, sondern Belastbarkeit und Verlässlichkeit. Das verbindliche Gespräch als eines, das aus einer Überzeugung heraus spricht, verbunden mit einer folgerichtigen Konsequenz und einer zugrunde liegenden Haltung. Einer Haltung, die aus einem ehrlichen, aufrichtigen Interesse am Gegenüber hervorgeht und sich in einem Zuhören des Gegenübers zeigt, sowie dem Einräumen von Zeit, die benötigt wird, um nachdenken und vorspüren zu können, um präzise zu antworten.
»Warum so schnell?«, fragt Willemsen in »Der Knacks«. »Vielleicht der Beliebigkeit wegen, die die Geschwindigkeit produziert? Man lebt geschwind, um unfühlbar zu leben, nichts so stark wahrnehmend wie die Geschwindigkeit selbst. In dieser Dynamik verschwinden die Brüche, in der Beschleunigung wird etwas Therapeutisches frei. Unwillentlich, ohne Dazutun ergriffen, passiv, als Empfangender, als Opfer der Geschwindigkeit erfährt man die Tröstung des Tempos.«
Die Kunst, ein Gespräch zu bewohnen, hat etwas damit zu tun, in einem Gespräch zu sein, sich in jenem auszubreiten, anwesend zu sein und in jenem stattzufinden. Und zugleich, statt zu finden, gemeinsam auf der Suche zu sein. Als ein Suchender nach Erkenntnis. Einer gemeinsamen Suche in einer gemeinsamen Bewegung auf eine gemeinsame Erkenntnis zu. Das Gespräch als ein Ort zum Wirklich-Werden.
Die Kunst, ein Gespräch zu bewohnen, ist somit auch ein Nein-Sagen-Können. Ein Nein-Sagen-Können zu allem, was den Wohnraum namens Gespräch zumüllt und stickig werden lässt, ein Wirklich-Werden verhindert. Und ein Ja-Sagen zu dem Zeitgeben, das benötigt wird, einen Gedanken zu fassen, ihn zu formulieren, mitzuteilen und zu verstehen.
So lässt die Kunst, ein Gespräch zu bewohnen, ein Interagieren entstehen, ein Spiegeln und Erkennen. Einsamkeit kann überbrückt werden, wie Willemsen es nannte, und Zweisamkeit wird hergestellt. Um in der Zeit wirklich zu werden und nicht mit der Zeit. Weil heute schon möglich sein kann, was übermorgen womöglich selbstverständlich ist und morgen noch als angeblich unvorstellbar abgetan werden könnte. Das Glück von morgen schreibt sich aus den Dialogen von heute. Man möchte fast sagen, die Zukunft könnte wunderbar werden, und du bist dafür verantwortlich.