Die Partei als Theater
Am 15. März finden in den Niederlanden Parlamentswahlen statt. Der in der Nähe von Groningen lebende Schriftsteller Thorsten Palzhoff nimmt dies zum Anlass, um für uns über die politische Situation und die Stimmung im Land zu schreiben. In seinem ersten Beitrag geht es um Geert Wilders und die PVV.
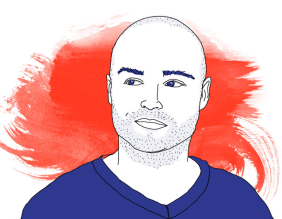
Der Fraktionssitz von Geert Wilders’ rechtspopulistischer Partij voor de Vrijheid (PVV) ist im hässlichsten Flügel des Haager Parlamentsgebäudes untergebracht. Früher befand sich hier ein Gästehaus, weshalb der Flügel noch immer ›Hotel‹ genannt wird, aber mit der PVV als Hausherren gleicht er eher einer Festung. Nur wer über einen Zugangspass mit gültigem Scancode verfügt, erhält Einlass. Der Rest muss sich beispielsweise durch den Erfahrungsbericht Undercover bij de PVV der als Praktikantin getarnten Journalistin Karen Geurtsen Zugang verschaffen oder durch Zeitungsartikel des Volkskrant-Autors Martin Sommer. Hinter den Türen, so ist zu erfahren, muss man zunächst einmal Gürtel und Schuhe ausziehen und sich durch eine Detektorenschleuse dirigieren lassen, wie man sie von Flughäfen kennt. Haben die Sicherheitskräfte nichts Bedenkliches entdeckt, gelangt man durch den Presseraum zu einem langen, blassrot tapezierten und von Leuchtstoffröhren erhellten Büroflur. Hier und da ein zerschlissener Zweisitzer, flankiert von antiislamistischen Postern und, falls der Parteichef im ›Hotel‹ ist, Bodyguards mit Knopf im Ohr. Aber selbst wenn Wilders im Haus ist, bekommen ihn selbst die eigenen Mitarbeiter selten zu Gesicht. In seinem Büro sind die Vorhänge Tag und Nacht zugezogen, draußen wird er in einem gepanzerten Auto chauffiert, und wenn er mal mit seiner Fraktion auf einem Boot unterwegs ist, fängt ein begleitendes Polizeiboot jedes sich nähernde Wasserfahrzeug ab. Zu Presseterminen – wobei er nur selten Interviews gibt – erscheint Wilders in einem Ring von Bodyguards, bei denen er jeden Gang auf die Toilette anmelden und warten muss, bis das WC gesichert ist. Am Ende des Tages wird Geert Wilders in sein ›safe house‹ zurückgebracht, eine spezialgesicherte Unterkunft ohne Adresse, wie sie beispielsweise auch Kronzeugen zur Verfügung gestellt wird.
Seit Oktober 2004 lebt Geert Wilders unter ständigem Personenschutz. Er, der schon Ende 1999 den extremistischen Islamismus als eine der größten Gefahren des kommenden Jahrzehnts ausgerufen hat, veröffentlicht 2004 mit dem Fraktionsgenossen Oplaat ein Manifest, in dem die Ausweisung radikaler Muslime und eine endgültige Verweigerung einer EU-Mitgliedschaft der Türkei gefordert wird. Das Manifest wird von einem Zeitungsinterview begleitet, in dem er sich abfällig über »Kopftücher« äußert. Es besiegelt den Bruch mit seiner Partei, der liberalkonservativen VVD. Als ›Gruppe Wilders‹ versammelt er Gleichgesinnte um sich, aus der Anfang 2006 die PVV hervorgehen wird. Und jetzt, zwei Monate vor der niederländischen Parlamentswahl in diesem März, liegt Wilders‘ Partei den Demoskopen zufolge klar vorn.
Seit seinem Manifest ist der Staat für seinen Schutz zuständig. Ein aufwändiges Unternehmen, bei dem, wie die Volkskrant nach längerer Recherche jüngst enthüllt hat, die Geheimdienste AIVD und MIVD regelmäßig Analysen der Gefährdungslage im In- und Ausland an die nationale Terrorismus- und Sicherheitsbehörde NCTV liefern. In den ersten Jahren soll es regelmäßig konkrete Bedrohungen gegeben haben. Inzwischen wird die permanente Gefährdungslage von internationalen Organisationen wie al-Qaida und dem IS bestimmt, auf deren Tötungslisten Geert Wilders steht.
Seine politische Rhetorik hat sich seitdem eher noch weiter radikalisiert. Wilders fordert, dass die niederländischen Muslime, wenn sie im Land bleiben wollten, die Hälfte aus dem »faschistischen« Koran herausreißen müssten, den er mit Hitlers ›Mein Kampf‹ vergleicht. Er will Moscheen verbieten und eine Kopftuchsteuer erheben. Straftäter sollten nach dem dritten Delikt lebenslänglich inhaftiert, Randalierern in die Kniescheiben geschossen werden.
Seinen Parteigefährten gesteht er, dass ihm der Personenschutz nicht nur das Leben schwer mache, sondern der PVV auch Sitze im Parlament einbringe. Als der NCTV einmal erwägt, den Schutz von sechs auf vier Bewacher zu verringern, frotzelt er, seine Partei müsse wohl Korane verbrennen. Über den Wirbel, den seine Äußerung in den arabischen Ländern verursacht, klärt ihn laut Volkskrant der NCTV auf; Wilders bedankt sich per E-Mail für die Warnung, gibt aber um der politischen Wirkung willen an die Medien weiter, der NCTV habe ihn einzuschüchtern versucht.
Das ist nicht das einzige Mal, dass sich jene, die für seine Sicherheit verantwortlich sind, über den Missbrauch ihrer Arbeit für Wilders’ populistische Profilierung ärgern müssen. Als er Geheimdienstinformationen über die Anschlagspläne einer kaukasischen Gruppe an die Öffentlichkeit bringt, droht ihm ein Prozess wegen des Verrats von Staatsgeheimnissen – ein Delikt, auf dem eine mehrjährige Gefängnisstrafe steht. Der Ministerrat berät über die Angelegenheit, schließlich lässt man die Sache auf sich beruhen. Fortan schweigt man auf beiden Seiten. Wilders selbst stuft seine Beschützer als Mitarbeiter des Geheimdienstes ein. Und der ermittelt tatsächlich gegen ihn, den Abgeordneten, wegen seiner Kontakte zu rechtskonservativen Israelis – Botschaftsangehörigen, Politikern, Militärs –, weil man sich nicht den Mossad ins Parlament holen will. Wegen seines antiislamischen Propagandafilms ›Fitna‹, den Wilders in der Villa eines Freundes dreht und der für viel diplomatischen Wirbel sorgen wird, arbeitet man sogar mit dem dänischen Geheimdienst PET zusammen, weil man bei einer Vorschau im kleinen Redaktionskreis des dänischen Fernsehsenders DR2 über einen Maulwurf in Erfahrung bringen will, ob der Populist in dem Film den Koran verbrennt.
In der NCTV sollen sich hochrangige Mitarbeiter beklagen, dass in den Geheimdiensten der politische Mut für einen Abzug des Personenschutzes fehle. Zu tief sitzt das Trauma, das die Ermordung des Rechtspopulisten Pim Fortuyn im Jahr 2002 bei der AIVD hinterlassen hat. Zwei Jahre nach Fortuyns Erschießung durch einen Umweltaktivisten wird der islamkritische Kolumnist und Filmemacher Theo van Gogh mitten in Amsterdam von einem Islamisten ermordet. Man entdeckt, dass der Mörder, Mohammed Bouyeri, zuvor einen Drohbrief an Wilders geschrieben hat. Wilders steht zu diesem Zeitpunkt schon unter Personenschutz, weil einen Monat zuvor in einem dschihadistischen Internetvideo zu seiner Enthauptung aufgerufen wurde. Die Ermordung van Goghs alarmiert die Geheimdienste und setzt den Status des Personenschutzes herauf. Seitdem kann Wilders ohne Bewachungstrupp keinen Fuß mehr vor die Tür setzen.
Der permanente Personenschutz stärkt die von Wilders inszenierte Aura der Unnahbarkeit. Er verordnet sie auch seiner Partei. So wie das ›Hotel‹ der PVV, aus dessen Wände kaum Interna nach außen dringen, vor Außenstehenden gesichert ist, so sind auch die Parteiversammlungen nicht zugänglich. Das Gleiche gilt für die PVV als Partei: Als bizarrer Ausnahmefall in einer demokratischen Parteienlandschaft lässt sie keine Anträge auf Mitgliedschaft zu – eine resolute Methode, sich neue Ideen, mögliche Kritik und die Gefahr einer Unterwanderung vom Hals zu halten. Es heißt, dass man im ›Hotel‹ dem Parteiführer in allen Belangen kritiklos folgt, auch wenn Wilders, obschon ständig anwesend, in der Fraktion eigentlich nie zu sehen ist. Zum Unmut seiner bewundernden Gefolgschaft verschanzt er sich nach Parteiversammlungen sofort in seinem bewachten Büro.
Mit den Medien dürfen nur PVV-Mitarbeiter in Führungspositionen reden, und die Partei lässt auch nicht jeden – vor allem nicht jede Zeitung – an sich heran. Lieber nutzt man das Parlament als Bühne für medienwirksame Auftritte. Extreme Forderungen, möglichst forsch und ohne jede inhaltliche Auseinandersetzung vorgebracht, sichern einen Platz weit vorn in den News und Aufmerksamkeit bei der Wählerschaft. Selbst kritische Fragen an die Regierungspolitik – etwa nach den Kosten, die Immigranten verursachen – sind in erster Linie für das Publikum gedacht. Martin Bosma, ehemaliger Fernsehjournalist und PVVler der ersten Stunde, erklärt in einem Interview, die PVV würde ungefiltert mit den Menschen im Land kommunizieren. Ohne Internet, so Bosma, hätte es nie eine PVV gegeben. In den offiziellen Medien werde einem sofort das Etikett »Rechtsextrem« angeheftet.
Über das Internet also kommt die hermetisch geschlossene PVV an jene Themen, welche die etablierten Parteien auf der Straße liegen lassen. Wie Donald Trump hat Wilders erkannt, dass sich über Twitter kurz und zackig Politik machen lässt. Als König Willem-Alexander in seiner jüngsten Weihnachtsansprache in Richtung der PVV das Volk vor falscher Nostalgie und Populismus warnte, twitterte Wilders prompt, dass den Niederländern nicht mit salbungsvollen Worten, sondern mit Maßnahmen gegen den Islam geholfen wäre.
Damit hat Wilders auf das Parteiprogramm der PVV verwiesen. Der Entwurf wurde parteitypisch online veröffentlicht und kommt samt Finanzplan mit einer einzigen Seite aus. Politische Inhalte werden zu wirksamen Schlagworten verknappt, die sich über soziale Medien verbreiten lassen. Der erste und wichtigste Punkt ist die »Deislamisierung« der Niederlande, die man unter anderem durch eine Präventivinhaftierung von »radikalen Muslimen« erreichen will. Kein Wort darüber, dass eine solche Maßnahme den Rechtsstaat aushebeln würde, wie man das beispielsweise von Erdogans Massenverhaftungen in der Türkei kennt. Die PVV fordert den Ausstieg der Niederlande aus der EU, den Stopp jeder Förderung von Entwicklungshilfe, Kunst, Forschung und Medien und die Aufstockung des Budgets für Verteidigung und Polizei. Die Wähler werden mit Versprechungen von mehr direkter Demokratie gelockt, die man in der eigenen Partei vermissen lässt, von niedrigeren Mieten, der Senkung des Rentenalters und der Steuern. Kein Wort darüber, wie man das alles in der Praxis durchsetzen will. Stattdessen hat man sich als Finanzplan ein aberwitziges Nullsummenspiel ausgedacht, in dem allein die »Deislamisierung« 7,2 Milliarden Euro in die Staatskassen zaubern soll.
Reklame für seine Partei machte Wilders auch im vergangenen Dezember als Angeklagter vor Gericht. Im März 2014 hatte er bei einem Auftritt vor Anhängern in einem Haager Café gefragt, ob sie mehr oder weniger Marokkaner in ihrer Stadt und ihrem Land haben wollten. Sechzehn Mal ließ er sein Publikum vor laufenden Kameras »Weniger!« skandieren, bevor er versprach: »Wir werden uns darum kümmern!« Dafür wurde er nun von einem Amsterdamer Gericht wegen Gruppenbeleidigung und Anstiftung zur Diskriminierung schuldig gesprochen.
Der Prozess hat eine Debatte wiederaufleben lassen, die schon zu Zeiten von Pim Fortuyn und Wilders’ erstem Prozess – er wurde 2011 vom Vorwurf der Anstiftung zum Rassenhass freigesprochen – die Gemüter erhitzte. In den Zeitungen diskutiert man über das Recht auf freie Meinungsäußerung, die, so Wilders’ Anwalt Knoops, bei einem Politiker weiter gefasst werden müsse als beim gewöhnlichen Bürger. Die Richter dagegen kommen zu dem Schluss, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung dort ende, wo die Rechte anderer verletzt würden. Wilders, der den Verhandlungen fernbleibt, wirft den Richtern über Twitter politische Befangenheit vor, und sein Anwalt erklärt das Verfahren zu einem politischen Prozess gegen das Parteiprogramm und die Wählerschaft der PVV. Zur Urteilsverkündung erscheint Wilders im Gerichtssaal und stilisiert in seiner Wortmeldung nicht nur sich selbst, sondern auch »Millionen Niederländer« zum Opfer. Nachdem er seine Rede verlesen hat, verlässt er das Gericht ohne ein einziges Wort an die Presse – die Schlagzeilen sind ihm ohnehin garantiert. Nach weiteren Twitterangriffen auf die Richter verkündet er, das Urteil werde ihn nur stärker machen.
In der Tat ist es fraglich, ob ein derart instrumentalisierter Gerichtsprozess, aus dem Wilders straffrei und unter Wahrung seines Mandats herausgeht, seiner Partei politischen Schaden zufügen wird. Umfragen zufolge hat der Fall selbst bei PVV-Nichtwählern das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat erschüttert, und Wilders‘ Verurteilung scheint sich bei unentschlossenen Wählern eher zugunsten der PVV auszuwirken. Wie schon erwähnt, liegt Wilders‘ Partei in sämtlichen repräsentativen Umfragen zum Jahreswechsel mit rund einem Drittel der Stimmen vorn. Aber wer vertraut nach dem Brexit, nach Trump schon noch Demoskopen?