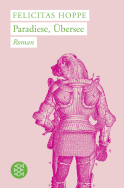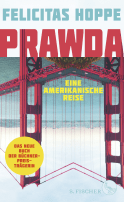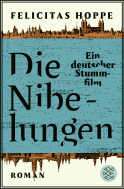
Eine amerikanische Reise
Felicitas Hoppe sagt: »Kunst kennt keine Authentizität!« Trotzdem ist sie auf den Spuren von Ilja Ilf und Jewgeni Petrow durch Amerika gefahren, über zehntausend Meilen weit. »Prawda« heißt das Buch, das sie darüber geschrieben hat. Einige Originalbilder, die wir der Seite http://www.3668ilfpetrow.com entnommen haben, zeigen wir hier, und das, obwohl Felicitas Hoppe sagt: »Bilder sind hochmanipulativ, der reine Text ist dagegen viel differenzierter.«

Boston, Goethe Institut, Donnerstag, 29. Oktober 2015
Sie sind die 10.000 Meilen bequemer abgefahren als die beiden Russen in ihrem Ford ohne Heizung und mit 40 Meilen pro Stunde Höchstgeschwindigkeit. Trotzdem sind sechs Wochen im Auto anstrengend. Wie war die Gruppendynamik?
Das war in der Tat eine spannende Herausforderung. Zum einen kannten wir uns nicht besonders gut, zum anderen umspannte unsere kleine Reisegruppe einen Altersunterschied von gut drei Generationen mit entsprechend unterschiedlichen Wahrnehmungen und Herangehensweisen. Unser rubinroter Ford wurde dabei manchmal zu einem goldenen Käfig. Am Anfang ließen wir uns Zeit, so dass wir schließlich in den letzten zehn Tagen fast die Hälfte der Gesamtstrecke zurücklegen mussten. Wir konnten kaum richtig pausieren und unserer eigenen Wege gehen. Insgesamt hat aber alles hervorragend funktioniert; wir sind stolz darauf, das gemeinsam durchgezogen zu haben.

Wie darf man sich das konkret vorstellen? Inwiefern diente das Buch von Ilf und Petrow als Vorlage?
Das präzise beobachtende und überaus witzig geschriebene Buch war eine perfekte Vorlage und hat unsere Reise ungeheuer entlastet, indem es eine Spur gelegt hat, der wir sozusagen pfadfinderhaft gefolgt sind. Das hat uns viele mühevolle Entscheidungen abgenommen.
Was hat sich seit den Zeiten von Ilf und Petrow verändert?
Der Wiedererkennungseffekt ist erstaunlich hoch. Selbstverständlich hat sich die Infrastruktur stark verändert. Das Straßennetz ist deutlich ausgebaut worden, die Großstädte sind weiter gewachsen. Sonst aber war vieles genau wie im Buch. Wir haben sogar noch Hotels entdeckt, in denen die beiden übernachtet haben. Ich habe während der Fahrt parallel die Stellen mitgelesen, die wir bereist haben. Da zeigt sich das Buch in einem ganz anderen Licht, weil man plötzlich wirklich sieht, was man liest: dieselben Motive, die wir auch aus den Bildern von Ilf kennen; vieles steht noch genauso unverrückbar da wie damals. Die Landschaft dahinter hat sich natürlich kein bisschen verändert. Unverändert wirklich ist aber auch die Essenz des Buches von Ilf und Petrow: das eingeschossige Amerika. Sobald man die Städte hinter sich lässt, taucht man in eine Art Niemandsland ein; im ländlichen und kleinstädtischen Amerika ticken die Uhren eben anders.

Der Mittlere Westen oder Texas ist wie ein anderes eigenes Land und hat wenig mit Chicago oder New York gemein. Man trifft auf den uns Intellektuellen bis heute so fremden Gründungskern des Landes. Hier haben sich Menschen niedergelassen, die ihre kleinen Geschäfte und Farmen betreiben, sie leben ihr Leben. Unvergessen der lakonische Satz einer Kassiererin in Nevada auf die Frage, wer dort gerade regiere: »What do I know, they come and go.«
Welche Bilder sind Ihnen besonders stark in Erinnerung?
Ich bin eigentlich ein städtischer Mensch; daher hat mich Las Vegas unglaublich beeindruckt, als Gipfel disneyhafter Verzerrung. In dieser Karikatur einer Weltstadt sind alle möglichen urbanen Zitate zusammengefügt, von Big Ben bis zum Eiffelturm.
Man arbeitet sich begeistert durch diesen dröhnenden Moloch wie durch eine Art Vorhölle, um dann in der scheinbar erlösenden Wüste zu landen. Und am Rande der Wüste vor dem Eingang zum Death Valley gibt es plötzlich diesen magischen Ort: ein langgestrecktes weißes Gebäude, das aussieht wie ein Kloster. Und auf ein Schild, und da steht: Armagosa Opera House. Wir sind natürlich reingegangen und haben erfahren, dass die Tänzerin Marta Beckett auf einer Tournee in den Sechzigerjahren diesen Ort entdeckte und beschloss, für immer zu bleiben. Seither lebt und tanzt sie dort. Auch ich wäre einfach gern dageblieben.
Dank der modernen Medien dringen Bilder aus der ganzen Welt täglich in unser Bewusstsein. Welche Bedeutung hat Reisen in diesen Zeiten?
Ich kann nur für mich sprechen, und ich behaupte: Reisen konkretisiert das Erleben und das, was wir Wirklichkeit nennen. Der Faktenschatz des omnipräsenten Internets hat mich irgendwann angestrengt und genervt. Es hilft, schlechte Hotels oder Restaurants zu vermeiden, aber manchmal hatte ich einfach das simple Bedürfnis, an einem ganz und gar »falschen Ort« zu landen. Mit dem Körper physisch wie psychisch etwas machen zu müssen und abends müde ins Bett zu fallen ist und bleibt nun mal eine andere Erfahrung, als das unbeschwerte Surfen auf digitalen Wellen.

Was geschieht mit Ihren Eindrücken – dürfen wir ein Buch erwarten?
Bei der abschließenden Podiumsdiskussion im Goethe-Institut New York brachte mir ein begeisterter Besucher ein amerikanisches Magazin mit, das die bekanntesten zwölf Reisebeschreibungen über die USA auflistete. Ilf und Petrow waren prominent vertreten; ein deutsches Buch war leider nicht dabei. Es würde mich reizen, einen literarischen Beitrag beizusteuern. Kein Remake von Ilf und Petrow, auch wenn mich ihre Art des Schauens und Sprechens sehr inspiriert hat. Vorher möchte ich allerdings mit meinen Begleitern Jana Müller und Alexej Meschtschanow ein Format erarbeiten, in dem wir Text und Bild produktiv verbinden.
Gibt es für Sie eine Quintessenz der Reise?
O ja! Sie liegt im Erlebnis der Technik. Für Ilf und Petrow spielten neben Brücken und Staudämmen Person und Wirken von Henry Ford eine besondere Rolle. Henry Ford wird in ihrem Buch als ein Konzernpatriarch ohne eigenes Büro beschrieben. Mehr Gegenwart geht gar nicht! Der Mann ist überall und nirgends, kann überall auftauchen, ist Held, Boss und Phantom in einer Person; genau darin besteht seine Macht. Für uns war es höchst interessant zu sehen, wie ungebrochen unkritisch der Antisemit von damals bis heute gefeiert wird.
Das Interview führten Christoph Mücher und Karin Oehlenschläger.
Quelle: www.3668ilfpetrow.com