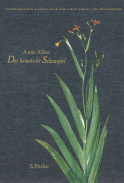
Mit Albus’ Augen
Die Autorentage Schwalenberg widmeten sich im Oktober 2013 dem Werk von Anita Albus. Julia Voss, Kunstredakteurin der Frankfurter Allgemeinen Zeitung sah 2007 erstmals eines der »gebetbuchkleinen« Originalgemälde von Anita Albus und ist überzeugt, dass nur die Tochter eines Chemikers sich Farben und Pigmente so zum Gestaltungsmittel machen kann, wie Albus es in ihren filigranen Kunstwerken tut. Was heißt es also, die Welt »mit Albus’ Augen« zu sehen?

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Anita Albus,
haben Sie vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier heute
sprechen zu dürfen. Im Programm ist mein Vortrag als »Rede« geführt. Ich will
dieser Rede nachträglich doch einen Titel geben. Worüber ich heute spreche, soll
die Überschrift tragen: »mit Albus’ Augen«. »Albus’ Augen«, das klingt wie
»Argusaugen«, und das ist natürlich Absicht. In der nächsten Dreiviertelstunde
werde ich mich zwei Fragen widmen:
1) Was heißt es, »mit Albus’ Augen« die Welt zu sehen? Dieser Blick wird
uns, den Betrachtern, dann ermöglicht, wenn wir die Gemälde von Anita
Albus ansehen. Und um den Gewinn, den wir daraus ziehen, soll es mir
gehen.
2) … möchte ich einen vergleichenden Blick auf das Umfeld werfen: auf die
Sonderstellung nämlich, die Anita Albus in der Gegenwartskunst
einnimmt. Wie lässt sich Anita Albus’ Werk in die Kunstgeschichte
einordnen? Wie verhält es sich zur Kunst der Gegenwart?
Argos, das ist in der griechischen Mythologie der hundertäugige Riese, von dem
Hera Zeus bewachen ließ. Argos hatte die Gabe, jeweils ein Auge schlafen zu
lassen, während die anderen weiterwachten. Diese Gabe hat etwas
Beängstigendes. Und meine Erfahrung ist, dass auch das Werk von Anita Albus
den Betrachter verängstigen kann – jedenfalls kurzzeitig. Mich verängstigte es,
als ich die ersten Originale sah. Es war gleichzeitig das erste Mal, dass ich Anita
Albus traf.
Lassen sie mich also mit dieser Anekdote beginnen: Es war im Frühjahr 2008,
ein nebliger, verregneter Tag in München. Ich hatte im Haus der Kunst gerade
eine Ausstellung mit abstrakten Bildern von Gerhard Richter besucht und lief
nun durch den Englischen Garten zu Anita Albus, mit der ich verabredet hatte,
sie zu Hause zu treffen, um ihre Bilder im Original sehen zu können. Endlich.
Bis dahin kannte ich ihre Arbeiten nur als Reproduktionen. Ihre Vogelbilder aus
dem Buch ›Von seltenen Vögeln‹, das 2005 erschienen war. Die Blumenbilder
aus ›Das botanische Schauspiel‹ von 2007. Bei der F.A.Z. arbeitete ich noch
nicht lange. Ein Jahr zuvor, im Frühjahr 2007, war ich zunächst als
Sachbuchredakteurin eingestellt worden. Im Herbst, als der damalige
Kunstredakteur die Zeitung verließ, fragte man mich, ob ich das Kunstressort
leiten wollte – zusammen mit meinem Kollegen Niklas Maak. Ich sagte ja. Einer
der ersten Termine, die ich vereinbarte, um eine Gegenwartskünstlerin oder einen
-künstler im Atelier zu besuchen, war das Treffen mit Anita Albus.
Sie öffnete die Tür. Wir bogen gleich in ihr Malzimmer ein. Wer Anita Albus in
ihrem Atelier in München besucht, sieht sofort, dass hier etwas Besonderes in
Vorbereitung sein muss. Nach der Haustür führt ein Flur in eine große
Altbauwohnung am Englischen Garten. Das Zimmer, in dem Anita Albus malt,
liegt am weitesten von dem Zimmer entfernt, in dem sie schreibt. Es gibt keinen
Fernseher, keinen Computer, die Wände sind bis auf wenige Bilder leer. In einem
Schrank stehen die Pigmente, mit denen Anita Albus selbst ihre Farben anmischt.
Auf dem Tisch stand eine Staffelei, darauf ein kleines Bild, nicht größer als ein
Gebetbuch. Es stimmt, wenn man sagt, dass Anita Albus sich mehr Zeit für die
Dinge nimmt, als wir es normalerweise heute tun. Anita Albus nimmt sich aber
nicht nur mehr Zeit als Menschen im einundzwanzigsten Jahrhundert, sondern
auch mehr als die meisten im achtzehnten, siebzehnten oder sechzehnten
Jahrhundert. Es gab jedoch zu allen Zeiten Künstler, die am Fließband
produzierten. Ich fragte sie, wie lange sie für ein Bild brauche. Sie antwortete:
»An diesem Bild habe ich zwei Jahre gemalt«. Es war der grün schillernde
Waldrapp, der auf dem Gemälde so groß wie eine Maus ist.
›Waldrappe in Weltlandschaft‹. Ich war erstaunt, wie klein es ist. Es hing nicht
an der Wand. Es war nicht verglast. Es stand auf dem Tisch. Und zum ersten Mal
sah ich mit eigenen Augen den Effekt, den kein Buchdruck wiedergeben kann.
Das dunkle Gefieder des Vogels leuchtet metallisch. Je nachdem von welcher
Seite man es ansieht, blitzen die Farben Grün oder Violett darin auf. Die Sonne,
das Licht, scheint auf seinem Kleid zu spielen. Was für ein perfektes Schauspiel,
auf so wenigen Zentimetern.
Was ist das Geheimnis? ›Waldrappe in Weltlandschaft‹ im Original zu sehen,
erfüllte mich mit großem Glück. Einerseits. Andererseits jagte mir, das muss ich
zugeben, das kleine Tier auch einen Schrecken ein. Ich verstand, dass jemand,
der in der Lage war, auf so kleinem Raum die merkwürdige Schönheit eines
Waldrapps unterzubringen, Dinge sieht, Details, die andere nicht sehen. Und
diese Einsicht förderte in mir eine Reihe alberner Gedanken zu Tage. Ich fühlte
mich beobachtet. Oder sagen wir so: Ich wusste, dass wenn es was an mir zu
beobachten gebe, es Anita Albus nicht entginge. Während ich das Bild ansah,
stellten sich also unwillkommene Fragen ein, die mich selbst betrafen. Ob ich
wohl was in den Zähnen hängen habe? Oder an der Nase? Ich hatte das Gefühl,
unter ein Vergrößerungsglas getreten zu sein, das Anita Albus auf die Welt
richtet. Das ist eine Eigenheit der »Albus’ Augen« – aber natürlich nicht ihr
Geheimnis.
Was ist das Geheimnis? Vor der Erfindung industriell hergestellter Farben hätte
man von einem »Werkstattgeheimnis« gesprochen. Denn Anita Albus – und
damit ist sie im zeitgenössischen Kunstbetrieb fast alleine – stellt ihre Farben
selbst her. Anita Albus ist nicht nur Malerin, sondern auch Erfinderin. Die Art,
wie sie malt, konnte sie nicht auf der Folkwangschule in Essen-Werden lernen,
wo sie von 1960 bis 1964 Grafik studierte; und die Farben, die sie verwendet,
kann sie noch immer in keinem Geschäft kaufen. Die Pigmente Bleiweiß,
Grünspan oder Pfirsichkernschwarz stellt sie selbst her. Sie mischt die Lösungen
und Emulsionen. Verleiht den Farben mit Honig oder Gummiarabicum
Geschmeidigkeit. Behandelt die Holz-, Kupfer- oder Leinwandoberflächen ihrer
Gemälde. Oder färbt das Papier für ihre Aquarelle ein.
Vielleicht ist es erhellend darauf hinzuweisen, dass »das Erfinden« in der Familie
von Anita Albus Tradition hat. Bereits ihr Vater war Chemiker. Der Großvater:
ein Chemiker. Der Urgroßvater: ebenfalls Chemiker. Der Urgroßvater war
außerdem ein Schüler und Assistent von Justus Liebig, dem Begründer der
modernen Lebensmittel- und Landwirtschaftschemie. Dieser Urgroßvater erfand
eine Nickellegierung, die er sich patentieren ließ.
Nach heutigem Verständnis wäre eine Tochter, die aus einem derart
naturwissenschaftlich geprägten Elternhaus kommt und Künstlerin wird, eine, die
der Familientradition den Rücken kehrt, um sich etwas anderem zuzuwenden.
Die spröde Naturwissenschaft hier, die schönen Künste dort. Das ist jedoch zu
modern gedacht. Wer die vormoderne Kunstgeschichte kennt, wird wissen, dass
es geradezu folgerichtig ist, wenn die Tochter eines Chemikers zu malen beginnt.
Denn bevor Farben in Tuben gekauft werden konnten, war jeder Maler auch
Chemiker. Und die besten Maler waren die besten Chemiker, weil sie wussten,
welches Pigment wie verarbeitet und aufgetragen werden musste, um das
Gemalte weich, samtig, glühend oder durchscheinend wirken zu lassen.
Ich kenne keinen Gegenwartskünstler, der sich mit der Wirkung und dem
chemischen Aufbau von Farben auch nur annähernd so eingehend beschäftigt hat
wie Anita Albus. 1997 erschien ihr Buch ›Die Kunst der Künste‹ mit dem
bezeichnenden Untertitel ›Erinnerungen an die Malerei‹. Das Buch besteht aus
Betrachtungen, Essays zu Werken von Malern und Malerinnen des fünfzehnten,
sechzehnten und siebzehnten Jahrhunderts. Die einzigen Abbildungen die aus
dem Industriezeitalter stammen, sind dem wissenschaftlichen Werk ›Das
Mineralreich in Bildern‹ von 1858 entnommen. Was dieses Buch für jeden
Kunsthistoriker zu einer Entdeckungsreise macht, ist, dass Anita Albus darin
nicht nur Kunstwerke interpretiert, ikonologisch ausdeutet und in ihre Zeit
einordnet. Das aufregende Abenteuer für den Leser besteht darin, dass die Art
und Weise, wie sie hergestellt wurden, erforscht und erklärt wird. Beispielsweise
versucht sie, das Rätsel zu lösen, wie es dem flämischen Maler Jan van Eyck
gelang, seinen Farben die vielgepriesene Tiefenwirkung zu verleihen. Und sie
gibt – wie kann es anders sein – die Antwort einer malenden Chemikerin: Es
seien »die konsequente Nutzung der optischen Wirkungen unterschiedlicher
Korngrößen« bei den Pigmenten und die »Sandwich-Anordnung« dreier
Farbschichten, die das Licht in die Tiefe des Bildes lockten, um es dort mehrfach
zu brechen. Dieses Kunststück vermag kein industrielles Pigment. Die Maschine
malt die Körner zu fein und gleichmäßig, die Farben wirken deshalb häufig flach,
teigig oder wie aus Plastik. Zu Recht vertraut Anita Albus den industriellen
Pigmenten nicht.
Es gibt also eine technische Seite des Geheimnisses. Es gibt natürlich aber auch
eine inhaltliche: die Frage, auf welche Dinge, welche Lebenswesen Anita Albus
ihre Augen und mit den Gemälden unsere Augen lenkt. Und für ihren Blick
bietet die schönsten und anschaulichsten Beispiele ›Das botanische Schauspiel‹.
Das Buch hat vierundzwanzig Kapitel, jedes Kapitel widmet sich einer
Blumenart. Es ist aber kein Feldführer. Es ist eine betörende Entdeckungsfahrt in
das Reich knapp unterhalb unserer Knie. Wir erleben das, was Literatur und
Kunst im besten Sinne leisten können: die Tür in eine andere Welt aufzustoßen.
Jede der vierundzwanzig Pflanzen in diesem Band wurde, wie der Titel
ankündigt, »nach dem Leben gemalt und beschrieben«. Nach dem Leben – das
ist eine tradierte Formel der naturhistorischen Buchillustration, mit der Zeichner
in der Vergangenheit die Authentizität der Überlieferung garantierten. Bei Alfred
Edmund Brehms Mitarbeitern für das ›Illustrirte Thierleben‹ hieß das im
neunzehnten Jahrhundert: Ich habe dieses Tier mit eigenen Augen gesehen und
nicht nach Vorlagen kopiert. Bei Anita Albus hat es dieselbe Bedeutung.
Denn genau dieser Mühe der Augenzeugenschaft hat sich Anita Albus
unterzogen. Ohne Vorzeichnungen wurde jede Blume mit dem Pinsel direkt auf
das Papier gesetzt, der weiße Aquarellpapiergrund zuvor mit Pigment eingefärbt.
Sechs Wochen brauchte sie allein um Meconopsis betonicifolia Franch. zu
malen, eine blau blühende Mohnpflanze, deren Blätter in der Vase sich innerhalb
von fünf Minuten in »verkohlte Lappen« verwandeln. Vor allem aber hat Albus
jede Pflanze aus einem Samen in ihrem Garten in München oder bei Dijon
gezogen. Wer ihr vorangegangenes Buch ›Von seltenen Vögel‹ gelesen hat, wird
sich vielleicht noch an das Ornithologenehepaar Oskar und Magdalena Heinroth
erinnern. Die Heinroths schufen in den zwanziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts das Monumentalwerk ›Die Vögel Mitteleuropas‹. Dafür päppelten
sie – auf den Fensterbrettern, Bücherbords und Abstelltischchen ihrer Berliner
Wohnung – sämtliche von ihnen beschriebenen Tiere von Hand auf. Die gleiche
Vorgehensweise erlaubt es Albus, jeder Blume auch eine praktische Anleitung
beizugeben, wie sie im Garten zu halten sei. Sie kennt ihre Empfindlichkeiten.
Die eine verlangt mit einem Karton vor Spätfrost geschützt zu werden, die andere
verabscheut kalkhaltiges Wasser, weshalb man sie nicht mit Leitungswasser
gießen darf.
Es sind nicht die ins Auge stechenden, großen fleischigen Prachtblumen der
Tropen oder Gewächshäuser, die uns Albus näherbringt, sondern kleine Pflanzen.
Zwischen Kieseln in Kaschmir blühend oder auf den sandigen Hochplateaus
Mexikos haben diese Blumen eine beharrliche Eigenständigkeit entwickelt, die
sie auch in unseren Gärten weiter behaupten. Es sind seltene und zarte
Organismen, deren Samen häufig aus entlegenen Regionen stammen und die
Anita Albus in ihrem Garten aufzog, um sie malen zu können. Mit den feinsten
Pinseln registriert sie jedes Fältchen auf den Blättern, die ersten braunen Adern
im Blütenblatt, die davon zeugen, dass es bald verwelken wird. Von
Naturalismus zu sprechen wäre falsch. Die Wirklichkeit, die Natur, ist viel
weniger eindeutig, als der Begriff vortäuscht. Nicht jeder, der eine Pflanze
betrachtet, würde sehen, was Anita Albus sieht. Aber wer ihre Bilder sieht, erhält
die Chance, eine Pflanze mit solchen Augen zu sehen.
Zu den größten Bewunderern von Anita Albus’ Kunst zählte Claude LéviStrauss, der
französische Ethnologe und Anthropologe. In den Bildern von Anita
Albus, schreibt Claude Lévi-Strauss, »sehen wir die Dinge auf eine Weise, die
wir verlernt oder vergessen hatten«. Dem hundertjährigen Forscher, der in
Frankreich in der Nähe von Anita Albus wohnte, zeigte Anita Albus vor wenigen
Jahren ihr neuestes Studienobjekt: den Isabellaspinner. Er ist der vielleicht
schönste Schmetterling Europas aus der Familie der Pfauenspinner. Er lebt in den
Kiefernwäldern der Pyrenäen. Als ich Anita Albus zum ersten Mal traf, zeigte sie
mir ein Exemplar des Isabellaspinners und erzählte mir von ihrer Absicht, ihn
malen zu wollen. Als ich sie, mehr als vier Jahre später, in Frankreich besuchte,
zeigte sie mir das fast fertige Gemälde. Nach den Blumen und Vögeln scheint es
naheliegend, sich auch den Insekten zu widmen. Das geplante nächste Buch über
Insekten ist aber nicht nur die Fortführung eines Projekts, sondern die größte
Herausforderung an die Malerei, der sich Anita Albus in ihrem Werk stellt.
Worin besteht diese Herausforderung? Was Malerei bedeutet, erklärte Anita
Albus 1997 in dem bereits zitierten Werk ›Die Kunst der Künste. Erinnerungen
an die Malerei‹ anhand der Pigmente des Schmetterlings. Sie schrieb: »Die
prächtigen Farben der Schmetterlinge verdanken sich einem in Schichten
aufgebauten System, in dem das Zusammenspiel von Farbstoff und
unterschiedlicher physikalischer Struktur der Schuppen irisierende Wirkungen
erzeugt. Dieses Verfahren haben die Maler der Natur einst nachgeahmt. Sie
hatten die Metalle, Mineralien, Erden, Pflanzen, Hölzer, Knochen, Läuse,
Muscheln und Schnecken vor Augen, und der Prozess ihrer Verwandlung in
Pigmente war ihnen vertraut.« Jedes Pigment unterscheidet sich nicht nur der
Farbe nach, sondern in seiner Struktur. Es besitzt einen Körper, der das Licht auf
unterschiedliche Weise bricht, zurückwirft und schluckt. Die neuen synthetischen
Pigmente haben eine homogene Struktur. Naturpigmente dagegen, wie das
kostbare Ultramarin, verfügen über Einsprengsel anderer Kristalle, etwa Calcit,
Pyrit oder Quarz, die als flimmerndes Firmament erscheinen. Mit diesen
Pigmenten bauten die Alten Meister der Stillebenmalerei die Natur nach.
Was heißt es, die Wirkung der Farben »nachzubauen«? In der Malerei gibt es,
grob gesprochen, zwei Arten, Lichteffekte zu produzieren. Die Unterscheidung
ist einfach – auch für den Laien. Die eine besteht darin, mit Hell- und
Dunkelkontrasten Glanzlichter und Schatten nachzuahmen, so dass das Auge
getäuscht wird und die dreidimensionale Wirkung eintritt. Der Effekt, der Spuk,
wenn man so will, hört auf, wenn man nahe an das Bild herantritt. Das Bild fällt
dann wieder in Farbflächen auseinander. Die optische Täuschung, das trompe
l’œil, verschwindet. Etwas völlig anderes ist es dagegen, Pigmente wie
geologische Schichten aufzutragen, so dass sich das Licht, wenn es die Ebenen
durchwandert, mehrfach bricht und damit die Farben strahlen lässt.
Schmetterlingsflügel, Vogelfedern bringt dieses Prinzip in der Natur zum
Leuchten – in der Kunst die Gemälde von Anita Albus. Es geht also um mehr, als
einen Effekt zu produzieren. Anita Albus’ Malerei gleicht sich der Methode an,
die in der Natur die Gegenstände hervorbringt, die sie festhält. Die alte Technik
der Malerei lehrt dabei, auch heute Strukturen zu sehen, die ein Kameraauge
nicht erkennt. ›Der Flügel des Isabellaspinners‹, sagte Anita Albus bei unserem
ersten Treffen, indem sie auf den Isabellaspinner zeigte, »ist durchsichtig und mit
einem feinen Pelz überzogen«. Dass etwas pelzig und durchsichtig zugleich ist,
würde man ausschließen, wenn man es nicht sähe.
Dass Anita Albus ihre Kunst auf keiner Hochschule, keiner Akademie lernen
konnte, habe ich bereits gesagt. Dass es nicht schaden kann, als Autodidaktin aus
einer Chemiker-Familie zu kommen, habe ich ebenfalls angesprochen. Wie aber
lehrt man sich aber selbst das Malen? An welchen Meistern schult man sich?
Wer sind die Vorbilder? Zu den Eigenheiten von Anita Albus Werk gehört, dass
sie ihre Gemälde zuerst in Büchern veröffentlichte. In Büchern für Kinder.
Eines davon ist das Kinderbilderbuch ›Der Himmel ist mein Hut, die Erde ist
mein Schuh‹ von 1973. Die Bilder stammen von Anita Albus, die Texte
schrieben Kinder. Ein Bild zeigte einen weißen Ozeandampfer, der in einen
dunkelgrünen Wald einfährt. Ein neunjähriges Mädchen dachte sich dazu die
Geschichte von dem Schiff aus, dem es langweilig wird, immer bloß Wasser zu
sehen. »Es wollte nicht immer die vielen Menschen, Tiere und Kisten über das
Wasser tragen.« Also fuhr es in den Wald. In dem Wald, den Albus dem Schiff
schenkte, blühten rot der Fingerhut, weiß die Walderdbeere und gelb die
Anemone. Die Blumen hat Anita Albus seitdem nicht mehr aus den Augen
gelassen.
Ein anderes Bild trägt den Titel ›Der Waldboden‹. Es zeigt ein dicht
bewachsenes Waldstück, durchzogen von Baumwurzeln, Pilzen und Moos. Eine
Kröte versteckt sich hinter Gräsern, eine Schlange schiebt sich über Pilze.
Spätestens hier zeigt sich, wie ausdauernd Anita Albus ihre Interessen verfolgt.
1973 veröffentlichte sie ›Der Himmel ist mein Hut, die Erde ist mein Schuh‹.
1997, mehr als fünfundzwanzig Jahre später, ›Die Kunst der Künste‹. Einer der
Maler, dessen Werk Anita Albus darin behandelt, ist Otto Marseus von Schrieck.
Und dort, im vierten Kapitel des dritten Teils, begegnet der Leser einem
Wiedergänger. Es ist dieselbe Schlange, die sich in dem Kinderbuch zwischen
Pilzen hindurchschiebt, die der holländische Stilllebenmaler Otto Marseus van
Schrieck 1662 durch das Unterholz schickte. Das Bild hängt heute nicht weit von
hier: im Herzog-Anton-Ulrich Museum in Braunschweig.
Anita Albus schulte sich an den Alten Meistern. Hätte sie sich darauf beschränkt,
mit immer vollkommeneren Techniken die Werke Alter Meister nachzuahmen,
wäre sie in eine Sackgasse geraten. Alte Techniken, alte Traditionen sind meiner
Ansicht nach kein Wert an sich. Und es ist, meiner Ansicht nach, auch kein Wert
an sich, aus der Zeit zu fallen. Niemand muss gepuderte Perücken tragen, nur
weil diese mit Beginn des modernen Zeitalters aus der Mode gerieten. Und
niemand – mit Ausnahme des Restaurators – muss eine kunstvolle Technik am
Leben halten, wenn diese uns heute nichts mehr sagt. Aber eben diesen
Gegenbeweis liefert uns Anita Albus: In ihren frühen Gemälden ahmte sie nicht
nach, sondern schulte sich an den Alten Meistern. Sie lernte zu sehen, wie die
Stillebenmaler sehen konnten. Stillebenmalerei war kein Selbstzweck.
Stillebenmalerei war ein Entdeckerwettbewerb, ein Überbietungsgefecht. Die
Künstler übertrafen sich in der Genauigkeit der Beobachtung, sie sahen
Phänomene, Dinge, Details, die dem ungeschulten Auge entgehen. Die Borste
eines Fliegenbeins oder die durchsichtigen Gefäße einiger Pflanzen; die
Lichtspiegelung in einem Glas, die glitschige Fäulnis eines verwesenden Pilzes.
Und um diese Entdeckungen mitzuteilen, erfanden die Maler ihre erstaunlichen
Techniken.
Es ist eine Binsenweisheit, dass wir nur denken können, wofür wir Namen,
Wörter, Begriffe haben. Wir können aber auch nur sehen, wofür wir Pigmente,
Farben und Formen haben. Wir sehen die Welt, indem wir sie abbilden. Bis heute
kann es keine Fotografie mit der Kunst der Stillebenmalerei aufnehmen.
Und damit komme ich zu meiner zweiten Frage. Wie verhält sich Anita Albus‘
Werk zur Gegenwartskunst? Man kann die Frage auch umkehren und zuspitzen:
Warum tut sich die Gegenwartskunst mit Anita Albus so schwer?
Das Unverständnis, auf das ihre Werke häufig im zeitgenössischen Kunstbetrieb
stoßen, hat sie selbst als lustige Begebenheit in ›Das botanische Schauspiel‹
erzählt. Einen einzigen Winter lang arbeitete sie an der Münchner Akademie der
Bildenden Künste, in einem Atelier, das ihr Daniel Spoerri abgetreten hatte.
Daniel Spoerri, 1930 in Rumänien geboren, ist ein Schweizer Künstler, der 1960
die Gruppe Nouveau Réalisme mitbegründete, der auch Jean Tinguely und Yves
Klein angehörten. Berühmt wurde Spoerri außerdem für seine Eat-Art-Bankette,
große Festgelage, bei denen am Ende die Überreste auf den Tischen fixiert
wurden, die Teller, Gläser, Bestecke, aber auch die Flecken, Krümel und Saucen.
Die so entstandenen Assemblagen wiederum wurden zu Kunstwerken erklärt.
Jener Daniel Spoerri trat also ein Atelier an der Münchner Akademie für
Bildende Künste an Anita Albus ab, nachdem bei ihr zu Hause eine Stuckdecke
herabgestürzt war und die Wohnung renoviert werden musste. Spoerri, der als
Professor in München lehrte, besaß zwei Ateliers. Die Studenten, die in diesem
Winter nach Spoerri suchten und Albus fanden, waren schockiert. Es waren die
achtziger Jahre, Anita Albus arbeitete gerade an einem Buch über seltene
Blumen, eben ›Das botanische Schauspiel‹, das 2007 in zweiter, erweiterter
Auflage erschien. »Ich hätte«, schreibt sie, »ihnen gern von dem großen
Konzeptkünstler Linnaeus in Uppsala und seiner Blumenuhr erzählt, aber sie
hätten darin wohl nur ein weiteres Indiz dafür gesehen, dass ich nicht
zurechnungsfähig war.«
Woher kommt dieses Unverständnis? Wie kommt es, dass in der
Gegenwartskunst alles erlaubt scheint – außer Blumen oder Vögel in der
meisterlichen Manier von Anita Albus zu malen? Ich möchte daher abschließend
auf zwei folgenreiche Missverständnisse zu sprechen kommen, die, wie ich
glaube, den zeitgenössischen Kunstbetrieb prägen und zu dessen
selbstverschuldeter Monotonie geführt haben.
Das erste Missverständnis könnte man auch ein Fortschrittsmärchen nennen, das
sich mit Blick auf die Malerei erstaunlich hartnäckig hält. Es gibt Märchen, die
so oft wiederholt werden, bis wir anfangen, sie zu glauben, und eines der größten
Märchen des Medienzeitalters ist das vom technischen Fortschritt. Seit der
Renaissance, so die Erzählung, habe der Mensch immer neue Apparate erfunden,
um besser, weiter, schneller oder tiefer zu sehen, das Fernrohr, das Mikroskop,
den Fotoapparat, die Digitalkamera. Was Künstler wie Albrecht Dürer oder
Maria Sybilla Merian noch mit dem bloßen Auge studierten und mit Pinsel und
Farbe zu Papier brachten, zeichnen, so der Glaube, die neuen Medien heute viel
genauer auf, ein Rasenstück, ein Insekt, eine Blume. Und weil wir glauben, dass
die neuen Medien die alten überflüssig gemacht haben, scheint auf den ersten
Blick eben ein Künstler, der heute noch im altmeisterlichen Stil zeichnet und
malt, wie jemand, der mit der Kutsche ins Büro fährt. Wie jemand also, der die
Dinge unnötig kompliziert macht.
In Anita Albus’ Münchner Arbeitszimmer hängt ein Stich von Maria Sybilla
Merian, der Malerin und Kupferstecherin, die 1699 mit ihrer Tochter von
Amsterdam ins südamerikanische Surinam reiste, um die Insekten und Pflanzen
der Tropen zu malen. Albus besitzt darüber hinaus eine umfangreiche
naturkundliche Bibliothek. Die Werke stoßen die Tür in eine andere
Kunstgeschichte auf. Eine, in der es keine Stilgeschichte gibt und keine Epochen.
Es ist eine Kunstgeschichte, die nur wenige kennen.
Die naturhistorische Buchillustration ist eine Abfolge von Einzelgängern,
Außenseitern und Autodidakten. Während die große Kunstgeschichte sich in der
einzelgängerischen Pose gefällt, aber in Wirklichkeit Schulen bildete und
Akademien gründete, waren die naturhistorischen Zeichner tatsächlich Solitäre.
Es gab keinen Ausbildungsweg, keine Schule, keine Lehrer, keine Anleitung, wie
man einen Käfer porträtiert, einen Vogel oder eine Blume. Die Naturhistoriker
fingen immer wieder neu an. Die Werke der häufig als Gebrauchsgrafiker
unterschätzten Künstler sind treffend und seltsam zugleich, sie sind oft schwer zu
datieren, weil sie keinem Stil folgen, keiner Strömung. Sie sind schon immer aus
der Zeit gefallen. Ihr Maßstab ist die Frage, die sie an die Natur stellen, der
Blick, den sie auf sie richten. Es gibt Phänomene, die nur Maschinen aufzeichnen
können: Ein menschliches Auge ist kein Röntgenapparat, kein
Elektronenmikroskop. Ohne Hilfsmittel können wir nicht Infrarotsehen, eine
Fähigkeit, die viele Tiere besitzen. Wenn wir allerdings die Gemälde von Anita
Albus betrachten, werden wir zugeben müssen, dass sie etwas können, das keine
Maschine kann. Die Federn weiter, auch in der Abbildung, aus unterschiedlichen
Blickwinkeln schillern zu lassen. Gleichzeitig das durchscheinende Gefäß einer
Pflanze aufzuzeigen und die weiche Oberfläche ihrer Blätter. Den Teich des
kleinen Eisvogels leuchten zu lassen. Ich hatte anfangs über die Bedeutung der
alten Pigmente gesprochen. Es sind Wirkungen, die kein Fotoapparat herstellen
kann. Und darum sollten wir die Fortschrittsgeschichte verabschieden. In der
Malerei sind die alten Medien nie überflüssig geworden. Zu glauben, sie seien es,
ist das eine Missverständnis.
Das andere Missverständnis ist ein ideologisches. Ich habe Ihnen zum Schluss
meines Vortrags ein Kinderbuch mitgebracht. Es trägt den Titel ›Irgendwie
Anders‹. Und der Grund, warum ich es hier zeigen möchte, ist, dass es darin eine
Szene gibt, in der es um Malerei geht.
Seit ich Anita Albus 2008 das erste Mal persönlich traf, hat sie den
Isabellaspinner gemalt. Ich habe in der Zwischenzeit zwei Kinder bekommen und
geheiratet – und bin dadurch zur Vorleserin geworden, zur Vorleserin von
Kinderbüchern. Natürlich lesen wir häufig und mit großem Vergnügen ›Der
Himmel ist mein Hut, die Erde ist mein Schuh‹ von Anita Albus. Unsere
Bibliothek erweitert sich fast monatlich. Viele Bücher werden uns geschenkt.
Darunter kürzlich ›Irgendwie Anders‹.
Die Geschichte ist schnell erzählt: ›Irgendwie Anders‹ handelt von dem kleinen
Wesen, das sie hier im gelben Sessel sitzen sehen. Es trägt den Namen Irgendwie
Anders. Irgendwie Anders ist einsam und hat keine Freunde, eben deshalb, weil
er anders ist, auch wenn er sich redlich bemüht, wie alle zu sein. Eines Tages
trifft er dann ein anderes Wesen, das auch anders ist, noch einmal auf eine ganz
andere Weise als Irgendwie Anders. Sie freunden sich an – und alles wird gut.
Das Buch wurde 1994 auf Englisch veröffentlicht. Die Autorin ist eine
Engländerin. Der Illustrator ist Südafrikaner und außerdem ein Karikaturist der
liberalen britischen Wochenzeitung ›The Observer‹. Das Buch schließ an eine
Kinderbuchtradition an, die nach dem Zweiten Weltkrieg ihre größten Erfolge
feierte: Im Mittelpunkt steht ein Außenseiter, der sich nicht einfügt und der
deshalb ausgegrenzt wird. Die Geschichte wirbt für diesen Außenseiter, er ist der
eigentliche Held, das Vorbild für unsere Kinder.
Ich möchte daran erinnern, dass das erste Kinderbuch, das im westlichen Sektor
nach 1945 gedruckt wurde, ›Ferdinand, der Stier‹ war. Es ist die Geschichte eines
kleinen Stiers, der nicht kämpfen möchte und lieber an Blumen schnuppert. Es
war natürlich eine politische Parabel, eine Gegengeschichte, die ein neues
Denken für die Kinder öffnen sollte – jenseits des martialischen Weltbildes, das
ihnen der Nationalsozialismus eingetrichtert hatte. In dieser Tradition erschienen
zahlreiche weitere Bücher: Michael Endes ›Jim Knopf‹ ist beispielsweise auch
eine solche Gegengeschichte. ›Irgendwie Anders‹ steht also in der Tradition
dieser politisch-aufklärerischen Bücher. Und tatsächlich wurde es mit UNESCOPreis für Kinder- und Jugendliteratur im Dienst der Toleranz ausgezeichnet.
Jetzt aber zu der Szene, die uns hier interessieren soll: Die Szene, in der
Irgendwie Anders malt. Irgendwie Anders malt abstrakt. Seine angepassten
Spielkameraden dagegen, die dieselben Markenturnschuhe tragen und auch sonst
zur Uniformität neigen – malen gegenständlich. Eine Landschaft. Und einen
Sessel mit Sonnenschirm. Das hier ist ein Kinderbuch, aber es bringt das
zeitgenössische Kunstverständnis verblüffend – wenn auch unbeabsichtigt – auf
den Punkt. Überspitzt formuliert sagt diese Szene: Die Fortschrittlichen, die
Guten, die Kreativen malen abstrakt, ungegenständlich, mit tropfendem Pinsel.
Das Penible, die Naturdarstellung dagegen befindet sich auf der Seite der
geistlosen, engstirnigen Kopisten. Kurzum: Hier werden Stile und Formen
moralisch aufgeladen. Sie stehen plötzlich für Weltanschauungen.
Meine Pointe lautet: Genau diese Verknüpfung von Stil und Weltanschauung ist
ebenfalls ein Erbe aus der Zeit nach 1945. Was die Außenseitergeschichten für
die Kinder waren, war die Rehabilitation der Moderne, der Avantgarden für die
Erwachsenen. Die größten Museumssammlungen moderner Kunst wurden nach
dem Zweiten Weltkrieg zusammengekauft. Die häufigsten Ausstellungen zu
moderner Kunst fanden in den fünfziger Jahren statt, von der Biennale in
Venedig bis zur Documenta in Kassel. Man wollte, was die Nationalsozialisten
verfemt hatten, nun feiern. Die Kunstgeschichte sollte auf den Kopf gestellt
werden. Aus der ehemals »entarteten« Kunst wurde der Inbegriff der Kunst.
An der Rehabilitierung der Moderne will niemand rütteln. Sie war richtig und
gut. Allerdings ist es ein Missverständnis zu glauben, die Nationalsozialisten
hätten zuvor Stilpolitik betrieben. Die Nationalsozialisten betrieben Terror,
Rassenpolitik und Eugenik – auch im Kunstbetrieb. Es stimmt, dass sie
zahlreiche Künstler verfolgten, die modern malten. Es stimmt aber auch, dass die
Nationalsozialisten zahlreiche Künstler verfolgten und ermordeten, die
akademisch oder naturalistisch malten. Diese Künstler sind in der Nachkriegszeit
in Vergessenheit geraten. An sie wurde nicht erinnert. Sie fielen durch das
Raster.
Zwei davon will ich kurz ins Gedächtnis rufen: Zu den betörendsten
Wiederentdeckungen der letzten Jahre zählt für mich der malende Pfarrer
Korbinian Aigner, der fast tausend Äpfel und Birnen malte und nur knapp den
Nationalsozialismus im Konzentrationslager Dachau überlebte. Seine Bilder
wurden auf der letzten Documenta in Kassel gezeigt. Die Schriftstellerin Judith
Schalansky hat sie kürzlich bei Matthes und Seitz vollständig in einem Buch
herausgegeben.
Zu den Wiederentdeckungen der letzten Jahre zählt auch Lotte Laserstein. Sie
war eine jüdische Malerin, akademisch ausgebildet, die technische Perfektion
zählte zu ihrem Selbstverständnis. Lotte Laserstein konnte sich und ihr Werk
retten, indem sie nach Schweden 1937 floh. Im gleichen Jahr wurde ein Werk
von ihr als »entartet« beschlagnahmt. Laserstein blieb ihr Leben lang eine
akademische, naturalistische Malerin. Das Jüdische Museum in Frankfurt wird
im November 2013 bedeutende Werke von ihr zeigen.
Was will ich damit sagen? Bis heute steht eine Kunst, die formal alte Traditionen
aufgreift, unter Verdacht. Man unterstellt ihr, weltanschaulich auf der falschen
Seite zu stehen. Man glaubt leichtfertig, sie sei überflüssig. Man verdächtigt sie,
eine Pose zu sein, eine reaktionäre noch dazu. Diese Verwechslung von Stil und
Weltanschauung, das war mein Punkt, ist ein Erbe der Nachkriegszeit. Bis heute
durchzieht ein tiefer Graben das Kunstverständnis. Ich hoffe, dass dieser Graben
überwunden werden kann. Es gibt gute, ja hervorragende Malerei, die in einer
alten Tradition steht. Und es gibt schlechte. So wie es gute Kunst gibt, die in der
Tradition der Avantgarden steht, und schlechte.
Wer vor fünfzig Jahren Joseph Beuys nicht ausstellen wollte, den würde man
heute für borniert halten – zu Recht. Nur haben sich die Zeiten geändert. Kein
Museumsdirektor lacht heute über die Fettecke. Die neue Borniertheit besteht
darin, ein Pflanzenstillleben zu verachten. Der Preis ist die selbstverschuldete
Monotonie des zeitgenössischen Ausstellungsbetriebs.
Ich danke Dir, Anita, für Deine Albusaugen.
© Julia Voss
