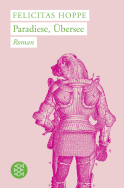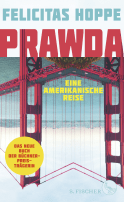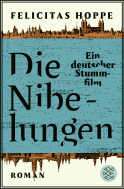
»Nach wie vor siegt die Einbildungskraft«
Felicitas Hoppe hat den Erich Kästner Preis für Literatur verliehen bekommen. In ihrer Dankesrede spürt sie Erich Kästner nach, und Sven Hanuschek zieht in seiner Laudatio Parallelen zwischen den Werken des Schriftstellers und der Schriftstellerin.

Danksagung zur Verleihung des Erich Kästner Preises
München, den 30.10.2015 auf Schloss Blutenburg
Sehr geehrte Damen und Herren der Erich Kästner Gesellschaft, verehrte Jury, liebe Frau Raabe, lieber Herr Hanuschek, lieber Herr Pellegrino, liebe Freunde der Internationalen Kinder- und Jugendbibliothek, liebe Stadt München, lieber Fischerverlag, liebe Freundinnen, Freunde und Gäste!
»Sie haben mir für dieses Jahr den Erich Kästner Preis für Literatur zuerkannt, und es handelt sich für mich um mehr als einen zeremoniellen Akt, dass ich mich nun, von hier aus, für die hohe literarische Auszeichnung bedanken darf. Ich bin Ihnen Dank schuldig, und möchte ihn nicht schuldig bleiben. Dieser Wunsch drängt über die gezirkelten Grenzen gemessener Förmlichkeit und angemessener Feierlichkeit hinaus. (...) Und so lassen Sie mich sagen: Ich danke Ihnen von Herzen, weil ich mich von Herzen freue.
Freilich, auch der Freudenhimmel hat seine Wolken, und nicht alle ziehen spurlos vorüber. Schon, dass die Auszeichnung in Gedenken an einen genialen Schriftsteller verliehen wird, wirft einen Schatten auf die helle Stunde. Und die Vermutung, dass wohl niemand kongenial und würdig genug wäre, ist ein schwacher Trost. Doch ich weiß mir keinen besseren. Denn wenn es nur nach Wert und Größe ginge, dann gäbe es nicht nur keine Ehre, dann gäbe es keine Kunst mehr. Dann müssten wir unsere Bleistifte verbrennen und unsere Schreibmaschinen aus dem Fenster werfen. Dann hätte sogar Kästner seine Federkiele zerbrechen müssen. Denn er kannte Shakespeare, und er kannte Büchner.
Und wir sind noch viel ärger dran. Denn wir kennen nicht nur Shakespeare und Büchner, sondern auch Kästner. Die Wissenschaften mögen, vielleicht, mit ihren Resultaten, Formeln und Hypothesen stufenweise vorankommen, aber der Weg der Künste geht nicht treppauf. Ihre Geschichte hat mit dem Wort »Fortschritt« nichts zu schaffen. Trotzdem bleiben wir, ob nun übermütig, naiv oder verzweifelt, an der Arbeit, als gelte es das Leben. Und es gilt ja auch das Leben, unser Leben, und wir haben nur das eine! Nur so ist Literatur möglich. So auch nur mögen Auszeichnungen gelten.«
Sie werden längst gemerkt haben, dass ich mich bis hierher, aus reiner Verlegenheit, nicht in meinen eigenen, sondern mit den Worten Erich Kästners bedankt habe; ich habe sie wortwörtlich seiner Dankesrede entliehen, die er anlässlich der Verleihung des Büchnerpreises im Jahr 1957 vor der Deutschen Akademie in Darmstadt hielt. Beim Wiederlesen der Rede schien mir, er sei damals nicht weniger eingeschüchtert gewesen als ich, die ich den Preis 55 Jahre später erhielt.
Drei Jahre später darf ich endlich aufatmen. Denn die Verleihung des Erich Kästner Literaturpreises hat mich auf so unerwartete wie glückliche Weise von der Last des Büchnerpreises befreit. Nicht weil die Verpflichtung geringer wäre – sie wiegt sogar schwerer – aber sie trägt sich leichter, spielerischer, vertrauter; weil sie mit meiner Kindheit verbunden ist. Und mit einer Stadt, in der ich inzwischen seit dreißig Jahren lebe und die mich tagtäglich, buchstäblich wie praktisch, immer wieder auf Kästners Spuren führt.
Vor zehn Jahren bin ich nämlich, nach vermutlich nicht weniger innerstädtischen Umzügen als Kästner, in Berlin Mitte gelandet, unweit der Friedrichstraße und der Weidendammer Brücke, deren Berühmtheit wir ›Anton und Pünktchen‹ verdanken; Tür an Tür neben dem Deutschen Theater, um genauer zu sein: im zweiten Stock der Schumannstraße 15, wo, über viele Jahre lang, in einem winzigen Kellerlokal namens ›EMIL‹, das einmal den glanzvollen Namen ›Zur Goldenen Fünfzehn‹ trug, zwischen den Gläsern auf dem Regal hinter der Theke der Zweitschlüssel zu meiner Wohnung lag.
Im ›EMIL‹ spielten, zwischen Glasvitrinen voller Kästner-Devotionalien, stark rauchende ältere Damen kämpferisch Skat, während an der Theke stark alternde politisierende Männer saßen. Meine Vormieterin, eine Astrologin, überließ mir die Wohnung zwei Stockwerke drüber mit dem freundlichen Hinweis, dies sei für mich (eine Schriftstellerin, wie sie gehört haben wollte) genau der richtige Ort. Denn hier habe der große Kästner persönlich gewohnt und seinen berühmten ›EMIL‹ geschrieben, während er tagsüber seine Brötchen am Theater verdiente.
Ob und wie lange Kästner tatsächlich in der Schumannstraße 15 wohnte, ist bis heute umstritten. Eine verlässliche Tafel am Haus, die das gesichert behördlich bestätigen könnte, ist nirgends zu finden. Aber wenn ich im Sommer, bei offenem Fenster, in meinem Arbeitszimmer nach vorne raus sitze, lausche ich gern den literarischen Führern, die ihre Kundschaft auf Rädern durch den Bezirk eskortieren und den Gästen wortreich erklären, warum dieser Ort ein historischer sei: »In diesem Haus«, sagt die Stimme des radelnden Reiseführers, »in diesem Haus haben Albert Lortzing und Erich Kästner gewohnt!« Lauter einfache hohe Leute: Emil, der Zar und der Zimmermann.
Und Hoppe, füge ich leise hinzu, aber ich lehne mich nicht aus dem Fenster, denn noch bin ich am Leben. Nach wie vor siegt die Einbildungskraft. Denn, wie man bei Kästner und Hanuschek nachlesen kann, haben weder Lortzing noch Hoppe der ›Goldenen Fünfzehn‹ Glanz verliehen, sondern Pony Hütchen, Kusine Emils und Tochter der Heimbolds im dritten Stock, ich zitiere: »Das Auto hielt. Es war Schumannstraße 15. ›Na, da wären wir ja‹, sagte Emil (...), stieg in die dritte Etage und klingelte bei Heimbolds. Es entstand großes Geschrei hinter der Tür. Dann wurde geöffnet. Und die Großmutter stand da, kriegte Emil beim Wickel, gab ihm gleichzeitig einen Kuss auf die linke Backe und einen Klaps auf die rechte, schleppte ihn an den Haaren in die Wohnung und rief: ›O du verflixter Halunke!‹ (...) ›Hast du die Pinke?‹, fragte Pony Hütchen. ›Klar‹, meinte Emil. (...) Nach dem Essen liefen Emil und Hütchen ein bisschen auf die Straße, weil der Junge Ponys kleines, vernickeltes Rad probieren wollte. Großmutter legte sich aufs Sofa. Und Tante Martha buk einen Apfelkuchen. (...) Emil radelte durch die Schumannstraße. Und Hütchen rannte hinter ihm her, hielt den Sattel fest und behauptete, das sei nötig, sonst fliege der Vetter hin. (...) Da kam ein Polizist auf sie zu, der eine Mappe trug, und fragte: ›Kinder, hier in der Schumannstraße 15 wohnt doch die Hoppe?‹ ›Jawohl‹, sagte Pony, ›das bin ich. Einen Moment, Herr Major.‹ ›Ist es etwas Schlimmes?‹, erkundigte sich Emil. (...)«
Ganz im Gegenteil. Denn der Major bringt die Nachricht vom Kästnerpreis, den ich heute, am 30. Oktober 2015 entgegennehme; dem Weltspartag übrigens, der mich gleichfalls an meine Kindheit erinnert und an die fleißigen Kleinsparer Loriots, in dessen Fußstapfen ich heute gleichfalls trete. Was übrigens die Ernte, das Geld betrifft, so spielt es im ›Emil‹ keine geringe Rolle: »(...) ›Geld soll man immer nur per Postanweisung schicken‹, brummte die Großmutter und kicherte wie eine Spieldose. ›Hurra!‹, rief Pony Hütchen und ritt auf ihrem Stuhl ins Schlafzimmer. (...)«
Apropos Schlafzimmer: Die wichtigen Bücher, Büchner und Co, stehen bekanntlich im Vorderhaus, mit Blick auf die Straße; die entscheidenden liegen allerdings auf der Fensterbank unserer Schlafzimmer, meistens zum Hinterhof raus; es sind nach wie vor jene Bücher der Kindheit, die gegen die Schlaflosigkeit helfen, die man hoffnungsvoll unter die Kissen legt; wie ›Eine Jugend in Berlin‹ von Günter de Bruyn, den der verfilmte Kästner bis heute begleitet:
»Zum ersten Mal erlebte ich es hier, dass mich die Kunst in eine Welt der Ideale führte, die, anders als Märchen, meiner Umwelt täuschend ähnlich war und also als real vorhanden denkbar blieb: in eine Welt der Solidarität, der Güte und der hilfsbereiten Menge, die das Böse durch Vereinigung der vielen schwachen Einzelnen zur Strecke bringt. Das Bild der Kinderscharen, die sich um den Schuft mit der Melone drängen, ihn am Fliehen hindern und damit zu beweisen scheinen, dass geballte Güte stärker sein kann als Gewalt, blieb mir als Bild der Sehnsucht stets erhalten, doch als Symbol der getäuschten Hoffnung auch. So stark war dieser Eindruck mit sechs Jahren, dass ich mit zwanzig noch, als Dorfschullehrer, meiner Klasse die gesamte Handlung nacherzählen konnte, obwohl das Buch von Kästner mir erst später in die Hände kam. Den Jubel, der das Happy-End begleitete, machte ich nicht mit. Ich spürte, dass ein Traum zuende ging, und hatte Angst vor dem Erwachen. Als sich der Vorhang schloss, die Menge, die es plötzlich eilig hatte, in Bewegung kam und Licht aufflammte, weinte ich. Meine Mutter, die der Meinung war, dass Jungen gar nicht weinen sollten, schob es auf die Müdigkeit: Es war zu viel für ihn! Mein Vater aber schlug mir vor, die Trauer deshalb zu empfinden, weil ich Pony Hütchen niemals wiedersah; das akzeptierte ich.«
Ich habe das nie akzeptiert, auch nicht, dass Jungen nicht weinen; weshalb mir nichts anderes übrig blieb, als, Jahrzehnte später, einfach selber Pony Hütchen zu werden, indem ich die Schumannstraße 15 bezog, um dort meine eigenen Bücher zu schreiben. Das tue ich bis heute und werde es weiter tun, bis zum jüngsten Tag. Freilich, auch der Freudenhimmel des Schaffens hat seine Wolken, und nicht alle Jungen ziehen spurlos vorüber. Und, auch das soll heute nicht verschwiegen werden, die Gegend hat sich natürlich verändert.
Denn Herr Grundeis ist längst zurückgekehrt und annonciert Berlin Mitte inzwischen wie folgt: »Unsere charmante Pony Hütchen Suite (45 qm), sowie die Emil Tischbeinsuite (35qm), ausgestattet mit Designermöbeln und ausgesuchten Antiquitäten, ist hell und lichtdurchflutet. Auf der üppig begrünten Dachterrasse laden Sitz- und Liegegelegenheiten zum Verweilen ein. Eine kleine, aber feine Bücher- u. DVD-Auswahl erwarten Sie bei uns. Kinderbett und Kinderstuhl stehen auf Anfrage ohne Aufpreis bereit. Zentral gelegen im Regierungs- und Theaterviertel und doch ruhig im 2. Stock eines sanierten Altbaus erreichen Sie alle Sehenswürdigkeiten wie Museumsinsel, Brandenburger Tor, Reichstag in wenigen Minuten zu Fuß. Die Matratzen sind hochwertig und auch für Menschen mit Rückenproblemen geeignet, was meine Mutter bereits positiv getestet hat! Reizarme Umgebung für Allergiker, Nichtraucherdomizil, für Kinder geeignet.«
Ob die ›Pony Hütchen Suite‹ in Berlin Mitte für Kinder geeignet und die Gegend tatsächlich reizarm ist, sei dahingestellt. Die Makler mögen mit ihren Resultaten, Formeln und Hypothesen stufenweise vorankommen; der Weg der Literatur hat mit Vermietungen wenig zu schaffen, sondern mit denen, die davon träumen, neue Räume erfahrbar zu machen, in denen wir, egal ob Kinder oder Erwachsene, auf neue Weise zu Radfahrern werden und die Welt auf eigene Weisen erobern; weshalb wir es heute Abend doch lieber mit Emils Großmutter halten. Sie klopfte »mit dem Löffel an ihre goldene Tasse, stand auf und sagte: ›Nun hört mal gut zu, ihr Kadetten. Ich will nämlich eine Rede halten. Also, bildet euch bloß nichts ein. Ich lobe euch nicht. Die andern haben euch schon ganz verrückt gemacht. Da tu ich nicht mit. Nein, da tu ich nicht mit!‹«
Denn es gilt ja das Leben, unser Leben in Mitte, und wir haben nur das eine! Nur so ist Literatur möglich. Und so auch nur mögen Auszeichnungen gelten!
Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
Felicitas Hoppe/30.10.2015/für Kästner in München/ 30.10.2015