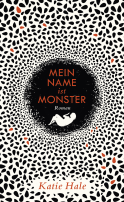
Vielleicht kann man nur als Monster überleben
»Früher galt für das Überleben die Dreier-Regel. Es hieß, ein Mensch könne drei Tage ohne Wasser, drei Wochen ohne Nahrung und drei Monate ohne Gesellschaft überstehen«, schreibt Katie Hale in ihrem Debütroman und konfrontiert uns dabei mit den erschreckend aktuellen Fragen von Menschlichkeit und gesellschaftlicher Isolation. In »Mein Name ist Monster«, gerade in deutscher Übersetzung von Eva Kemper erschienen, rafft eine Krankheit die Menschheit dahin und wirft eine junge Frau auf sich allein zurück. Uns erzählte die Engländerin von den Büchern, die sie in eine Quarantäne mitnehmen würde und die ihr die Türen zu ihrem eigenen Roman öffneten.
Am Anfang…
Wie jede Geschichte begann Mein Name ist Monster mit einer Idee. Im Gegensatz zu J. K. Rowling, der Harry Potter bekanntermaßen während einer Zugfahrt einfiel, erinnere ich mich jedoch nicht an den ersten sprühenden Funken. Aber daran, dass es mit Frankenstein begann. Mich beschäftigte die Frage, inwieweit wir wirklich anderes Leben erschaffen können. Das war lange bevor ich mit dem Schreiben begann. 2011, vielleicht nur wenige Wochen nach dem das National Theatre die Doppelproduktion von Frankenstein ausgestrahlt hatte, mit Benedict Cumberbatch und Johnny Lee Miller in den Hauptrollen. Das Besondere an dieser Aufführung war, dass beide Schauspieler in wechselnden Rollen spielten. Vom Geschöpf zum Schöpfer. Sollte dies die Geburt meines Romans gewesen sein, war es kein wirklicher Anfang im konkreten Sinne. Natürlich spielte ich mit der Idee, aber nur in meinem Kopf. Es war bloß eine Geschichte, die ich mir von Zeit zu Zeit selbst erzählte – und die ich mit jeder Wiedererzählung weiter entwickelte und veränderte. Damals hielt ich mich nicht für eine Romanautorin. Ich war Lyrikerin, ich schrieb Gedichte, und wollte in dieser Schublade bleiben. Ja, ich hatte Angst daraus hervor zu krabbeln.
Vor kurzem war ich in Glasgow in der Women’s Library, Großbritanniens einzigem akkreditierten Museum, das sich dem Leben, der Geschichte und den Werken von Frauen widmet. Dort sah ich Ali Smith über die Bücher und Autoren sprechen, die ihr die Türen zum Schreiben geöffnet hatten. Ich fing an über meine Wegbereiter nachzudenken, über die Bücher, die mir viel bedeuten und die Tür zu Mein Name ist Monster öffneten. Hier sind fünf davon:
1 – Robinson Crusoe von Daniel Defoe
Robinson Crusoe ist vermutlich einer der offensichtlicheren Einflüsse für mein Buch. In vielerlei Hinsicht ist Mein Name ist Monster eine Umkehrung von Robinson Crusoe. Es ist die Geschichte einer Frau, die glaubt, der letzte Mensch auf Erden zu sein – bis sie ein Mädchen findet. Das Buch lässt Crusoes Einsamkeit auf einer verlassenen Insel widerhallen, seinen Kampf ums Überleben, und sein Finden (und Versklavung) von Freitag. Ich hatte schon immer eine komplizierte Beziehung zu Daniel Defoes Werk, seit ich es während meines ersten Unisemesters gelesen habe. Auf der einen Seite ist es eine Geschichte, die so einen prominenten Platz in unserer Kultur einnimmt. Unglaublich, wie viele Menschen dieses Buch kennen (oder zumindest seinen Kern), ohne das Buch selbst jemals gelesen zu haben. Es ist auch unglaublich, wie viele Menschen glauben, sie hätten das Buch gelesen, obwohl sie es tatsächlich gar nicht haben. Klar, es gibt unzählige Adaptionen – in der Literatur wie im Film, von Der Marsianer bis Castaway. Das Buch selbst aber ist ein ziemliches Stück Arbeit, wenn ich das sagen darf. Bevor Freitag überhaupt erscheint, wird erst einmal hauptsächlich über Crusoes religiöse Wandlung berichtet, oder sehr detailreich über die handwerkliche Bauweise einer Unterkunft. Nicht wirklich ein Pageturner. Jedenfalls nicht so lange die Piraten auftauchen. Und natürlich gibt es da den problematischen Kolonialaspekt des Buches: es positioniert Freitag als einen versklavten Eingeborenen, den Crusoe »zivilisiert«. Crusoes territoriale Übernahme, auch durch das Benennen von Dingen, diese selbstverständliche Besitznahme der Insel – als hätte sie, bevor er hier angespült wurde, nicht existiert. Ich wollte mit Mein Name ist Monster eine andere Antwort finden.
2 – Frankenstein von Mary Shelley
Mein Name ist Monster wurde auch stark von Mary Shelleys Frankenstein beeinflusst, das wird ja schon am Titel deutlich. Im Gegensatz zu Robinson Crusoe liebte ich diesen Roman von der ersten Stunde an – auch das war in meinem ersten Jahr an der Universität. Gewissermaßen sind die Themen dieser beiden Klassiker ziemlich ähnlich: beide erzählen von der menschlichen Sehnsucht zu erschaffen und Kontrolle über andere auszuüben, und von der Fähigkeit, unfreiwillige Isolation zu meistern. Beide beschäftigen sich mit der Frage, wer die Macht hat, Personen und Dingen einen Namen zu geben. Aber während Crusoe Freitag in eine Position der Unterwürfigkeit stellt, präsentiert Frankenstein zwei ziemlich gleichwertige Individuen mit einer viel komplexeren Schöpfer/Geschöpf-Beziehung. Und so sind auch die Fragen, die dieser Roman stellt, viel komplexer – Fragen, die das Genre der Science Fiction seitdem formen, so wie die, ob ein (künstlich) erschaffenes Wesen als Mensch betrachtet werden kann.
3 – Die Straße von Cormac McCarthy
Wenn man bedenkt, dass Mein Name ist Monster in einer leeren Welt spielt, überrascht es vermutlich nicht, dass dieser postapokalyptische Roman auf meiner Liste steht. Die Straße habe ich zum ersten Mal auf dem Gymnasium gelesen und es hat mich schwer beeindruckt. Am meisten liebte ich, dass es eigentlich gar nicht so sehr um das postapokalyptische Setting geht, sondern dass es im Kern eine Geschichte über einen Vater und seinen Sohn und ihre Beziehung ist. Das ist etwas, was mich schon immer interessiert hat: die Weise, wie etwas Großes in dieser Welt passiert, wir dennoch die ganze Zeit bei den zentralen Charakteren des Romans bleiben. Und es ist einfach wunderschön geschrieben. Die Prosa ist präzise, dass es fast unglaublich simpel klingt. Aber wie die meisten Dinge, die einfach erscheinen, ist es der Beweis eines großen Schreibtalents. Die Fähigkeit, alle Details zu tilgen, die unwesentlich sind – das ist viel schwerer als es klingt. Das weiß ich, seit ich meinen Roman begonnen habe.
4 – Mein Leben als Schäfer von James Rebanks
Das wohl aktuellste Buch auf meiner Liste. Ein Sachbuch über eine Schaffarm in Cumbria. Es ist eine Art Liebesbrief an die englische Landschaft, in der ich aufgewachsen bin. Als ich nach dem Studium wieder nach Cumbria zurückzog, fühlte ich ein bisschen Verbitterung. Nicht, dass ich Cumbria nicht liebte. Es ist wunderschön, und hier hat der Einzelne für den anderen eine Bedeutung, die in großen Städten gerne verloren geht. Es war mehr das Gefühl, dass ich mich verpflichtet sah, woanders hinzuziehen, bloß nicht zurück nach Hause. Es fühlte sich an, als hätte ich mich überhaupt nicht weiterentwickelt. Ich wollte nicht die Person sein, die ich mit 18 Jahren war, als ich Cumbria verließ, um zu studieren. Mein Leben als Schäfer half mir mich wieder in Cumbria zu verlieben. Rebanks‘ Erfahrungen mit der Region sind ganz anders als meine eigenen. Ich bin zwar von Feldern und Schafen umgeben aufgewachsen, aber entstamme keiner Bauernfamilie. Rebanks schaffte es dennoch, dass ich wieder eine Verbindung zu dieser Landschaft fand. Dass ich ankam. Ich hatte das Gefühl, ich verstand die Landschaft, wie ich sie vorher noch nie gesehen hatte.
5 – Orangen sind nicht die einzige Frucht von Jeanette Winterson
Wie vielleicht viele queere Menschen, hat Orangen sind nicht die einzige Frucht für mich viele Türen geöffnet, nicht nur in der Literatur, sondern in meinem Leben. Wie Die Straße las ich es während des Gymnasiums. Es prägte sehr mein Verständnis über die Person, die ich bin. Und was und wer in meinen Roman passen könnte. Es beeinflusste mein Verständnis von Figurenzeichnung – die herausstechenden Details, die eine Figur aus der Seite springen lassen, bis es sich anfühlt, als sei sie jemand, den du tatsächlich getroffen hast. Das alles brachte mir Jeanette Winterson bei. Der Hinweis auf die Geschichte und Mythologie faszinierte mich bei ihr. Wie auch bei Ali Smith. Mich interessieren alle Formen der Intertextualität, die dem Roman eine Weite und Tiefe geben. Wie in Die Straße bleibt der Fokus auf den Figuren im Zentrum der Geschichte, während doch so viel mehr passiert in seinen Rändern.
