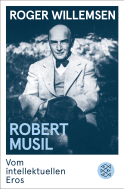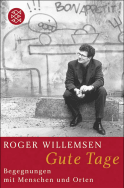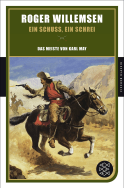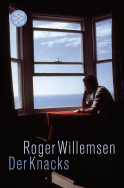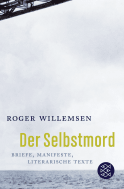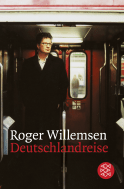Es ist sinnvoll, einen Knacks zu haben
Am 15. August 2021 hätte Roger Willemsen seinen 66. Geburtstag feiern können. Caspar-Maria Russo gratuliert und erinnert an den Autor, Kulturvermittler und Universalgelehrten.

Ich wollte ein Existenzrecht erwirken. Nicht meins, eins. Ich wollte ein Buch klauen, oder besser: klauen lassen. Der Vollständigkeit halber. Ich habe lange überlegt, wie ich es anstelle. Welches Fluchtfahrzeug die Person bräuchte, durch welche Straßen sie fahren müsste, um eine möglichst lange Grünstrecke zu erwischen, um auf und davon zu sein. Ich wollte als Auftraggeber eines Diebstahls den Vollkaskoschutz für den Dieb. Bei einem sehr wahrscheinlichen Scheitern, das hätte ich dem Ganzen zugetraut, hätte ich die volle Verantwortung übernommen. Wenn schon klauen, dann aufrichtig. Es hätte ein Chevrolet oder ein Fahrrad sein können, ganz egal. Ich wollte das Buch.
Heute lebe ich in Wien, aber ich habe in Freiburg Germanistik studiert, und das Buch, das ich von einem Freund aus der Universitätsbibliothek klauen lassen wollte, war Willemsens Musil-Promotion Das Existenzrecht der Dichtung. Der Wilhelm Fink Verlag, wo die Dissertation erschien, antwortete auf meine Anfrage freundlich ablehnend, der Text werde längst nicht mehr gedruckt. Ist ja auch schon fast vierzig Jahre her. Trotzdem dachte ich, Willemsen, da müsste es einen Reprint geben oder so. An der Uni Wien war mir das zu heikel, ich meine, ich bin da eingeschrieben, außerdem sind mir die Mechanismen des Stehlens rein gar nicht bekannt. Also in Wien. Und in Freiburg. Ich rief meinen Freund an, dessen Vater Autor ist, in der Hoffnung, Verständnis zu bekommen. Ich sagte: Wäre es möglich, ich würde es vorbestellen … du dann, wenn sie weggucken … am Plexiglas vorbei … nein, nicht gefährlich … sinnvoll, überlebenswichtig … Schadensersatz? Das ist ein Buch, ich bitte dich … Fluchtfahrzeug organisiere … ja, keine Sorge … was? Nicht? Ist es jetzt so schlimm, ein Buch zu klauen? Ist ja nur eins. Willemsen hat mal einen Bildband von Francisco de Goya geklaut und ihn einer Prostituierten geschenkt. Da ist meine Geschichte ja weitaus harmloser. Er zeigt mir trotzdem stirnfaltig und mit wurstigen Fingern vor dem Kopf wischend den Vogel. Ich habe fast alle lieferbaren und nur noch antiquarisch zu erhaltenden Bücher von Willemsen zu Hause, säuberlich nach Erscheinungsjahr sortiert. Und die, die ich noch nicht habe, hake ich nach und nach von der Liste ab. Ich maße mir an, einen Freund im Regal zu haben, mit dem ich mich streite und dessen Existenzrecht mir verweigert wird.
Als ich dann nach Wien gezogen bin, war ich mit meiner WG auf einer Party in Ottakring. Alles war neu für mich: Die Stadt und ihre überall sichtbaren ästhetischen Geschmacksverstärker, das Burgtheater, das ich, um cool zu sein, nur die Burg nannte, die mir noch dazu den Geldbeutel auszog, weil ich alles sehen wollte, die gelben Lichter, die sich im warmen Oktober durch die kordeligen Spinnweben kämpften, die Kaffeehäuser, das nervbackige und durch die Wiener Moderne hochstilisierte Café Central, in das ich bis heute zum Glück nicht gegangen bin, der fehlende Regen, den ich aus Hamburg kenne, das polierte fin de siècle, das ich in meiner pseudoakademischen Hybris überall sehen und schmecken wollte. Ich wollte ja partout kein anderes Wien sehen als das von Altenberg, Joseph Roth, Irmgard Keun, Zweig und Bachmann. Ein bisschen blind, ein bisschen süß. Willemsen hatte ich unterm Arm, lief die Untere Weißgerberstraße entlang, wo Musil für eine Zeit wohnte. Ich muss doch einen ordentlichen Schatten haben, also wechsle ich mal ins Präsens. Wie ich das da oben auch beschreibe: kordelige Spinnweben. Was für ein Scheiß! Muss ich wieder löschen. Alles zu wässrig. Seiʼs drum. Es geht um die Party. Also. Narkotisiert von der Gestrigkeit komme ich bei der Party an, mit Unwissen ausgestattet, kann niemandem so richtig in die Augen gucken, weil ich noch ein bisschen benommen bin. Man plaudert, ich traue mich mal wieder nicht, irgendwelche Drogen zu nehmen. Ich übe mich an meinen halbwarmen Witzen, drope meinen ich habe noch nie gekifft, und alle: was?, und ich: ja. Und alle sind für einen Moment erstaunt. Es entspricht sogar der Wahrheit, was mich von Willemsen ja nun deutlich unterscheidet, der mal eine Sendung machen wollte, wo er mit dem Gast kifft, um zu zeigen, wie man langsam aus der kausalen Welt hinaustrudeln kann. Nicht geklappt. Ich setze mich aufs Sofa mit zwei anderen aus dem neuen Freund*innenkreis, als sich meine liebenswerte neue Mitbewohnerin kotzend für fünf Stunden ins Gastgeberinnenbett verabschiedet. Zu dritt sprechen wir über dies und das, ich fühle mich sehr wohl, trinke ein Bier leer, fülle die Dose mit Wasser, um dem Schicksal zu entgehen, das meine Mitbewohnerin gerade ausspeit. In den sehr frühen Morgenstunden geht es dann um den ersten Sex. Alle sind ehrlich, zumindest scheint es so, und ich muss endlich aus meiner illusorischen Literaturbubble herauskommen. Ich erzähle also von meinem ersten Sex. Ich war damals massiv unsicher und gab einige Portionen Sicherheit vor, schämte mich für mein Kleinsein, weil ich mit siebzehn immer noch aussah wie ein Zwölfjähriger, ich war aus mir unerfindlichen Gründen, vermutlich vor lauter Aufregung, kopflos. Mein Kopf lag unten, ich oben im Hochbett. Ich dachte, ohne Kopf würde man da schneller durchkommen, ich würde es irgendwie schaffen, bog mich über sie, eine drei Jahre ältere Frau und war erstaunt: So viel? Ich kam nicht mehr klar. Mache ich das hier gerade richtig? Besser die Hand hier? Ich dachte, es ist eine okaye Sache, und ich könnte parallel noch was anderes machen, danebenliegen oder so. Das, was ich über Sex wusste, stand in irgendwelchen Packungsbeilagen, und ich war massiv orientierungslos. Nach lang ausgehaltenen viereinhalb Sekunden bin ich gekommen und legte mich erschöpft neben die Frau, die mich schräg anguckte und fragte, ob ich krank sei. Bist du krank? Ne, gekommen. Ah. Lachen. – Ich rede mich in ein gutes Tempo und könnte noch von einem Freund erzählen. Also packe ich aus.
Roger ist dran. Ich kenne seine Geschichte mit der englischen Austauschschülerin Angela aus einer Folge Willkommen Österreich. Ich bekleide mich mit ihm und stelle mich gleichzeitig mit schweißigen Händen bei ihm vor. Hier, ich bin Caspar, ich erzähle gerade deine Geschichte, darf ich? Ich duze ihn sofort. Also erzähle ich davon, wie hässlich er sich selbst beschreibt: Er hatte Haare, sagt er, die das Interesse an ihm verloren, ein mandelförmiges Gesicht, das nur durch die zu große Nase geteilt wurde, trug einen in einer hellen Durchfallfarbe gehaltenen Parker und lag bekleidet an einem Mittwoch in den siebziger Jahren mit Angela im Bett. Was soll ich jetzt tun? Er hatte beim DLRG Griffe gelernt, wie man Ertrinkende packen muss. Diese Griffe probierte er alle an ihr aus. Dann wusste er nicht, wo es ist. Nun ja. Er konnte Stellen ausschließen, wo es nicht ist.
Willemsen hat einmal geschrieben: »Warum sollte nicht fehlen können, was man nie besaß?« Es fehlt nicht nur sein Buch in meinem Regal, sondern auch er als Erzähler, als Person, die Wert stiftet. Die Geschichten katapultieren mich ins wirkliche Wien. In die morgendliche Dämmerung, in den Erker, in die Wohnung, in den tanzenden Restschwarm der Menschen. Herzlich willkommen in Wien, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag.
Warum über Willemsen schreiben? War die Bestürzung über den plötzlichen Tod nur ein kurzes Ausatmen? Übersieht man sein Werk als Zeitkommentar, als ein Narrativ, das nur im Kontext einer schmalen Jahresspanne erklär- und tragbar ist? Zweifellos: Das Hohe Haus ist ein Buch über den Bundestag Anfang der Zehnerjahre, aber zeigt es nicht ein Vexierbild der Demokratie insgesamt, ist es nicht vielmehr ein Lehrstück über den parlamentarischen Dialog und die ununterbrochene Arbeit an seiner Qualität, an der Rücknahme der Ressentiments und Zunahme des qualitativen und sachkenntlichen Arguments? Das Buch kann noch in vierzig Jahren Schullektüre sein. Auch die Essays, Glossen, Kolumnen und selbst die Reden sind Kritiken und Polemiken, die sich an eine Zeitspanne halten (müssen). Aber zeigen sie nicht eine dringend notwendige Humanisierung, epochenübergreifend, fordern sie nicht einen globalen Blick, der Zusammenhänge freischält, wo der Westen sich still aus der Verantwortung zieht? Zeitlosigkeit ist ein abgeschmackt-verschimmelter Begriff, und er trifft in diesem Fall nicht zu. Ein Text ist immer in einer Zeit geboren, weist auf eine hin und entgrenzt eine andere. Aber sind die Zeiten nicht schablonierbar, sind die Gegenwartssymbole überhaupt irgendwann abgeschlossen? Selbst Kopf oder Adler oder die Rede Die deutsche Frage schärfen die Patriotismuskritik, den rappelköpfigen Nationaldünkel, das Stolzgehabe einer um sich selbst kreisenden Nation, die, in Wahrheit, ohne andere Kulturen nicht sie selbst wäre. Unterspülen Willemsens Analysegerüste nicht den öden Rechtsradikalismus, der Spur um Spur mit geschwollener Zunge hechelt, ein paar lustlose Reststimmen abgreift, der aber letztlich nur eine billige Kopie des vergangenen Jahrhunderts ist? Sogar Schreibseminare könnten sich die Figuren der Willkür getrost auf den Lehrplan setzen, um nicht nur das Handwerk, sondern auch den Intertext kennenzulernen und sich der Frage zu widmen, die Diderot und Laurence Sterne in ihren Romanen umkreisen: Was kann und darf ein Text eigentlich? Das autobiografische Triptychon – Der Knacks, Die Enden der Welt, Momentum – skizziert das Innenleben im Außenspiegel um Längen präziser als manch anderer als groß angekündigte Roman der Weltliteratur. Ja, Willemsen ist aktuell. Und wo man ihn ausbleichen lässt, darf man ihn wiederfinden. Was hätte er uns über Ibiza, das langsame Verschwinden Tongas, Trump, die auch noch heute bestehende Sinnhaftigkeit der Blockrandbebauung, Jens Spahn, Influencer*innen, die Querdenken-Bewegung, die brasilianische Regenwaldrodung, biointensives Gärtnern und die Heidschnucke, anästhesierende Lügenpresse, die durch die AfD provozierte Verschiebung der Sagbarkeitsgrenze im Bundestag, Möhrenfliegen, Peter Handke und Liv Strömquist, Danger Dan und Igor Levit und den Podcastwahn erzählt? Hätte er selbst einen Podcast auf Spotify, wie jetzt sogar Heinz Strunk einen hat? Welche Bücher, welche Romane wären noch gekommen? Hätte er Die Parasiten fertiggestellt? Wer wir waren wäre vielleicht länger geworden, zweibändig. Der Zukunftskonjunktiv nervt, er ist flach, weil er ungenau ist. Das, was W. G. Sebald bei Rousseau bewundert – so viel geschrieben zu haben und gleichzeitig so qualitativ hochwertig – können wir getrost über Willemsen sagen. Nur war Rousseau nicht der Schirmherr des Afghanischen Frauenvereins, interviewte nicht über tausend Personen, bereiste nicht den ganzen Globus und machte auch nicht dauernd laufende und proppevoll besuchte Bühnenprogramme.
Es ist vielleicht gar nicht so schlecht, einen Knacks zu haben, denke ich mir. Was hätte er über meine Datei Willemsens Wörter auf meinem Laptop gesagt? Akribisch schreibe ich Neuschöpfungen, Satzreihen, Erzählansätze, Exkurse auf. Aber wo hatte er einen Knacks? Dass er bei der Wixxer-Verfilmung sich selbst persifliert und als Imageverschmutzung darstellt, dass er Brüche zwischen Grillparzers Spätwerk und der Cellulite Peter Bonds, zwischen Atomphysik und Analsex, zwischen Leninismus und Hamburg-Billstedt herstellt, macht ihn zu einer Person, die immer antwortet. Aber wo blieb die Antwort aus? Wo war er in aller Stille? Leise stehen seine Bücher in meinem Regal, magst du mir mal bitte antworten? Kann doch nicht sein, dass ich hier monologisieren muss. Es ist ein Geburtstagsfest, ohne Anwesenheit des Geburtstags-kindes. Es liegt jetzt an uns, was wir daraus machen. Er wollte nicht, dass in seinen letzten Stunden Leute um ihn herumstehen, sonst hätte er seinen eigenen Tod moderiert. Machen wir jetzt ohne ihn weiter. Dabei ist er gestern erst gestorben, das ist jetzt vierzig Jahre her, und sein Existenzrecht der Dichtung wurde immer noch nicht nachgedruckt –und ich habe es auch nicht klauen können. Dafür erzähle ich seine Sexgeschichten. Vielleicht ist er der Knacks, den ich habe.
Man kann ohne Gastgeber Feste feiern. 66 Jahre. Auf der 71. Berlinale feiert der nach der gleichnamigen Rede produzierte Dokumentarfilm Wer wir waren von Marc Bauder Weltpremiere, im November 2021 findet in der Akademie der Künste eine Willemsen-Ausstellung statt, wo Einblicke in den Nachlass gewährt werden, Insa Wilke, Freundin und Verwalterin des Nachlasses, stellte als Herausgeberin im Dezember 2020 zwei weitere Publikationen vor: Willemsens Jahreszeiten, seine Kolumne im ZEIT-Magazin, und Unterwegs, mit zum Teil unveröffentlichten Reisetexten. Er wollte ja nicht dabei sein, wenn man um ihn herumsteht. Also werden wir aktiv sein müssen und auf den Moderator verzichten. Er war das, was wir in unserer Schulzeit gebraucht hätten: Einen erwachsenen Begleiter mit kindlichem Blick. Jener, der beibringt, Argumente zu stärken und Ressentiments abzubauen, der Sympathie vor Kompetenz stellt. Würde man sein Werk auf eine Zeile verdichten, lautete sie: Erziehung zur Mündigkeit (verzeiht mir das Pathos), obwohl er sich mit ziemlicher Sicherheit der Rolle des Erziehers entziehen würde.
Werden wir zukünftig sagen können, wer wir waren? Oder wird die Verblendung unser Handeln übergrellen? Bei Willemsen ist nachzulesen, dass Freundlichkeit vor Zynismus kommt, dass Empathie kein Aburteil, sondern Voraussetzung des Miteinanders ist, dass Kultur vor Professur steht und das größte Missverständnis ein neoliberales Ich ist. Verstehen wir uns nicht als Wir, sondern als Vereinzelung, sehen wir unser Handeln vermutlich als Zerschrottung des Planeten. Wenn wir überhaupt irgendwas sehen. Es lebt sich ja bekanntlich auch blind. Aber wir können nicht behaupten, Willemsen sei nicht da, nur weil er bei seinem eigenen Geburtstag nicht auftaucht. In der Buchhandlung unseres Vertrauens gibt es ja das meiste noch. Seine Ewigkeitsthemen sind nicht seine, sondern unsere, und damit eben alles andere als eine gänzlich Unbekannte. Entweder wir stapfen los und nehmen ihn beim Wort oder vergammeln in der verweigerten Handlung. Oder wir geben einen Bücherdiebstahl in Auftrag, der scheitert. Dafür lassen sich seine Sexgeschichten gut erzählen, seine Bücher empfehlen, die Interviews, die Reden, um sich durch ihn durch zu graben – und im besten Fall bei dem anzukommen, was man Mündigkeit nennt. Vielleicht komme ich da auch irgendwann hin, sofern ich weiterhin einen Knacks habe. So als Germanist. Übrigens ein Beruf, der ganz unterschiedlich ankommt. Ich wurde mal gefragt, was man so als »Germanstiker« macht. Zwei Wochen später wurde ich gefragt, was man so als studierter Germane macht. Vielleicht das, den Knacks suchen. Damit steht fest, dass wir zu denen orchestriert sind, die wir sind und waren, die wir hätten sein können und diejenigen, die wir zu sein nicht auszumalen im Stande gewesen sein werden. Bei uns liegt der Ball. Danke für 66 Jahre. Wie viele kommen noch?
Caspar-Maria Russo ist 26 und wurde 2017 mit seiner Inszenierung »Das bin ich nicht« zum 38. Theatertreffen der Jugend eingeladen. Er ist Hörspielsprecher des DJ-Kollektivs Trio Medusa, das monatlich bei Orange FM auflegt. Bei dieser Radiosendung liest er eigene Kurzgeschichten. In Wien studiert er Komparatistik. Für seinen Romanentwurf »Ein Spielmann jagt den nächsten« erhielt er dreimal das Stipendium der Franz-Edelmaier-Residenz für Literatur und Menschenrechte.