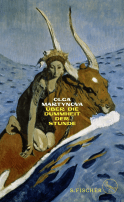
Über die Dummheit der Stunde
Olga Martynova über den »Terror der Aktualität« (Jean Améry) und die Freiheit der Literatur.

An einem warmen Berliner Sommerabend (der einen fast unerträglich heißen Berliner Tag ablöste und so unschuldig nach Lindenblüten duftete, als wären die viereinhalb Stunden am nahezu glühenden Gleis des Bahnhofs Berlin-Spandau nie gewesen, im Laufe derer ich versucht hatte, die Hauptstadt gen Frankfurt am Main zu verlassen, bis die Deutsche Bahn hatte gestehen müssen, dass es an jenem Tag überhaupt nicht mehr gehen würde) saß ich mit der Schriftstellerin Iris Hanika auf der Terrasse eines Cafés und erzählte ihr von den jungen Autoren, die als Studenten Berlins und Brandenburgs mein Seminar im Rahmen der Heiner-Müller-Gastprofessur an der FU besuchten. Erstaunlich oft waren die von ihnen initiierten Gesprächsthemen aus dem Sud des Feuilletons entstanden. Zum Beispiel: Muss Literatur politisch sein? Oder entschiedener: Wann wird Literatur endlich wieder politisch?! Welche Inhalte muss / darf Literatur transportieren? Muss Literatur aktuell sein und was heißt Aktualität? Wie weit darf die künstlerische Freiheit gehen? Fördert der Literaturbetrieb tatsächlich nur die Mittelschicht-Akademiker-Kinder? Usw.
Für mich (und ich kann nur hoffen, auch für meine »Studenten«) waren diese Gespräche insbesondere deshalb interessant, weil ich die Meinung vertrete, dass sich die Literatur möglichst von der Medienaktualität unbeeinflusst halten soll. Diese meine Ansicht bedarf einer Erklärung. Ich bin mir dessen bewusst, dass wir uns jetzt, wenn ich das schreibe, auf der Spitze der gesellschaftlichen Aufregung befinden. ##author:1928##Natürlich hat die Geschichte nie geschlafen (geschweige denn ihr Ende erreicht), aber innerhalb von zwei Jahren ist auch in unseren Breiten die unmittelbare Wirklichkeit so geworden, dass man sie beim besten Willen nicht ignorieren kann. Ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um über die Unabhängigkeit der Kunst von der Aktualität zu diskutieren? Können wir uns überhaupt noch darüber austauschen? Ich glaube, ja. Ich glaube sogar, dass es genau der richtige Zeitpunkt ist. Weil es in Zeiten sich ausruhender Geschichte ziemlich belanglos und abstrakt ist, über die Verknüpfung von Kunst mit Politik, Wirtschaft, Zensur oder Menschenrechten zu streiten. Jetzt ist es aber anders. Leider. Was ich meinen »Studenten« zu sagen versucht hatte (und ich fürchte, es ist mir nicht gelungen, sonst hätte ich kein Bedürfnis, diesen Text zu schreiben): Unter vielen Begabten gibt es wenige, die der Dummheit der Stunde nicht hinterherlaufen. Es geht um die Freiheit und die Frechheit, die allgemeingültigen Vorstellungen und Forderungen nicht zu berücksichtigen.
An jenem Abend und in diesem Zusammenhang erinnerte sich Iris Hanika an den beeindruckenden Satz von Carl Einstein, »Aktualität ist Collaboration«, wofür ich mich an dieser Stelle bei ihr bedanke. Das ist ein in seiner Rätselhaftigkeit prächtiger Satz. Um ihn deuten zu können, habe ich mir den Band mit den Nachlasstexten, aus dem er stammt, bestellt und gelesen. Diesen Satz an sich könnte man auf die Fahnen der Aktualitätsverweigerer schreiben. Dabei darf man das nicht, weil der Urheber das Wort »Collaboration« nicht negativ gemeint hat. Der Satz ist undatiert. Zu vermuten ist, dass er im Frankreich der 1930er und somit vor der Besatzung durch NS-Deutsche Truppen geschrieben wurde. Das Wort Kollaboration, mal mit »K«, mal mit »C« geschrieben, steht bei Carl Einstein wenn nicht für die Zusammenarbeit, dann wenigstens für den Dialog mit der Wirklichkeit, zu dem er unverhofft aufruft. Der Theoretiker und Verfechter der Kunst der Moderne einerseits stand mit seinen linkspolitischen Überzeugungen andererseits im Widerspruch zu seinem eigenen ästhetischen Programm, auf welches er als Folge verzichten musste. Das ehrliche Denken ist widersprüchlich. Und in diesem Zitat: »Begreiflich, dass die Modernen nicht die breite Aktualität darstellen; denn solches Unternehmen hätte an sich ihren schrankenlosen Individualism begrenzt u widerlegt. – Aktualität ist Collaboration; denn Gegenwart besteht aus mannigfaltigen Elementen u Kraeften« – tritt seine volle Widersprüchlichkeit hervor.
Wie jeder gelungene Satz gehört auch dieser, »Aktualität ist Collaboration«, nachdem er ausgesprochen wurde, nicht oder nicht ausschließlich dem Urheber. Zu Carl Einstein komme ich noch zurück. Zuerst will ich mich mit diesen Worten in seiner Abwesenheit beschäftigen. Mit wem kollaboriert der Künstler, wenn er versucht, »aktuell« zu sein? Ich glaube, er kollaboriert mit der Dummheit der Stunde. Die Gegenwart ist trügerisch. Journalisten und Politiker können nichts dafür, sie müssen sich mit ihr auseinandersetzen. Das ist ein unvermeidliches Übel. Dieser Tatsache ist Jean Amérys Essay ›Terror der Aktualität‹ gewidmet. Das ist ein Übel, erklärt er, weil der Beschleunigungs- und Abwechslungszwang zu gefährlicher Belanglosigkeit der Information führt und letztendlich zu fehlerhaften Ansichten. Denn Aktualität ist eine tückische Sache. Wie Mode. Sie ändert sich ständig. Und das ist der Grund, meiner Meinung nach, warum sie einen Künstler immer verrät, warum ein Künstler, der sich auf sie verlässt, am Ende immer dumm dasteht. Keiner sieht die Gegenwart. Wir alle bekommen vom medialen Feld verschiedene Bilder, aus denen wir das auswählen, was unseren Vorstellungen entspricht. Aber im Unterschied zu Journalisten und Politikern können sich Künstler den Luxus leisten, diese Bilder zu ignorieren. Ob sie sich diesen Luxus nehmen, ist eine andere Frage.
Künstler sind nicht hellsichtiger als alle anderen Menschen. Ihre Meinungen zur jeweiligen aktuellen Lage sind, obwohl sie sie in überzeugende Gewänder zu kleiden wissen, nicht wertvoller als die Meinungen eines jeden Menschen. Wären die politischen Überzeugungen der Dichter übrigens relevant, hätten wir weder Dostojewski noch Celine noch Knut Hamsun noch Ezra Pound (die Liste kann jeder fortsetzen) lesen können. Obwohl das allgemein bekannt ist, versucht man den Autoren immer wieder eine maßgebliche politische Meinung abzugewinnen. Ich will nicht mitmachen, obwohl das genau das ist, was man notorisch von mir erwartet. Man interviewt mich zum Beispiel anlässlich der besagten Gastprofessur für deutsche Poetik und fragt fast ausschließlich nach der aktuellen politischen Lage in Russland. Jedoch ist meine Meinung (im Allgemeinen und in diesem Fall im Besonderen und besonders) zu dieser aktuellen Lage viel weniger relevant als meine Meinung zur deutschen Poetik, was mir noch kein Interviewer glauben wollte.
Eine Meinung zu verschiedenen Geschehnissen habe ich schon. Ich versuche, mich auf die Gebiete zu begrenzen, wo ich mich mehr oder weniger auskenne, und schreibe darüber ab und zu in Form eines Zeitungsartikels, aber auf keinen Fall in Prosa oder Gedichten. Künstler sind auch Menschen und haben ihre Überzeugungen oder Nerven, wie es Akutagawa Ryūnosuke nennt, wie es Tarkowski in ›Stalker‹ den Schriftsteller wiederholen lässt und wie es Joseph Brodsky in vielen Gesprächen paraphrasiert: Ich habe keine Überzeugungen, ich habe nur Nerven. Auch Künstler haben ihre spontanen Reaktionen auf die Gegenwart. Eine andere Sache ist, wie und ob diese persönlichen Reaktionen und Überzeugungen (oder Nerven) zu Kunst verarbeitet werden oder ob sie rohe Betroffenheitsbilder bleiben. Im letzteren Fall helfen sie nicht bei der Lösung welcher Probleme der Gegenwart auch immer, sondern stören nur.
Schlimm an der Aktualität ist auch, dass sie nur für einen Moment eine solche ist und im nächsten verschwindet und wirkliche Probleme zusammen mit belanglosen Sensationen in die graue Zone des Halbvergessens mit sich zieht. Deshalb werden die aktuellsten Bücher am schnellsten obsolet. Aber niemand spricht im Vakuum. Und niemand spricht in ein Vakuum, auch wenn es einem zuweilen so scheinen mag. Oscar Wilde schaffte mit seinem dekadenten ›Das Bildnis des Dorian Gray‹ ein Portrait der Epoche, das heute viel aussagekräftiger ist als die meisten Abhandlungen und Sachbücher. Nicht zufällig hat Will Self versucht, in ›Dorian – eine Nachahmung‹ nach diesem Muster das Portrait seiner eigenen Epoche zu malen, was wahrscheinlich deshalb nicht hundertprozentig gelingen konnte, weil die Idee, ein aktuelles Portrait der Epoche zu schaffen, zu stark in der Anlage präsent war. Darüber hinaus finde ich, dass Self die gesamte Spannung drastisch reduziert, indem er die Figur, die bei Wilde ein Mädchen ist, zu einem Jungen macht. Diese eigentlich korrektere Angabe zerstört den Wilde’schen Zauber. Ähnlich würde Prousts ›Recherche‹ ihre Spannung dramatisch verlieren, wenn wir das Ganze umschreiben und Marcel anstatt Albertina einen Albert unterschieben würden. Weil Kunst die Verwandlung der Realität in einen anderen physischen Zustand ist. Es kann gelingen oder (wie in den meisten Fällen) nicht gelingen. Wie es gelingt, wenn es gelingt, ist jedes Mal ein Rätsel. Beim Schreiben dieses Absatzes habe ich mir versprochen, dass ich, falls ich eines Tages eine Fabel schreibe, die vom Wesen der Liebe sprechen soll, ein homosexuelles Paar in den Mittelpunkt meiner Narration stellen werde, um meinen Text von der Aktualität meiner eigenen Erfahrungen zu befreien. Es gibt sowieso keinen Realismus. Es gibt nur die Überzeugungskraft des Dichters. Einige können besser als einige andere suggerieren, sie böten ein realistisches Bild an. Nicht nur die Medien, auch die Kunst schafft trügerische Bilder. Die Visionen der Kunst können wahr sein, allerdings nur, wenn sie niemandes Interessen außer ihrer eigenen bedienen.
Und nun, wie versprochen, zurück zu Carl Einstein. Er benutzte das Wort K/Collaboration im positiven Sinne. Dann kam die Zeit, die das Wort mit brutaler Eindeutigkeit belastete. Eine böse linguistische Ironie des Schicksals! Carl Einstein nahm sich an der französisch-spanischen Grenze das Leben, in der Erwartung, dass er entweder über die Grenze geführt oder als Jude verhaftet und ins KZ geschickt werden würde. Er erlitt fast genau das gleiche Ende wie Walter Benjamin (der sich zwar auf der anderen Seite der Grenze, aber aus derselben Verzweiflung heraus das Leben nahm). Wenn wir die neuesten Erkenntnisse über ›Das Warten auf Godot‹ berücksichtigen, dass es sich in diesem Stück, laut der sensationellen, aber gut begründeten Hypothese von Valentin Temkine, um zwei Juden handelt, die in einem Grenzgebiet auf einen Schleuser der Resistance warten, der sie aus dem besetzten Frankreich hinausführen würde, dann sind Walter Benjamin und Carl Einstein gewiss Wladimir und Estragon, zwei »metaphysische Clowns« der grausamen Zeit. All der Schrecken dieser Zeit, die Hoffnungslosigkeit, die Gottesferne, die Desillusionierung, die die Versöhnung mit der Wirklichkeit unmöglich macht, schreien aus diesem Stück und werden immer schreien. In der bis in die völlige Unkenntlichkeit der Umstände zugespitzten Abstraktion ist das Elend der Epoche für immer gespeichert. Von diesem Paradoxon kann man viel lernen.
Die Krise der Kunst, die nach allen Siegen der Moderne eintrat und die Carl Einstein in den 1930ern registrierte, wurde nach dem Zweiten Weltkrieg langsam überwunden, indem sie immer mehr ignoriert wurde. Man darf wieder naiv sein und die Dummheiten der Aktualität künstlerisch ausleben, man wird (freiwillig?) zum Befehlsempfänger der Aktualität degradiert, schreibt, trotz des äußeren Dichteranspruchs, nur, um gekauft zu werden, also bedient man. Niemand stellt die Frage, wie die Themen der Aktualität so zu behandeln wären, dass das Ergebnis nicht danach aussehen würde, dass sie vom medialen Feld aufgezwungen oder ihm entnommen sind und zwar deswegen, weil der Autor entweder nicht weiß, was und worüber er sonst schreiben sollte, oder weil er Angst hat, zurückzubleiben. Dabei muss man sich gar nicht bemühen, gegenwärtig zu sein. Man lebt in der Gegenwart. Man wird altmodisch nur bei den Versuchen, mit der Zeit Schritt zu halten, was fast immer peinlich wirkt, ähnlich wie Eltern, die versuchen, den Slang ihrer Kinder nachzuahmen.
Wenn Künstler ihr politisches Engagement mit ihrer Kunst illustrieren, erzählen sie meistens Quatsch. Ob sie ihren Quatsch talentiert erzählen, ist das Einzige, was zählt. Dann bekommt das Werk einen Mehrwert, der weit über das gestellte Ziel hinausreicht. Und so lief es eigentlich immer und wird es immer laufen (falls überhaupt etwas laufen wird; mein geschichtlicher Optimismus befindet sich momentan fast auf dem Nullpunkt).
