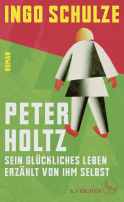Zu den Europawahlen
Am 26. Mai sind Europawahlen. Unser Autor Ingo Schulze hielt am vergangenen Sonntag, den 19. Mai, eine Rede in Berlin vor der Volksbühne auf der »Glänzenden Demonstration – Unite & shine« organisiert von »Die Vielen«.

Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter,
»Die Vielen« gehören zu den Initiativen, die sich gegen Rassismus und Nationalismus engagieren, die weder Bevormundungen noch Beleidigungen oder Übergriffe hinnehmen wollen. Im Aufruf zur heutigen Demonstration heißt es: »Gemeinsam sagen wir: Die EU muss sich ändern, wenn sie eine Zukunft haben will. Wir streiten für unsere Vision eines anderen Europas.«
Beides gehört zusammen: der Widerstand gegen Nationalismus und Rassismus und der Kampf für eine gerechtere Welt, in der nicht Maximalprofit und Shareholdervalue, sondern soziale Gerechtigkeit und ökologisches Wirtschaften unser Leben und Arbeiten bestimmen.
Es reicht nicht, sich als weltoffen und bunt zu gerieren und die EU-Fahne zu schwenken. Eine Glorifizierung der EU in ihrer jetzigen Struktur und Funktionsweise ist genauso borniert und falsch wie ein Zurück zum Nationalstaat.
Es wäre ein folgenschwerer Fehler zu glauben, wir könnten uns damit zufriedengeben, den Status quo zu verteidigen und zu hoffen, dass sich die neuen unangenehmen Parteien und Gruppierungen in Luft auflösen. Wir haben nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn wir sie auch als Symptome einer Realität begreifen, die wir grundlegend verändern müssen.
Zum Beispiel in Sachen Mitbestimmung. Ich fühle mich nur dann wirklich mitverantwortlich, wenn ich auch mitbestimmen kann. (Ich lebte länger in einer Kleinstadt südlich von Leipzig. Dort gab es vor einigen Jahren eine Ausstellung mit dem Titel „Altenburg – Provinz in Europa“. Der Titel verkörpert für mich europäisches Selbstbewusstsein und Selbstverständnis. Im Alltag hat dieses Selbstverständnis aber nur dann eine Chance, wenn ich in EU-Angelegenheiten genauso mitbestimmen kann wie auf nationaler Ebene.) Das Parlament, das wir in einer Woche wählen, ist von diesem Anspruch noch weit entfernt. Die EU muss demokratisiert werden, das Parlament muss endlich sein Larvenstadium hinter sich lassen.
Doch auch die EU-Verträge, die in den Rang einer Verfassung gehoben wurden, sind in einzelnen Punkten untauglich für die Zukunft. Sie sind maßgeschneidert für eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Der Verfassungsrechtler Dieter Grimm schrieb schon vor einigen Jahren dazu: »Seit der EuGH das Verbot marktverzerrender staatlicher Beihilfen an Unternehmen auch auf öffentliche Einrichtungen der Daseinsvorsorge erstreckt hat, kann kein Mitgliedstaat mehr selbst bestimmen, was er dem Markt überlassen und was er in Eigenregie übernehmen will.«
Gerade die Frage, was das Gemeinwesen dem Markt überlässt und was es in Eigenregie übernimmt, wird immer mehr zum Dreh- und Angelpunkt einer glaubwürdigen sozialen Politik, wie die Debatte über Enteignungen von Wohnungsgesellschaften zeigt. Es gibt Lebensbereiche, in denen marktwirtschaftliche Kriterien untauglich sind oder nur eine untergeordnete Rolle spielen dürfen: bei der Kranken- und Rentenversicherung, in der Bildung, beim Transport- und Verkehrswesen, bei der Wasser- , Energie- und Gasversorgung, beim Wohnen. Wer eine ernsthafte Debatte darüber führen will, muss auch diese EU-Verträge wieder zur Diskussion stellen.
Vor mehr als zweihundert Jahren schrieb Georg Christoph Lichtenberg: »Der Amerikaner, der den Kolumbus als erster entdeckte, machte eine böse Entdeckung.«
Europäer außerhalb Europas zu entdecken, war tatsächlich keine gute Entdeckung. Vor wenigen Tagen sagte ein junger Mann aus Mali zu mir auf Deutsch: »Europa bringt uns die Probleme.«
Die europäischen Staaten tragen Mitverantwortung für die Folgen von Kolonialismus und Kaltem Krieg und praktizieren stillschweigend Formen des Neokolonialismus.
Wenn wir heute demonstrieren, dann tun wir das womöglich in einer Kleidung und in Turnschuhen und mit Smartphones in der Tasche, von denen ein Großteil unter Bedingungen gefertigt worden ist, die gerade jene Verhältnisse reproduzieren, die wir zu Recht anprangern und die der Grund für die Flucht vieler Menschen nach Europa ist, deren Nutznießer aber wir sind. Als engagierter Bürger und bewusster Konsument lässt sich einiges tun. Aufs Ganze gesehen braucht es dazu aber politische Lösungen. Ein Anfang wären juristisch verbindliche Kontrollen von Lieferketten und sozialen Standards.
Vergleichsweise einfach, weil innerhalb der EU zu lösen, sollte die Frage von EU-Agrarsubventionen sein, die sogenannten Flächenprämien, die Exporte zu Preisen ermöglichen, bei denen afrikanische Produzenten nicht mithalten können. Beispielsweise gingen 2017 42 Prozent der EU-Exporte an Geflügelfleisch in Staaten südlich der Sahara. Statt bei uns in eine ökologische Landwirtschaft zu investieren, werden bei uns Böden und Grundwasser kontaminiert und in Entwicklungsländern die einheimische Landwirtschaft erdrückt.
Ich spreche jetzt nicht noch vom Klimawandel oder vom Waffenexport, aber Fluchtursachen und unser Way of life sind zwei Seiten einer Medaille. Die Bekämpfung von Fluchtursachen beginnt bei uns. (Das Nationale lässt sich nicht vom Internationalen trennen.) Es gibt keinen Globus für Deutschland, und es gibt auch keinen für Europa.
Keine Organisation könnte wirksamer Fluchtursachen bekämpfen als die Europäische Union. Aber nicht mal die Seenotrettung im Mittelmeer ist noch selbstverständlich. Was nützen offene Grenzen wenn gleichzeitig Milliarden Euro aufgewendet werden, um gerade ein Erreichen der EU-Grenzen zu verhindern. Wer es doch bis hierher schafft, ist fast ausnahmslos traumatisiert. Ehrlicher wäre es, die Ausgabe humanitärer Visa zu verlangen. Das aber macht das Problem offensichtlich. Die Flucht ist eine Notlösung. Wenn wir uns nicht weiter in einer Festung Europa verschanzen wollen, müssen wir die Bekämpfung der Fluchtursachen endlich ernst nehmen.
Ein hoffnungsvolles Zeichen, aber auch noch nicht mehr, geht von den Museen aus, insbesondere den französischen. Die Provenienzforschung, die wissen will, unter welchen Bedingungen Kulturgüter in die Museen gelangt sind, um sie gegebenenfalls zurückzuführen, könnte ein Vorbild für alle Bereiche der Gesellschaft abgeben: Wir müssen fragen, woher die Dinge kommen, die unser Leben angenehm machen, und unter welchen Bedingungen sie entstanden sind. Wir müssen auf Transparenz und Aufklärung bestehen. Es braucht diese Selbstaufklärung, wollen wir uns ernsthaft gegen Nationalismus, Rassismus und Neokolonialismus stellen.
Statt aber Geld dafür bereitzustellen, wird nicht nur der Rüstungsetat der einzelnen Länder drastisch erhöht, die EU ihrerseits will ab 2021 fast sieben Milliarden jährlich für Rüstung ausgeben. Schon heute übersteigen die Rüstungsausgaben von Deutschland und Frankreich zusammen die von Russland um ein Drittel. Waffen lösen keine Konflikte, diese Lektion sollten wir gelernt haben.
Ich breche an dieser Stelle ab, auch wenn ich noch gern sagen möchte, dass ich mir ein von der EU initiiertes öffentlich-rechtliches Facebook und Google wünsche. Wir dürfen Edward Snowden und Julian Assange nicht vergessen, ihnen gilt unsere Solidarität.
Ich habe vor knapp dreißig Jahren erlebt (und dabei mitgemacht), wie sich ein System beiseiteschieben ließ, das auf jeden Ernstfall vorbereitet schien, aber dessen Sprache und Denken so verkrustet waren, dass es die Realität nicht mehr wahrnehmen und reagieren konnte. Wer ein Mal erfahren hat, dass sich die Welt verändern lässt, hält dies auch ein zweites Mal für möglich. In diesem Sinne: Wir sind das Volk! We are the people!