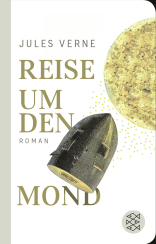
Die Zukunft von gestern
Was haben Jules Verne, Professor Haber und Alufolie gemeinsam? Lektor Hans Jürgen Balmes über die Zukunft von gestern – passend zum Jubiläum der Mondlandung.
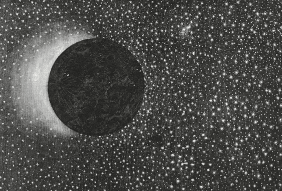
In den Sechzigern war die Zukunft schwarz-weiß und kam mit einem silbrigen Glanz. Und die Zukunft war noch so nah, morgen schon, im Jahr 2000, würde es Städte unter Wasser geben, die Autos würden schweben, wir würden uns von Fisch ernähren. Alles wäre elektrisch, und wir könnten das Wetter manipulieren. Professor Heinz Haber, das streberhafte Orakel im Anzug mit stets gezücktem Bleistift, war im Fernsehen so etwas wie die technisch-optimistische Version dieser Science-Fiction, der so fundamentale Fragen beantwortet wie: »Was sucht der Mensch im Weltall?« – Antwort: »Erkenntnisse.« Das Wetter, davon war er fest überzeugt – und spielte dabei mit seinem Bleistift, der wahrscheinlich gelb gewesen ist, und den er just jetzt verlor –, wird der Mensch gestalten können, in dem er in die »Wettermaschine« eingreift. Sein Satz läuft jetzt als Endlosschleife auf dem PCs der Chemtrail-Fans. Der Wissenschaftler als Regenmacher, die alte Magie als Kult.
Toni, mein Klassenkamerad, und ich, wir verpassten keine Sendung von Professor Haber und hatten drei Wetten laufen: Erstens: Wer schafft die meisten Karl May-Bände? Er kam mindestens bis auf 56, damals gab es 72, ich schaffte nur die Hälfte. Zweitens: Wessen Rakete fliegt höher? Tonis, meine hob erst gar nicht ab. Und Nummer drei: Wer schafft zuerst alle Bände von Jules Verne? Das waren viel weniger als die von Karl May, was man in der Stadtbücherei gleich erkannte, denn die Werkausgaben standen nebeneinander. Hier lag ich zeitweise in Führung.
Das Aufregendste war aber, wie alles – die Raumfahrt, das Wettrennen zum Mond und die Apollo-Landung, Professor Haber und Karl May – miteinander zusammenhing: Jules Verne war der Schmelztiegel. Wir konnten alle amerikanischen und russischen Raketen aufzählen, kannten die mögliche Transportlast, mit wie vielen Antriebsdüsen und Stufen die Dinger, hoch wie der Kölner Dom, gespenstig sich aus den Steppen Russlands und den Sümpfen Floridas erhoben. Die amerikanische Drei-Stufen-Rakete Saturn 5 war der Trumpf in jedem Kartenquartett. Das war Abenteuer, das war Karl May, das war Professor Haber, aber vor allem war es Jules Verne, der unsere Träume mit einer einfachen Mechanik versah, die so direkt anschaulich war wie unsere Werkbänke im Keller, auf denen wir Zeitungspapier mit Chemikalien tränkten, sie dicht und fest an schmalen Röhren zwischen Alufolie rollten und hofften, die »Feststoffrakete« werden über die Baumgipfel des Wäldchens hinterm Haus, unserem Cap Canaveral, hinausstoßen und vielleicht sogar in einem Bogen im Fluss »wassern«. Wie echte Raketen.
Und Jules Verne? Statt Rakete eine Kanone – noch besser! Ein Projektil, abgeschossen aus einem riesigen Rohr. Statt der Apollo-Kapsel eine von dem Projektil gezogene fliegende Raumlokomotive. Darin ein gepolsterter Salon, in dessen Fauteuils man Karl May lesen konnte. Zwei Hunde an Bord, die man auf dem Mond aussetzen wollte. Einen mit dem vielsagenden Namen Trabant wirft man dann unterwegs durch die Luke, um die Lebensbedingungen im All zu studieren. Als plattgedrückter Kadaver wird er das Projektil verfolgen, er wird buchstäblich zum Trabanten. Was uns sofort an den russischen Hund Laika erinnerte, der ersten Raumfahrerin aller Zeiten, die noch jahrelang in ihrer Kapsel im All kreiste, bis sie im April 1958, vier Monate nach meiner Geburt, beim Wiedereintritt in die Atmosphäre verglühte. Die russische Briefmarke mit ihrem Bild war damals in jedem Album zu finden.
Und es gibt eine Fülle überraschender Details, die die amerikanische Mondexpedition 100 Jahre nach Verne bestätigen sollten: Etwa der Augenblick, in dem die Schwerkraft des Mondes übernimmt und die Raumfahrer wieder auf die Füße stellt, ein entscheidender Punkt der ganzen Geschichte, denn sonst hätte auch die Apollo nie genug Treibstoff an Bord gehabt. Dass es eisig kalt ist im All. Wer Jules Vernes »Von der Erde zum Mond« und »Die Reise um den Mond« liest, findet immer wieder solche prophetisch den Physikbüchern entlang imaginierte Momente, die Toni und ich im Nachklang von Professor Haber auf dem Schulhof diskutierten. Und warum der Exkurs über Florida mit der Landkarte im Text, wenn nicht die Saturn von hier aus später die Apollo-Kapsel ins All trägt? Jules Verne hatte alles vorhergesehen.
Der geniale Navigator, der bei Jules Vernes die Positionen der Gestirne intuitiv bestimmt – das war Toni, der nach Frankreich ging, und lange bevor Computer in jedem Haushalt standen, Mathematik mit dem neumodischen Nebenfach Informatik studierte. Der Deep-data-mining machte, lange bevor man wusste, was das ist, und wir unsere Daten dazu freiwillig im Netz zur Verfügung stellten. Auch die Wette hatte er gewonnen, während ich immer noch über dem Gedruckten hocke.
Die Zukunft wurde unsichtbar, nanomäßig in Chips verpackt. Doch vor 150 Jahren, bei Jules Verne, ist sie aus Kupfer, sie riecht nach Schmieröl, sie wird mit Dampf und Hämmern betrieben. Die Mechanik liegt außen sichtbar wie bei einer Lokomotive auf der Karosse, das Auge kann sie erkennen, die Hand greifen. Jules Verne Antrieb war es, die Träume wie die Ängste der Menschen beim Anreißen des sich beschleunigenden Fortschritts Stück für Stück aus dem Regal zu nehmen und einen nach dem anderen zu prüfen. Und fiktiv ihre Erfüllung zu imaginieren – die Reise zum Mond, die Entdeckung der Vorzeit unserer Erde, eine Reise um die Welt in einem Luftschiff, ein Leben unter Wasser.
Die wundersame Mechanik, mit der Jules Verne diese Träume und Sehnsüchte umsetzte, verleihen seinen Zukunftsträumen heute einen nostalgischen Sepiaton. Die grotesken Maßstäbe, der Glaube der Ingenieure, alles sei machbar, die unmittelbare Anschaulichkeit – das alles grenzt in seiner Übertreibung an die Magie des Regenmachens. Und hier liegt die imaginative Kraft Jules Vernes. Er machte aus dem 19. Jahrhundert einen Bilderduden der wissenschaftlichen Einblicke, Ängste und Sehnsüchte, die noch heute unseren Blick auf die Zukunft antreiben. Dabei ertappt er uns manchmal. Ein anderes Mal sind seine Vorschläge in ihrer Absurdität so brillant, dass man sich vor Lachen kringelt – vor allem, wenn man die zeitgenössischen Illustrationen betrachtet, die die Höhepunkte des Textes in Pointen bannen. Ach, hätte die Zukunft von den waghalsigen Abenteuern seiner Kupferstiche aus nur einem anderen Weg genommen! Professor Haber verliert schon wieder seinen Bleistift.
-
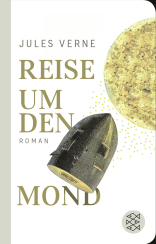 50 Jahre Mondlandung - Wo waren Sie, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 21. Juli 1969 um 3.45 Uhr MEZ als erste Mensc ...
50 Jahre Mondlandung - Wo waren Sie, als Neil Armstrong und Buzz Aldrin am 21. Juli 1969 um 3.45 Uhr MEZ als erste Mensc ...
