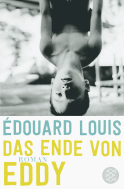
Aus der Werkstatt
Édouard Louis’ Debüt ›Das Ende von Eddy‹ löste in Frankreich eine große Debatte über Homophobie aus. Zurzeit überträgt Hinrich Schmidt-Henkel, Übersetzer unter anderem von Michel Houellebecq, Yasmina Reza und Louis-Ferdinand Céline, den Roman ins Deutsche. Ein kleines Gespräch aus seiner Werkstatt.
Lieber Hinrich Schmidt-Henkel, Sie übersetzen gerade den Debütroman ›Das Ende von Eddy‹ von Édouard Louis aus dem Französischen ins Deutsche. Was hat Sie für das Buch eingenommen?
Es hat eine ganz eigene Qualität: Emotional bringt das Buch die Leser an den Jugendlichen Eddy ganz nah heran, es ist alles sehr eindringlich erzählt – und zugleich schafft Édouard Louis etwas sehr Reifes, nämlich einen untersuchenden Draufblick, fast soziologisch, aber ohne alle Trockenheit und ohne die Emotionalität zu schmälern.
Wer ist Eddy?
Eddy ist ein Junge mit einer untypischen schwulen Lebensgeschichte. Gewöhnlich merkt einer, dass da »was ist«, er stellt fest, worum es sich handelt, kämpft damit und darum, es zu leben, gegen äußere Widerstände, und zieht irgendwann Freunde und Familie ins Vertrauen. Hier wird ein kleiner Junge, dem gar nichts klar ist, von seiner proletarischen Familie und den anderen Bewohnern des Dorfs in der Picardie schon sehr früh als schwul erkannt, gemobbt, misshandelt. Er muss es niemandem mehr erzählen, aber er muss mit sich selbst darum kämpfen, sich zu akzeptieren, gegen den immensen homophoben Druck, den er erlebt.
Was hat Sie am meisten überrascht während der Lektüre?
Die handwerkliche Sicherheit, mit der Édouard Louis das Erzählerische und das Reflektierende miteinander verbindet. Ihm gelingt eine Perspektive, in der die Figuren nicht denunziert werden, selbst diejenigen nicht, die dem Kind Eddy Schlimmes antun. Und: Es wird vollkommen unerheblich, was davon der reale Édouard Louis erlebt hat und was nicht; die Authentizität des Romans speist sich aus dem Text heraus und muss nicht biographisch beglaubigt werden.
Wie nähern Sie sich der Sprache des Romans?
Édouard Louis mischt viel gesprochene Sprache in den Roman, das bestimmt seine Atmosphäre. Sie bricht in den Erzählfluss ein, auf eine sehr markante Weise. Wie immer bei mündlicher Sprache gilt es, ein glaubwürdiges Äquivalent zu finden, ohne zu grob oder zu fein zu werden. Und da, wo es eher betrachtend wird, darf die Sprache nicht zu abstrakt sein, ein gewisses Echo von soziologischem Denken ja, aber nichts Knöchernes.
Wie gehen Sie in Ihrer Arbeit konkret vor?
So wie immer: Eine erste Gesamtlektüre, dann in der alltäglichen Arbeit erst im Kopf vor-übersetzen von zwei bis vier Seiten und Recherche. Dann dieselbe Passage schriftlich übersetzen und überarbeiten, am nächsten Tag die Portion des Vortags erneut redigieren und weiter übersetzen; vor der Abgabe eine Endredaktion – und dann noch zwei Durchgänge: einen mit der Lektorin und die Fahnenkorrektur.
Wie finden Sie Inspiration, wenn Sie an einer Stelle nicht weiterkommen?
Pause machen. Die Szene spielen – gerade, wenn es um die mündlichen Passagen geht, hilft es, die Figur ganz konkret darzustellen und zu schauen, welche stimmigen deutschen Worte sie aus der jeweiligen Situation und Aussageabsicht heraus verwenden könnte. In Ausnahmefällen: zurückstellen. Oft klärt sich etwas bei der Redaktion am nächsten Morgen, dann bin ich noch nahe genug dran, um genau zu wissen, dass ich gestern schon mit der Stelle nicht restlos im Reinen war, aber bereits weit genug entfernt, um mich nicht mehr darin zu verhakeln, sondern neu denken zu können.
Haben Sie einen Lieblingssatz?
Die beiden letzten.
Wie sieht Ihr Arbeitsplatz aus?
Ich übersetze meist am Schreibtisch, aber ich bin auch viel unterwegs und kann überall konzentriert arbeiten, zum Beispiel im Wartezimmer beim Arzt oder im Zug.
Und wohin fällt Ihr Blick, wenn Sie aus dem Fenster schauen?
Auf eine Berliner Straße, also nicht nur Mauern, sondern auch Bäume, oder auf einen Garten in Brandenburg: Gras, Kiefern, Wasser.
Sind Sie eigentlich in Kontakt mit dem Autor Édouard Louis?
Ich habe mich ihm per Mail vorgestellt, wie ich es immer mache, wenn ich einen neuen Autor übernehme, und habe ihn auf einem Kurztrip nach Paris auch getroffen. Ich war neugierig und voller Bewunderung für sein Können und für seine Lebensleistung. Der Autor ist ja noch wahnsinnig jung.
Während des Übersetzens habe ich immer wieder Fragen, die ich ihm per Mail stelle und die er sehr hilfsbereit beantwortet.
Welche Leser wünschen Sie dem Roman?
Ich freue mich darauf, das Buch dem Sohn unserer besten Freunde zu zeigen. Er ist mit meinem Lebensgefährten und mir aufgewachsen, als »Patentunten«, so unsere Eigenbezeichnung. Er hat uns schon vor Jahren nach unseren konkreten Lebenswegen ausgefragt, ein kluger und sensibler 15-Jähriger. Und ich wünsche mir, dass der 16-jährige junge Mann, der mit seinem Schwulsein ringt und der jüngst im ZEIT-Magazin porträtiert wurde, es liest, und viele in seiner Situation. Das Tolle aber ist, dass ›Das Ende von Eddy‹ kein Roman nur für ein schwules Publikum ist. Er zeigt den erschütternden und mitreißenden Kampf eines jungen Mannes erst gegen – dann für sich selbst.
