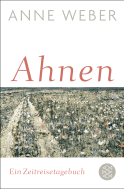
»Der Weg in die Vergangenheit liegt vor uns«
Ein Interview mit Anne Weber über ihr Buch ›Ahnen‹, ihren Urgroßvater Florens Christian Rang und deutsche Vergangenheit und Gegenwart.
Nach dem Liebesroman ›Tal der Herrlichkeiten‹ wendest du dich in deinem neuen Buch ›Ahnen‹ deiner Familie und vor allem deinem Urgroßvater Florens Christian Rang zu. Was waren deine Beweggründe für dieses sehr persönliche Buch und was war das für ein Mensch, dieser Florens Christian Rang?
Auf den ersten Blick mögen diese beiden Bücher nicht viel miteinander zu tun haben; auf den zweiten durchaus. Man kann sicher ›Tal der Herrlichkeiten‹ einen Liebesroman nennen, aber es ist auch und vor allem eine Orpheus-Geschichte; die Geschichte eines Mannes, der sich aufmacht in das Reich der Toten, um die verlorene Geliebte wieder zu den Lebenden zurückzuholen. Wer sich mit Vergangenheit beschäftigt, mit Menschen, die vor uns gelebt haben, begibt sich in gewisser Weise auch in ein Reich der Toten. Er kommt zwar nie wirklich an, die Vergangenheit entzieht sich ihm immer wieder. Aber indem er ihre Schriften liest, ihre Bilder anschaut, etwas über ihre Zeit herausfindet, macht er sich auf den Weg zu den Toten und versucht, sich ihnen anzunähern.
Mein Urgroßvater Florens Christian Rang war ein durchaus faszinierender Mann. Eigentlich ist das Erstaunliche nicht so sehr, warum ich mich näher mit ihm beschäftigen wollte, als vielmehr, warum ich das nicht schon früher getan habe. Wenn ich auf die Frage: Was war das für ein Mensch?, eine einigermaßen einfache und bündige Antwort wüsste, hätte ich sicherlich dieses Buch nie geschrieben. Natürlich gibt es ein paar Anhaltspunkte: Er ist 1864 in Kassel geboren, war nach einem Jura-Studium zunächst im preußischen Staatsdienst, verließ seine Stelle aber schon bald wieder und studierte später noch Theologie, war einige Jahre Pfarrer in zwei Dörfern in der Umgebung von Poznań/Posen. Aber auch diesen Beruf ertrug er nicht lange. Er war mit Walter Benjamin, Martin Buber und Gershom Scholem befreundet, korrespondierte mit Hofmannsthal. Er war ein gelehrter Mann und hat viel geschrieben, über Shakespeare, Kleist, Cervantes, über das Christentum, über die Ursprünge des Karnevals. Sein Nachlass liegt seit einigen Jahren im Walter Benjamin Archiv in Berlin. Er scheint ein leidenschaftlicher, unruhiger, zerrissener Mensch gewesen zu sein. Das sind aber nur Anhaltspunkte, mit deren Hilfe allenfalls eine Art Phantombild eines Menschen zustande kommt. Alles Weitere entsteht in der Bewegung hin zu dem Mann und seiner Zeit, die dieses Buch abbildet.
Es geht in dem Buch nicht nur um deinen Urgroßvater, sondern um insgesamt vier Generationen einer deutschen Familie bis zur Gegenwart. Es geht also etwa auch um deinen Großvater, der ein überzeugter Nazi war. Was bedeutet dieser Großvater für dich?
Nichts. Und zugleich sehr viel. Genauer gesagt: Ich bin diesem Großvater nie begegnet, hatte kein persönliches Verhältnis zu ihm. In diesem Sinne bedeutet er mir nichts. Was eine Bedeutung für mich hat, vielmehr, was ich als eine Art Fluch empfinde, ist die Tatsache, wie Millionen Deutsche einen ehemaligen Nazi zum Großvater zu haben (zwei sogar, in meinem Fall). Als Deutsche nach dem Nationalsozialismus geboren zu sein, solche Großväter im Rücken zu haben: ja, das hat eine Bedeutung für mich. Welche genau, das ist es unter anderem, was ich mit erzählerischen Mitteln in ›Ahnen‹ zu erforschen versuche. Wie setzt sich die Vergangenheit in der Gegenwart fort? Wie beeinflusst sie mein Verhältnis zu anderen? Wie hat sie sich auf die deutsche Sprache gelegt?
Straße in Posen, Anfang des 20. JahrhundertsMein Vorhaben war nicht, den soundsovielsten Nazi-Großvater-Roman zu schreiben. Im Mittelpunkt dieses Buches steht mein Urgroßvater, Florens Christian Rang. Aber dieses Buch ist kein historischer Roman, in dem eine Epoche ganz abgekapselt von den darauffolgenden dargestellt würde, sondern die Geschichte einer Reise in die Vergangenheit. Diese Reise führt notgedrungen auch über die nachfolgenden Generationen; ich konnte das Dazwischen nicht einfach überspringen. Auf dem Weg zu meinem 1924 gestorbenen Urgroßvater stellte sich immer wieder die jüngere deutsche und Familien-Vergangenheit in den Weg. Ich konnte darüber nicht hinwegsehen und mich in meinen Nachforschungen auf die Kaiserzeit beschränken.
Schon in deinem Buch über August, den Sohn Goethes, hat dich die Auseinandersetzung mit einer historischen Figur zu einer ungewöhnlichen Form geführt: einem ›bürgerlichen Puppentrauerspiel‹. ›Ahnen‹ ist nun laut Untertitel ein ›Zeitreisetagebuch‹. Was ist damit gemeint – und was hat die Wahl dieser Form mit dem Thema der ›Ahnen‹ zu tun?
Was du Untertitel nennst, ist von mir gedacht als eine Genre-Bezeichnung. So wie auf den meisten literarischen Büchern ›Roman‹ oder ›Erzählung‹ steht, steht bei mir manchmal etwas wie ›Puppentrauerspiel‹ oder ›Zeitreisetagebuch‹. Um einem Missverständnis vorzubeugen: diese Bezeichnungen sind von mir bildlich gemeint. Das Puppentrauerspiel ist nicht zum Aufführen mit Marionetten gedacht: Die Puppen sind nichts anderes als die von mir wieder zum Leben erweckten Toten. ›Ahnen‹ ist kein Tagebuch im üblichen Sinne mit Unterteilungen, die mit Daten versehen sind, sondern ein durchgehend geschriebener Text. Er hat trotzdem etwas von einem Tagebuch insofern, als er von einer Erkundungsreise in die Vergangenheit erzählt und als in dieser Erzählung die Dinge in der Reihenfolge vorkommen, in der ich auf sie stoße.
Der Untertitel oder vielmehr das Genre weist auf eine Frage hin, die mich viel beschäftigt hat, schon bevor ich mit dem Schreiben anfing: Wie kann ich umgehen mit Figuren, die nicht frei erfunden sind, mit Gestorbenen? Die Form von ›August‹ und auch von ›Ahnen‹ ist, eben weil beide Bücher wirkliche Menschen heraufbeschwören, aus einer Grundüberlegung und Haltung hervorgegangen, die man vielleicht moralisch nennen könnte. Ich konnte mir nicht vorstellen, August in einer modernen oder in einer pseudo-altertümlichen Sprache sprechen zu lassen. Um jeden historischen Realismus, der doch nur falsch sein kann, zu vermeiden, musste ich einen Kunstraum erfinden, in dem die Toten auftreten können, und eine Kunstsprache dazu. August redet meistens in gereimten Versen.
Die Figuren, die in ›Ahnen‹ auftauchen, stehen mir sowohl zeitlich als auch persönlich näher, es sind meine direkten Vorfahren. Ich glaube nicht, dass einem Schriftsteller im Umgang mit seinen Figuren alles erlaubt ist, doch gibt es in diesen Fragen keine Regeln. Jeder muss selbst herausfinden, was ihm, man könnte sagen, moralisch möglich und was unmöglich ist, wenn er nicht will, dass sich etwas Falsches im Ton einschleicht. Die Antwort, die ich in ›Ahnen‹ darauf gefunden habe, heißt: kein festes Bild dieser Toten zu zeichnen, sondern eines, das in Bewegung bleibt. Eine Reise zu erzählen.
Auch in ›August‹ geht es ja immer wieder um die Frage nach der Beziehung von Vergangenheit und Gegenwart, fremder Zeit und Biographie einerseits und einem heutigen Ich andererseits, das durch das Schreiben bei aller unhintergehbaren Fremdheit und historischen Distanz doch so etwas wie Nähe herstellen will. Würdest du sagen, dass diese Frage in ›Ahnen‹ nochmals radikaler gestellt wird?
Sie stellt sich hier anders und ausdrücklicher, weil die Vergangenheit, um die es in ›Ahnen‹ geht, eindeutig in die Gegenwart hineinragt. Die Goethe-Zeit kann vielleicht wie eine geschlossene, für sich stehende Einheit betrachtet werden, obwohl sich natürlich in Wirklichkeit auch diese Zeit bis in die unsere fortsetzt. Aber die Verbindungen sind viel undeutlicher geworden, zu viel Trennendes steht dazwischen. Von meinem Urgroßvater hingegen trennen mich nur ein paar Jahrzehnte, es gibt in der Familie weitergegebene Erinnerungen an ihn und seine Frau, es gibt ein Erbgut, das ich in mir trage. Ich habe vielleicht Ähnlichkeiten mit diesem Mann.
Das Trügerische gerade der nicht sehr fernen Vergangenheit ist, dass ein Mensch, der sich gut mit ihr auskennt, ein Historiker etwa, sich der Illusion hingeben kann, er wisse, wie es damals war. Je länger ich mich mit der Zeit meines Urgroßvaters beschäftigt habe, umso mehr merkte ich aber, dass ich das nicht wissen kann. Ich kann zwar zum Beispiel schreiben: Mein Urgroßvater war ein sehr gläubiger Mann. Dieser Satz stimmt in gewisser Weise, aber er erfasst nicht, was der Glaube ihm war. Er gibt mir die Illusion, zu wissen, mit wem ich es zu tun habe, doch letztlich ist mir das, was Glaube ihm bedeutete, gar nicht mehr zugänglich. Der Glaube ist verschwunden aus meiner Umgebung, und was davon übriggeblieben ist, hat sich gewandelt in einem mir unvorstellbaren Maße. Und doch verwenden wir weiter dasselbe Wort dafür. Im Grunde ist es aber, als wäre mir ein sechster Sinn verlorengegangen.
Aus diesen Überlegungen schloss ich, dass ich von der Vergangenheit nicht »so, wie sie war«, also in festen Umrissen würde berichten können, sondern dass ich nur meine Bewegung zu ihr hin würde erzählen können. Daraus ergab sich die Form einer Art Reiseerzählung. Während ich an dem Buch schrieb und also schon unterwegs war auf meiner Reise, entdeckte ich, dass diese Vorstellung von Vergangenheit ziemlich genau übereinstimmt mit der von Gustav Landauer, einem Zeitgenossen und Bekannten meines Urgroßvaters. Für ihn gibt es die Vergangenheit gewissermaßen zweifach; einmal in ihrer abgeschlossenen, unzugänglichen Form (»wie es einmal war«), die aber nicht mehr Wirklichkeit ist. Und es gibt sie als Weg, der vor uns liegt, wenn wir beginnen, uns mit ihr zu beschäftigen. Diese zweite Vergangenheit ist nichts Starres, Fertiges, sondern etwas Werdendes, sie verändert sich mit unserem Fortschreiten, sie ist unser Weg.
Dein Buch macht tatsächlich mit jedem Satz deutlich, dass die Vergangenheit nicht als etwas Abgeschlossenes, Gegebenes hinter uns liegt, in das man sich einfühlen könnte. Vielmehr liegt sie vor uns und entfaltet sich überhaupt erst durch unser Fragen und Erzählen. Trotzdem die Frage: Gibt es nicht doch so etwas wie Einfühlung in vergangene Personen oder gar Epochen für dich?
Als Bewegung, als Elan, ja, aber diese Bewegung kennt kein Ende, kein Ankommen. Die Bewegung des Einfühlens und Hineindenkens, wie ich sie verstehe, umfasst verschiedenartige Anstrengungen. Natürlich beruht sie zunächst einmal auf Wissen über die vergangene Zeit, auf einer eingehenden Beschäftigung mit Zeitdokumenten.Tagebuchseite aus dem Jahr 1895 (c) Florens Christian Rang Archiv im Walter Benjamin Archiv, Akademie der Künste, Berlin. Eine Vorbedingung ist Lesen, in Bibliotheken sitzen, Archive konsultieren, studieren. Auch das langwierige Entziffern von Handschriften ist Teil dieser Bewegung; ich habe es auch als das allmähliche Entziffern eines Menschen erlebt. Aber es kommt noch etwas anderes hinzu. Ich glaube, es muss etwas geben, was uns zu einem in der Tiefe der Vergangenheit verschwundenen Menschen hinzieht, was uns anrührt oder für ihn erwärmt oder Fragen aufkommen lässt. Der anfangs genannte Elan entsteht nicht aus bloßem Interesse für einen besonderen Menschen, sondern aus einer Bewegung des Herzens. Eine solche Herzenserwärmung können sicherlich auch einzelne Momente der Geschichte – eher als ganze Epochen – hervorrufen.
Die Epoche, für die dein Urgroßvater steht, ist kulturgeschichtlich ja das, was man Moderne nennt: In der Moderne, könnte man sagen, wird noch leidenschaftlich mit Gott gerungen, permanent brechen Existenz- und Sprachkrisen aus, man denkt und träumt groß bis größenwahnsinnig, alles ist voller Pathos und Emphase. Zwischen dir – du bist 1964 geboren, hundert Jahre nach deinem Urgroßvater – und dieser stets aufs Ganze zielenden Emphase der Moderne liegt nicht nur der Nationalsozialismus, sondern zum Beispiel auch die Postmoderne, die den ganzen Ernst und Größenwahn der Moderne mit guten Gründen »dekonstruiert« hat. Trotzdem hat dieser Ernst eines Florens Christian Rang auch etwas sehr Faszinierendes. Gibt es aus deiner Sicht überhaupt noch einen Zugang zu dieser Seite der Moderne?
Ich halte es lieber mit einzelnen Menschen und überlasse den Geistes- und Kulturwissenschaftlern das Denken in Begriffen, kulturgeschichtlichen Epochen und Generationen. In den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts gab es das Pathos und den Größenwahn meines Urgroßvaters und einiger anderer, es gab aber auch gleichzeitig so unemphatische Schriftsteller wie Kafka und Robert Walser, es gab die Dadaisten. Ich weiß nicht ganz, wie die Kulturhistoriker es machen, um aus all dem ein einheitliches Bild einer Moderne zu schaffen.
Was mich am meisten befremdete, aber auch anzog, als ich anfing, mich mit Florens Christian Rang zu beschäftigen, war tatsächlich sein tiefer Ernst. Es kommt mir so vor, als sei diese Art des Ernstes – vermutlich mit dem Glauben – aus unserer Welt verschwunden. Ist das bedauerlich? Ist es zu begrüßen? Ich bin in dieser Frage – wie in vielen anderen – noch zu keinem endgültigen Ergebnis gekommen. Eigentlich neige ich eher dazu, das Verschwinden dieses grabernsten Tons mit Erleichterung aufzunehmen. Könnte es in einer unernsten Gesellschaft etwas wie Fanatismus und Massenmord geben? Andererseits: Würde ohne tiefen Ernst überhaupt noch Gewaltiges entstehen?
Ich habe in keiner der vielen Schriften Florens Christian Rangs auch nur eine einzige Stelle gefunden, in der er Humor, eine gewisse Leichtigkeit oder Ironie an den Tag gelegt hätte. Fast scheint es – aber dieser Eindruck trügt sicherlich, er ist nur aus schriftlichen Zeugnissen gewonnen –, als hätte dieser Mensch nie gelacht. Als habe er in jeder Sekunde seiner Existenz die Bürde der »ganzen Menschheit und Gottheit« zu tragen gehabt. Es war ihm nicht vergönnt, irgendetwas leicht zu nehmen. Allein das rückt ihn mir in eine fast unüberwindliche Ferne.
Für mich ist ›Ahnen‹ in seiner Bewegung der unendlichen Annäherung, in seinem Suchen und fragenden Erzählen auch ein im besten, reflektiertesten Sinne romantisches Buch. Kannst du mit diesem Begriff der Romantik etwas anfangen?
Ja, es könnte schon sein, dass mein Ansatz in diesem Buch eine gewisse Ähnlichkeit mit romantischen Vorgehensweisen hat. Dafür spricht schon die Tatsache, dass das Buch eine Mischform ist, es hat erzählerische, dialogische, aber auch reflexive Elemente, es enthält Zitate, es kommentiert. Dieses formal Uneindeutige, Heterogene könnte ein romantisches Erbe sein. Da ist auch das resolut Subjektive des Blickwinkels; die Tatsache, dass ich keine einheitliche, von außen betrachtete Gesamtheit anstrebe. Auch der tagebuch- oder reiseberichtartige Charakter der Erzählweise hat womöglich eine entfernte Verwandtschaft mit dem Unvollendeten, dem Im-Werden-Begriffenen, Progressiven, was die romantische Dichtung kennzeichnet. Und noch etwas könnte von einer romantischen Tradition herrühren, nämlich der Selbst-Kommentar. Während das Buch noch im Entstehen ist, wird schon darüber nachgedacht. Das Nachdenken über die Erzählung und über deren Verwirklichung wird Teil der Buches. All das habe ich natürlich nicht bewusst eingesetzt, ich habe mir nicht gesagt: Jetzt schreibst du mal was, was an die Romantik anknüpft. Aber im Nachhinein sehe ich schon gewisse Verbindungsstellen.
Kommen wir von der Romantik zum Thema Deutschland und Deutschsein. Walter Benjamin hat Florens Christian Rang ja als den »tiefste(n) Kritiker des Deutschtums seit Nietzsche« bezeichnet. Wie siehst du Rangs Deutschsein, und inwiefern hat dich die Reise auf den Spuren des Urgroßvaters mit deinem eigenen Deutschsein konfrontiert?
Dieses Zitat ist zunächst mal sehr beeindruckend. Dass mein Urgroßvater, die Hauptfigur meines Buches, von Benjamin in einem Atemzug mit Nietzsche genannt wurde, hat mich anfangs sehr eingeschüchtert und schüchtert mich immer noch ein. Dann ist da dieses merkwürdige Wort, »Deutschtum«, das nach dem Zweiten Weltkrieg ausgestorben ist. Ich habe wissen wollen, was Menschen einmal darunter verstanden haben und ob es eventuell heute noch eine Bedeutung haben kann. Was heißt es, Deutscher zu sein? Was hieß es vor hundert oder hundertzwanzig Jahren, zu Lebzeiten meines Urgroßvaters? Was hieß es im Nationalsozialismus? Und was heißt es heute? Es ist ein Wort, das im Laufe der Zeit durchaus unterschiedliche Bedeutungen hatte. Florens Christian Rang und Walter Benjamin verstanden darunter wohl etwas wie das innerste Wesen des deutschen Menschen. Einige ihrer Zeitgenossen verwendeten es eher im Sinne von »deutsche Vorherrschaft«, und in diese Richtung hat sich das Wort dann auch weiterentwickelt, bevor es ganz aus unserem Vokabular verschwunden ist.
›Ahnen‹ stellt auf erzählerische Weise, in Gesprächen zum Beispiel, die ich mit anderen – Franzosen, Polen, Juden – habe, die Frage nach dem Deutsch-Sein heute. Wie lebt man mit der Bürde dieser Vergangenheit – denn eine Bürde ist es in jedem Fall, ob man sie nun leugnet oder verdrängt oder ob man mit ihr lebt.
Eine der schockierendsten Stellen im Buch ist ein Brief deines Urgroßvaters nach dem Besuch einer psychiatrischen Anstalt, in dem Rang – wohlgemerkt als Pfarrer – die Ideologie des lebensunwerten Lebens aufgreift und für Euthanasie plädiert. Wie geht man mit solchen Zeugnissen um, wenn man weiß, wie die Geschichte nach Rangs Tod 1924 weiterging? Ist spätestens an dieser Stelle nicht jede Annäherung oder Einfühlung unmöglich?
Die Passage, von der du sprichst, vermittelt den Eindruck, als läge hier, zu Anfang des 20. Jahrhunderts, der Ursprung alles Späteren, als gäbe es eine eindeutige Kontinuität zwischen den Generationen, zwischen meinem Urgroßvater und einem seiner Söhne, meinem Großvater. So, wie du diese Stelle allerdings zusammenfasst, stimmt sie in meinen Augen nicht. Eben weil diese Zusammenhänge sich nicht zusammengefasst und verkürzt wiedergeben lassen, ohne falsch zu werden, habe ich dieses Buch schreiben müssen. Du sagst: Er hat die Ideologie des lebensunwerten Lebens aufgegriffen und für Euthanasie plädiert. Ich sage: Das stimmt so nicht, und ich könnte das jetzt erläutern. Aber im Grunde muss man das Buch lesen – nicht um zu wissen, »was stimmt« oder »wie es wirklich war«, sondern um sich auf diesen Mann zuzubewegen, sich dem anzunähern, was er vielleicht gewesen sein könnte. Ich habe versucht zu erkunden, in welcher besonderen Lebenssituation er gesteckt hat, als er diesen schrecklichen Satz über das Vergiften von Verrückten gesagt hat – es ist ein Satz, das muss man auch wissen, inmitten einer Fülle von Schriften. Er hatte spät noch Theologie studiert und war Pfarrer in einem Dorf im preußisch regierten Teil Polens geworden, aber auch in diesem Beruf konnte er nicht zur Ruhe finden. Er sah die schreckliche Armut der Dorfbevölkerung, und er sah, dass er den Menschen nicht helfen konnte, dass sie seine seelische Hilfe nicht wollten oder brauchten, sondern etwas zu essen. Er war in großer Verzweiflung an jenem Tag, als für ihn und andere Pfarrer ein Besuch in einer psychiatrischen Anstalt organisiert wurde; er war kurz davor, auch diesen Pfarrerberuf wieder hinzuwerfen. Bei dem Besuch ist er zutiefst schockiert von dem, was er dort sieht.
Es geht mir weder darum, irgendetwas zu entschuldigen oder zu beschönigen, noch gibt es in diesem Buch irgendwelche Verurteilungen. Aber man kann eine solche Äußerung nicht für sich, ohne jeden Zusammenhang verstehen, man kann sie wahrscheinlich überhaupt nicht verstehen, aber man kann immerhin erkunden, aus welchen Bedingungen heraus sie entstanden ist. Der Mann, um den es hier geht, war einer, der tief unter dem menschlichen Elend litt, von dem er sich umgeben sah. Können wir dasselbe wirklich von uns behaupten? Das sollten wir uns überlegen, bevor wir ihn für einen Satz verurteilen.
Ich habe natürlich auch versucht, herauszufinden, wie es mit Florens Christian Rang weiterging, worauf seine geistige Entwicklung zulief. Nach dem Ersten Weltkrieg hat er ein Buch mit dem Titel ›Deutsche Bauhütte‹ geschrieben, in dem er für einen geistigen Wiederaufbau Deutschlands plädiert. Dieser geistige Wiederaufbau sollte mit dem materiellen Wiederaufbau der zerstörten Nachbarländer Frankreich und Belgien beginnen. Jeder einzelne Deutsche sollte aufstehen und sich am Wiederaufbau der von deutschen Soldaten verwüsteten Gebäude beteiligen, und das in einer Zeit, in der ganz Deutschland empört war über die von den Siegern geforderten Reparationszahlungen! Das neue Deutschland sollte auf dem Gewissen jedes Einzelnen aufgebaut sein.
Natürlich waren diese Ideen über das »lebensunwerte« oder »lebensunfähige« Leben in der Luft in jenen Jahren. Florens Christian Rang war, glaube ich, trotzdem kein Mann, der einfach irgendwelche Ideologien aufgriff. Ich habe versucht, ihm in diesem Buch halbwegs gerecht zu werden – in ein paar Sätzen ist das, glaube ich, ganz und gar unmöglich.
Deine Erkundungsreise hat dich auch ins heutige Polen geführt, wo dein Urgroßvater eine Zeitlang Pfarrer war. Wie hast du Polen erlebt? Ich frage deshalb, weil das Buch ja nicht zufällig in Polen endet und der Text ausgerechnet in Polen am Ende von so etwas wie Versöhnung träumt.
Ich habe mich im Buch besonders auf die Jahre konzentrieren wollen, in denen mein Urgroßvater im damals preußisch regierten Teil Polens lebte, also auf die Jahrhundertwende. Und zwar, weil mir schien, dass Polen gewissermaßen symbolhaft für das steht, was mich von ihm trennt (die 30er und 40er Jahre). Würde ich meinem Urgroßvater in einem wie auch immer gearteten Reich der Toten begegnen und er würde mich fragen, was denn passiert sei in seiner Welt, seit er sie verlassen hat — würde ich da nicht zuerst auch über Polen sprechen müssen?
Ich bin also nach Polen gereist, und zwar erst am Ende meiner zu Hause begonnenen Vergangenheitsreise, weil ich zunächst alle möglichen Dokumente studieren wollte. Ich habe verschiedene Orte aufgesucht, wo Florens Christian Rang gelebt hat: Posen, das Dorf Połajewo. Ich habe versucht, die ehemalige »Irrenanstalt« ausfindig zu machen, die er 1903 oder 1904 besichtigt hat, die Kirche, in der er gepredigt hat. Ich habe mit Menschen gesprochen. Mit lauter freundlichen, hilfsbereiten Menschen. Zu meinem Erstaunen bin ich nie auf Ressentiments den Deutschen gegenüber gestoßen. Und trotzdem lebt in jenen Polen, denen ich begegnet bin, die Vergangenheit sehr lebendig weiter; auch in dem Bild der Deutschen, das sie haben. Einmal sagte ich einem Mann, der mir vorgestellt wurde, ein paar polnische Worte, die ich gelernt hatte. Darauf antwortete er mit den paar deutschen Worten, die er kannte: »Hände hoch!« »Nicht schießen!« »Verfluchte polnische Schweine!« Oder ich habe zum Beispiel erfahren, dass die deutsche Redewendung »Ordnung muss sein« als Ausdruck in die polnische Sprache eingegangen ist, etwa wie »Mamma mía« in die deutsche. Bei aller Freundlichkeit kommt doch immer wieder durch, wie tief sich der deutsche Terror bei ihnen eingegraben hat. Ich habe allerdings auch erlebt, dass die Polen auch heute noch die Geschichte der polnischen Juden nicht wirklich als Teil ihrer eigenen Geschichte ansehen. Zumindest schien es mir so nach meinem Besuch im Museum für Stadtgeschichte in Poznań/Posen.
Das Buch endet in Polen, und zwar mit der Totenfeier, mit Allerseelen, wie es in Polen begangen wird. Es endet in der Frage, ob jeder ›seine‹ Toten hat, und damit meine ich nicht nur seine verstorbenen Angehörigen. Ich stelle die Frage, ob die Heutigen, wie ihre Vorfahren, in verschiedene Lager zerfallen. In das Lager derer, die in deutschem Namen Verbrechen begangen haben, und jener anderer, die diese Verbrechen erlitten haben. Ist das unser ewiger Fluch?
Wie bei allen deinen Büchern hast du auch eine französische Fassung geschrieben, die in Frankreich, wo du lebst, ebenfalls in diesem Frühjahr unter dem deutschen Titel ›Vaterland‹ erscheint. Glaubst du, dass du ein solches Buch über Deutschland und deine Familie nur aus der französischen Distanz heraus schreiben konntest? Und was bedeutet dir gerade bei diesem Buch die Möglichkeit einer deutschen und französischen Rezeption?
Wer im Ausland lebt, wird ständig mit dem Bild konfrontiert, das die anderen von den Deutschen haben, und mit der Zeit fängt er selbst an, die eigenen Landsleute und damit auch sich selbst von außen zu betrachten. Man fragt sich: Habe ich selbst etwas von diesen Charakterzügen, die den Deutschen zugeschrieben werden? Ist an dem Klischee etwas dran? Und auch: Sind es besagte Charakterzüge, die das Schlimme ermöglicht haben? Man fängt an, sich selbst argwöhnisch zu beäugen. Es kann schon sein, dass dieses Buch nie entstanden wäre, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Jedenfalls wäre es sicher ganz anders ausgefallen.
Dass die französische Ausgabe einen deutschen Titel trägt, kommt daher, dass mein französischer Verlag, Seuil, gerne schon im Titel zu verstehen geben wollte, dass es in dem Buch um Deutschland und um die deutsche Geschichte geht. So kam ich auf die Idee, einfach ein deutsches Wort zu nehmen. Natürlich hätte ich das deutsche Buch nie ›Vaterland‹ genannt. Im Deutschen ist das Wort unverwendbar geworden. Aber auf einem französischen Cover sieht es für mich ganz anders aus, ungefähr, als hätte ich es in Anführungszeichen gesetzt. Auch werden die Franzosen ja nicht Vaterland sagen, sondern Watèrelande. Und auf diese Weise ist etwas von meinem Blick von außen im Titel enthalten.
Was die Rezeption angeht: Es wäre mir sehr lieb, wenn dieses Buch ins Polnische und vielleicht ins Hebräische übersetzt würde. Aber natürlich bin ich froh über die französische Fassung. Und ich merke jetzt schon, noch bevor das Buch erschienen ist: Bei den Verlagsleuten von Seuil bin ich noch mit keinem Buch auf so großes Interesse und helle Begeisterung gestoßen. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es sich dabei um einen Blick auf die deutsche Vergangenheit und Gegenwart handelt.
Interview: Sascha Michel
