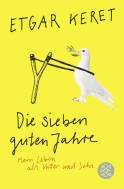
Ein überwältigendes Staunen
Etgar Keret, der Meister der Kurzgeschichte, wendet sich mit seinem neuen Buch von der Fiktion ab und seinem eigenen Leben zu. Warum? Wir wollten es genau wissen.
Ein Gespräch mit Etgar Keret über ›Die sieben guten Jahre‹
Sie haben den Moment der Geburt Ihres Sohnes Lev als den Beginn der »sieben guten Jahre« beschrieben: Sie seien aufgewühlt gewesen, konnten aber nicht verstehen, warum. Was an diesem privaten Moment hat Sie dazu gebracht, nach fünf Erzählbänden Ihr erstes »Sachbuch« zu schreiben?
Ich glaube, es hatte damit zu tun, wie das Baby mich ansah. Als Neugeborener war sein Blick erfüllt von überwältigtem Staunen. Mir ist klar, dass die Art, wie ich den Ausdruck auf seinem Gesicht interpretierte, absolut subjektiv ist, aber ich empfand es so, als ob er mich als seltsames Wunder betrachtete – als er ob sagen wollte, »Wer ist dieser merkwürdige Mensch?« Diese Erfahrung, wahrgenommen zu werden, hat mich völlig überrascht, und weil mein Baby auch ein Stück von mir ist und nicht ein ganz »Anderer«, fühlte ich mich, als ob ich mich durch seine Augen zum ersten Mal selbst sehen konnte. Als ich mich an diesem Abend zum Schreiben hinsetzte, sagte ich mir, der Grund, warum ich das aufschrieb, sei, dass ich nun ein Vater war und es ein nützlicher »historischer« Bericht werden würde, den mein Kind lesen konnte, wenn es erwachsen sei. Aber im Rückblick war das nicht der Grund, warum ich darüber schrieb. Ich schrieb, weil seine Existenz es mir zum ersten Mal ermöglichte, mich selbst von außen zu sehen.
Sie beschreiben das fiktive Erzählen stets als einen sicheren Ort, der ein Moment von Freiheit ermöglicht: Dank den Freiheiten der Phantasie kann man ein paar Meter über dem Boden der Tatsachen schweben, die viel zu traurig und schrecklich deprimierend sind. Und dieses Schweben gibt Ihnen die Möglichkeit, Dinge auf den Kopf zu stellen, verkehrt herum zu zeigen, und damit komische und gar groteske Effekte zu erzielen. Jetzt, da Sie ein Sachbuch geschrieben haben: was ist da anders?
Von diesem sicheren Ort ist das neue Buch so weit wie nur möglich entfernt. Es ist sehr viel einfacher für mich, mein Leben zu leben, ohne darüber zu reflektieren. Aber wenn man das tut, kann man von den Momenten, in denen man an seinen eigenen Erwartungen scheiterte, nicht mehr absehen. Die Reflexion lässt einen dieselben Situationen noch einmal erleben, aber in einem anderen, wahreren Licht
Das Buch erscheint auf Ihren Wunsch hin nur im Ausland, nicht in Israel. Sie arbeiteten so lange an der englischen Fassung der Texte, bis die amerikanische Ausgabe für Sie zum Original wurde, das nun Ihr Freund Daniel Kehlmann ins Deutsche übersetzt hat. Befürchten Sie, dass es aufgrund der privaten und persönlichen Szenen im Buch in Israel zu viele Missverständnisse gäbe?
Der Vater meiner Frau ist in Israel aufgrund seiner Kindergedichte sehr berühmt. Er schrieb viele Gedichte über meine Frau, und als Kind hasste sie die Tatsache, dass völlig Fremde persönliche Details von ihr wussten: die Farbe ihres Schlafanzugs, den Namen ihres Teddybären. Das Gefühl, so etwas unfreiwillig ausgesetzt zu sein, wollte sie unserem Kind ersparen. Und weil das Buch wirklich sehr privat ist, schlug sie vor, dass ich es nicht auf Hebräisch veröffentlichen solle, und ich war sofort einverstanden.
Vielen israelischen Lesern fällt es jedoch schwer, das zu akzeptieren. Die Tatsache, dass das Buch in zwanzig Sprachen erscheint, darunter Farsi, aber nicht in meiner Muttersprache, ist etwas, dass sie als kulturellen Verrat empfinden. Das stimmt mich traurig. Aber da ich das Schreiben als einen Akt der Freiheit sehe, finde ich es auch gleichzeitig wunderbar, auf mein Herz hören zu können, ohne um Erlaubnis fragen zu müssen. So erhalte ich mir die Freiheit, die ich durch mein Schreiben auch in der realen Welt habe.
Die Eckpunkte Ihrer Familiengeschichte – sie sind das Kind von Holocaust-Überlebenden – verlangen einen anderen Ton als Ihre Geschichten. Nahm Ihre Mutter an ›Die sieben guten Jahren‹ genauso viel Anteil wie an Ihren bisherigen Arbeiten?
Die Idee, dieses Buch zu veröffentlichen, kam mir erst sehr spät beim Schreiben. Am Anfang habe ich es nur als zufällige Ansammlung von persönlichen Reflexionen gesehen, die ich aus einem inneren Zwang heraus aufschrieb. Meine Familie erfuhr erst nach der Fertigstellung von diesem Buch.
Meine Mutter ist sehr froh darüber. Als Überlebende des Holocaust betrachteten sie und mein Vater unsere Familie als ihren größten Erfolg. Beide mussten als Kinder alles geben, um den Krieg zu überleben. Ihr größter Wunsch war es, einen Partner zu finden, der sie lieben würde, und die Geburt eigener Kinder zu erleben. Diese Dinge schienen während des Krieges wie ein weit entfernter Traum, und sie empfanden sehr viel Stolz und Glück darüber, dass sie sich ihren Traum erfüllen konnten. Da mein Buch von unserer Familie handelt, sieht mein Mutter es als ein »Dokument« an, das diesen Erfolg besiegelt.
Bei Ihnen als Überlebender der zweiten Generation vermischen sich Geschichte und Familienleben auf ganz unerwartete Weise. So etwa in dem Text ›Marmelade‹. Diese Marmelade hätte eigentlich Ihre Mutter vor der Vernichtung des Warschauer Ghettos essen sollen. Jetzt treffen Sie in Warschau eine Frau, die ihnen ein Glas ebendieser Marmelade überreicht. Schmeckte die Marmelade bitter oder tröstlich?
Es war Waldbeerenmarmelade, und die Tatsache, dass ich in Warschau Dinge aß, nach denen meine Mutter sich damals nur hatte sehnen können, war sehr tröstlich. Es gab mir das optimistische Gefühl, dass man sich mit der Vergangenheit versöhnen kann, nicht nur als Individuum, sondern auch als Familie, ja als ganzes Geschlecht.
Wie ist Ihr Bezug zu dem Buch, nun da es lediglich auf Englisch und in anderen Übersetzungen erhältlich ist? Wenn Sie die Entfernung des Texts zu Ihrem Schreibtisch messen könnten: Ist er für Sie weiter weg als die Kurzgeschichten, die Sie auf Hebräisch veröffentlicht haben?
Er ist weiter weg, und ich bin froh und dankbar dafür. Ich stelle oft fest, dass ich ehrlicher und ernsthafter bin, wenn ich mit einem völlig Fremden im Flugzeug Englisch spreche. Manchmal erlaubt einem eine solche Distanz die Freiheit, man selbst zu sein.
Sie haben eine eigene Theorie darüber, welcher Grad an Vorstellungskraft für verschiedene Kunstformen nötig ist: im Film werden neunzig Prozent der Imagination vom Regisseur und den Produzenten geliefert und nur zehn Prozent vom Publikum. Bei Prosa schätzen Sie den Anteil des Autors generell auf siebzig Prozent und den des Lesers auf dreißig Prozent. Für Ihre eigenen Erzählungen setzen Sie einen exakt gleichen Prozentsatz von Kreativität, also 50/50, an. Wie schätzen Sie, wird die Verteilung bei ›Die sieben guten Jahre‹ sein?
Es wird sehr sehr nah am Satz für »Standard«-Prosa orientieren. Der Leser kann sich nicht so viel selbst vorstellen. Aber das erscheint mir richtig so, da Fiction auf der Imagination basiert, während Non-Fiction sich viel mehr damit beschäftigt, konkrete, real existierende Fakten zu reflektieren.
Die Leserschaft Ihres Buchs ist international und öffentlich, aber nicht Teil der unmittelbaren Öffentlichkeit Ihrer Nachbarschaft. Trotzdem wenden Sie sich auch an ein ganz bestimmtes Publikum, das nur aus einer einzigen Person besteht und in der Zukunft lebt: »Und ich hatte immer eine Ahnung, dass mein Sohn hundert Jahre alt würde und das Buch fände und es ihm vielleicht irgendwie helfen würde.«
Ich glaube, das war meine Ausrede dafür, das Buch zu schreiben, aber nun, da es fertiggestellt ist, kann ich egoistisch sein und zugeben, dass ich es weniger für ihn und mehr für mich selbst getan habe, damit ich mich selbst besser verstehen konnte. Andererseits habe ich es aber indirekt schon für ihn geschrieben, weil seine Existenz in mir den Wunsch ausgelöst hat, ein besserer Mensch und ein besserer Vater zu werden. Indem ich dieses Buch schrieb, lernte ich mehr über meine eigenen Schwächen und vielleicht auch darüber, wie ich mit ihnen zurechtkommen und versuchen könnte, sie zu ändern.
›Die sieben guten Jahre‹ enden mit dem Tod Ihres Vaters – eine Zäsur im Leben eines Mannes, der gleichzeitig Sohn und Vater ist. Haben Sie davon geträumt, dass Ihr Vater Ihre Geschichten liest?
Mein Vater hat meine Geschichten nicht gebraucht. Seine Liebe zu dieser Welt war so groß und vollständig, dass er nicht auf die Mühen und Kniffe angewiesen war, die sein Sohn benötigte.
Er sagte einmal zu mir, nachdem er einen meiner Erzählbände gelesen hatte: »In deinen Geschichten ist die eine Hälfte der Väter dumm und die andere tot. Aber in jeder einzelnen kann ich spüren, wie sehr du mich liebst.«
Könnte irgendein Mensch, irgendein Schriftsteller, sich einen besseren Vater als ihn wünschen?
Aus dem Englischen von Martina Wolff
Die Fragen stellte Hans Jürgen Balmes
