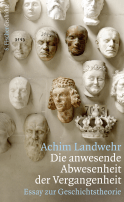
Fünf Fragen an Achim Landwehr
Zum diesjährigen Historikertag stellen wir fünf renommierten HistorikerInnen Fragen zur Geschichte und ihrer Wirkung. Achim Landwehr erzählt, was ihn an der Geschichtswissenschaft fasziniert und welches historische Sachbuch ihn zuletzt besonders beeindruckt hat.
1. Was kann Geschichte als Wissenschaft leisten, welche Funktionen hat die Geschichte (einerseits als Wissenschaft, andererseits als Bezug auf das Vergangene) heute?
Eine einfache Frage, die zwei Antworten verdient (und zwar Antworten, die ebenso dem wissenschaftlichen wie dem politischen Feld zugehören): Erstens hat Geschichtsschreibung nicht die Aufgabe – wie immer wieder zu lesen und zu hören ist –, der Orientierung, Identitätsbildung oder Versicherung über das »Wie wir wurden, was wir sind« zu dienen. Ganz im Gegenteil (und zweitens): Will historisches Arbeiten den eigenen Anspruch auf wissenschaftliches, kritisches und letztlich auch zukunftsfähiges Denken bewahren, dann muss sie viel eher zu Desorientierungen anleiten, Identitäten untergraben und zur Verunsicherung beitragen. Es muss an der Überzeugung gerüttelt werden, die Dinge seien ganz konsequent und fast schon natürlich so geworden, wie sie geworden sind. Stattdessen kann man aufzeigen, dass es auch immer anders sein konnte und sein kann.
2. Was fasziniert Sie an der Arbeit des Historikers, warum sind Sie Historiker geworden? Was wollen Sie als Historiker mit der Geschichte erreichen oder beitragen?
Früher hätte ich gesagt: An der historischen Arbeit fasziniert die irritierende Mischung aus Fremdheit und Vertrautheit vergangener Verhältnisse. Etwas später hätte ich dann wohl gesagt: An der Vergangenheit und ihrer historischen Bearbeitung begeistert die Möglichkeit zur Kritik der Gegenwart, vor allem mit Blick auf deren nicht zufälliges Gemacht-worden-Sein. Und ohne dass diese beiden Punkte an Bedeutung verloren hätten, würde ich inzwischen sagen: Historisches Arbeiten zeichnet sich durch die Behandlung der Frage aus, wie es einer Gegenwart gelingt, sich auf spezifische Art und Weise auf abwesende vergangene (und zukünftige) Zeiten zu beziehen. Historisches Arbeiten kann also nicht nur das Gewesene beschreiben, sondern die besonderen Zeitverhältnisse thematisieren, die durch Bezüge auf das Gestern und das Morgen entstehen.
Und was ich mit dieser wissenschaftlichen Arbeit erreichen will? Ganz ehrlich und ganz unbescheiden: Die Welt verändern. Im gelungenen Fall sollten Studierende aus meinen Lehrveranstaltungen und Lesende aus meinen Texten mit dem Eindruck herausgehen, dass sie zumindest einen Bruchteil dieser Welt mit anderen Augen sehen. Denn wir verändern die Welt unter anderem dadurch, dass wir sie anders beschreiben und anders denken. Bei meinem großspurigen Weltveränderungsanspruch muss daher immer der dazugehörige Beschränktheitsmodus mitgedacht werden. Denn selbst im Fall des Gelingens könnte ich wohl nur ein winziges Mosaiksteinchen dieser Welt in ein anderes Licht rücken. Aber zumindest auf diese Möglichkeit will ich nicht verzichten.
3. Wieso mischen sich so wenige HistorikerInnen in das Zeitgeschehen und in aktuelle Debatten ein? Kann die Vergangenheit uns überhaupt etwas über die Gegenwart lehren oder zur Analyse aktueller Probleme beitragen?
Sicherlich kann die Beschäftigung mit der Vergangenheit etwas zur Lösung aktueller Fragen beitragen. Ich würde sogar umgekehrt behaupten wollen: Jede Auseinandersetzung mit gegenwärtigen Problemen muss unweigerlich eine Auseinandersetzung mit deren Vergangenheit sein. Die Geschichte, die um ein aktuell anstehendes Thema herum erzählt wird, mag nur einige Wochen in das Frühere zurückreichen oder mag auf Jahrzehnte, gar auf Jahrhunderte ausgreifen. Eine grundsätzliche Frage stellt sich aber immer: Wie verbinden wir diesen gegenwärtigen Umstand mit abwesenden Zeiten? Mit welchen Versionen von Vergangenheit und Zukunft verknüpfen wir aktuelle Probleme? Und wenn man vom schnelllebigen Tagesgeschäft absieht, stellt sich alsbald die allgemeinere Frage, wie sich Gegenwarten überhaupt mit abwesenden Zeiten verknüpfen, also mit Zeiten, die uns aufgrund ihres Nicht-Mehr oder Noch-Nicht unzugänglich sind. Dieses Problem büßt niemals an Aktualität ein.
Da es sich also um eine unweigerlich gegenwartszentrierte Angelegenheit handelt, muss historisches Arbeiten gar nicht explizit aktuell sein. Das ist immer schon der Fall. Gegenteilige Auffassungen würden ja von der Idee ausgehen, dass sich Historikerinnen und Historiker „mit der Vergangenheit“ beschäftigten. Das tun sie natürlich nicht. Wie sollten sie auch, schließlich ist diese Vergangenheit vergangen. Sie beschäftigen sich mit all dem, was aus der Vergangenheit noch gegenwärtig vorhanden ist, um auf dieser Grundlage dem Problem nachzugehen, das ich gerade zu beschreiben versucht habe: auf welche Weise welche Relationen zwischen anwesenden und abwesenden Zeiten etabliert werden (Relationen, die ich als Chronoferenzen bezeichne).
Mir ist aber klar, dass die Frage eher auf die unmittelbare Beteiligung historisch arbeitender Menschen an aktuellen Debatten gerichtet ist. Hier kann ich nur mutmaßen. Es kann etwas zu tun haben mit einer gewissen Verweigerungshaltung gegenüber der medialen Verwertungslogik wissenschaftlicher Ergebnisse. Nicht selten geht es darum, recht komplexe Zusammenhänge auf ein verdauliches Maß herunterzukochen, und das geht meist nur durch Verzicht auf Komplexität. Es kann auch etwas zu tun haben mit der Verweigerung, in öffentlichen Debatten als wissenschaftliches Feigenblatt funktionalisiert zu werden. Soll heißen: Eine ohnehin schon vorgefertigte Meinung im Umfang von etwa drei Sätzen gilt es medial nur noch durch eine professorale Autorität zu bestätigen. Dabei muss man sich nicht gezwungenermaßen wohl fühlen.
Wenn ich auf wissenschaftliche Komplexität poche, bedeutet das aber gerade nicht, dass die Dinge so kompliziert sind, dass sie nur noch von Spezialisten verstanden werden können. Komplexität und Transparenz schließen sich keineswegs aus. Man kann in klaren Worten und klaren Gedanken darlegen, dass die Wirklichkeit ein paar Haken mehr schlägt, als wir zu tolerieren bereit sind. Aber bestimmte Formen der Aufmerksamkeitsökonomie bringen nicht mehr die Geduld für eine solche Komplexität auf. Man sollte die Dinge so einfach wie möglich machen, soll Einstein einmal gesagt haben – aber keinesfalls einfacher. In gewisser Weise holt uns also auch hier das Zeitproblem wieder ein, weil man dieses so schwer verständliche, aber von uns als kostbar erachtete Gut der Zeit einsetzen müsste, um sich manchen gegenwärtigen Problemen zu widmen. Wissenschaft und nicht-wissenschaftliche Öffentlichkeit kommen da nicht immer zusammen.
4. Welche Rolle spielt für Sie Narrativität in der Geschichtswissenschaft?
Dass in historischen (wie auch in anderen kulturwissenschaftlichen) Arbeiten erzählt wird, dass Erzählen nicht nur eine grundlegende Kulturtechnik, sondern auch eine wesentliche Erkenntnisform ist und dass gerade die deutschsprachige historische Forschung immer noch gut damit beraten ist, ihre scheinbar angeborene Furcht vor dem Erzählerischen abzulegen – das ist schon oft genug vorgebracht worden. Stilfragen sind immer auch Machtfragen, und die deutsche Wissenschaftskultur hat sich zum Teil einen Sprachduktus angeeignet, der nach dem Kir-Royal-Prinzip funktioniert: Wer reinkommt, ist drin. Gepflogenheiten in anderen Ländern zeigen, dass es auch anders geht.
Mit der Frage nach der Erzählbarkeit geschichtswissenschaftlicher Arbeit scheint mir aber nur ein Teil des Problems erfasst zu sein. Es geht in einem allgemeineren Sinn um Fragen der Form, um Möglichkeiten des Erzählens, Berichtens, Beschreibens und Darstellens in unterschiedlichen medialen Kontexten, die für die historische Arbeit bei weitem noch nicht ausgereizt sind. Bei Formen der Darstellung dürfen beispielsweise die Grenzen zwischen Kunst und Wissenschaft immer noch durchlässiger werden, so dass die reiche Formensprache künstlerischer Arbeiten den reichen Inhalten wissenschaftlicher Arbeiten zugute kommt – und umgekehrt. Nicht zuletzt intensiviert das Internet solche Diskussionen (auch wenn sie nicht von diesem Medium abhängen). Derzeitige Überlegungen und Versuche zu wissenschaftlicher Arbeit in sozialen Medien und in Blogs wie auch die Etablierung der Digital Humanities verweisen immer auch auf das Problem der Form wissenschaftlicher Präsentation.
5. Was wünschen Sie sich von einem historischen Sachbuch? Welches historische Sachbuch hat Sie zuletzt besonders beeindruckt und warum?
Überrumpelnde Irrelevanz! Vielleicht ist es das, was ich mir von Sachbüchern unterschiedlicher Couleur – ob historischer oder anderer Art – erwarten würde. Ich habe mit Büchern notorisch Probleme, die nur das Vorwissen und die Vorannahmen erfüllen, die ich ohnehin schon hatte. Im geglückten Fall handelt es sich entweder um ein Buch, das mir irrelevant erschien, weil ich schon alles über ein Thema zu wissen meinte, um dann doch vom Gegenteil überzeugt zu werden; oder es handelt sich um ein Thema, das mir aufgrund seiner Abseitigkeit irrelevant erschien, dessen Bedeutung mir aber nun vor Augen geführt wird.
Zuletzt wurde ich vom ersten Band der Briefe von Blaise Pascal in dieser Weise überrumpelt (Blaise Pascal: ›Briefe I. Die private Korrespondenz‹. Hg. v. Eduard Zwierlein, übers. v. Ulrich Kunzmann, Matthes & Seitz Berlin 2015). Briefe sind als Gattung ohnehin immer für Überraschungen gut, weil sie den vielzitierten Blick durch das Schlüsselloch gewähren. Auch hier gewinnt man Einblicke in die Gefühls- und Gedankenwelt des Mathematikers, Philosophen, Jansenisten, aber auch des Freundes und Familienmenschen mit all seinen Zweifeln, Beschwerlichkeiten und Hoffnungen. Einerseits muss uns das sehr fremd vorkommen, weil sich die Überzeugungen eines so tiefgläubigen Menschen nicht ohne weiteres aus dem 17. Jahrhundert in die Gegenwart transportieren lassen. Andererseits blitzt in dieser Fremdheit auch immer eine überraschende Gegenwärtigkeit auf, die zum Nachdenken und Fragenstellen anregt. Abgesehen davon ist diese Ausgabe auch noch hervorragend kommentiert. Daher: Buch kaufen und ein wenig Blaise Pascal in den eigenen Alltag lassen!
