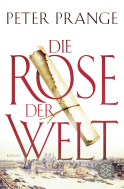
Interview mit Peter Prange

Interviewer: Herr Prange, Ihr Buch versetzt uns nach Paris, wo im Jahr 1200 mit Privileg des Königs die erste Voll-Universität der Welt gegründet wurde. Das scheint weit weg von uns zu sein. Weshalb geht es uns dennoch an?
Peter Prange: Die Gesellschaft, in der wir leben, ist eine Wissensgesellschaft. Wissen war noch nie eine so bedeutende Macht wie heute – die größten Konzerne der Welt sind bekanntlich Informations-, also Wissensunternehmen. Diese Entwicklung nahm mit der Gründung der ersten Universitäten ihren Anfang. Die Art und Weise, wie damals Wissen produziert und verbreitet wurde, hat die moderne Wissensproduktion und -verbreitung bis heute geprägt. Die Organisation von Forschung und Lehre, die Unterscheidung der Fakultäten, die akademischen Grade, die Internationalität der Scientific community – alles war damals schon da. Sogar Copy-Shops gab es bereits, zur preiswerten Vervielfältigung von Lehrmitteln.
Interviewer: Wie sind Sie auf das Thema Ihres Romans gekommen?
Peter Prange: Wie bei den meisten meiner Romane bin nicht ich auf das Thema gestoßen – vielmehr hat das Thema mich entdeckt. Ich recherchierte für eine ganz andere Geschichte, als ich bei dem französischen Mediävisten Jacques LeGoff ein paar Zeilen über einen Streik las, den die Studenten und Professoren der Pariser Universität im Jahr 1229 vom Zaun gebrochen und zwei Jahre lang durchgehalten haben, um ihre Rechte gegenüber Krone und Kirche zu behaupten. Ich war sofort elektrisiert.
Was mich hier angesprungen hatte, war nichts weniger als der erste Streik der europäischen Geschichte überhaupt!
Interviewer: Dieser erste Streik steht im Zentrum Ihres Romans. Worum ging es in diesem Machtkampf?
Peter Prange: Alles begann mit einer Wirtshausschlägerei im Karneval des Jahres 1229, im Pariser Faubourg Saint-Marcel. Aus den Quellen geht hervor, dass es zu Streitigkeiten bei der Bezahlung der Zeche kam. Es folgten tagelange Krawalle zwischen Studenten und Bürgern. Als Soldaten des Stadtpräfekten mehrere Studenten zu Tode prügelten, forderten die Magister die Obrigkeit auf, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen, oder sie würden in den Streik treten.
Interviewer: Was macht diesen Konflikt in Paris so besonders und zukunftsweisend?
Peter Prange: Als die Regentin und Königinmutter Blanka von Kastilien sich weigerte, die Forderungen der Magister zu erfüllen, spitzte der Streit sich sehr schnell zu einer sehr grundsätzlichen Frage zu: Wer hat die Rechtshoheit über die Universität und ihre Mitglieder? Die Krone? Die Kirche? Oder die Universität selbst? Durch den anschließenden Streik erstritten die Universitätsangehörigen grundlegende, zum Teil bis heute gültige Freiheitsrechte. Überspitzt könnte man sagen: Die Freiheit in Forschung und Lehre verdankt sich letztlich einer Pariser Wirtshausschlägerei aus dem Jahre 1229.
Interviewer: Kann man wirklich sagen, dass hier die Idee von der Freiheit des Denkens und der Wissenschaft erstmals formuliert wird?
Peter Prange: Der Streik endete 1231 mit einer Bulle des Papstes. Darin beschnitt Papst Gregor IX. die Zugriffsrechte der Krone auf die Universität und sicherte dieser zugleich ein erstaunlich hohes Maß an Selbstverwaltung zu. Diese Bulle gilt darum heute als die Magna Charta der Pariser Sorbonne – und zugleich als Magna Charta der akademischen Freiheitsrechte überhaupt.
Interviewer: Uns erscheint dieser Gedanke inzwischen selbstverständlich. Ist diese Freiheit wirklich durchgesetzt, sind die Konflikte tatsächlich Geschichte?
Peter Prange: Die Freiheit von Forschung und Lehre, ja die Freiheit des Denkens überhaupt ist eines der wichtigsten Güter, die eine moderne, aufgeklärte Gesellschaft auszeichnen. Doch sie ist alles andere als selbstverständlich, bis heute nicht. Quer durch die Jahrhunderte haben Kirche und Staat immer wieder versucht, Einfluss auf die Universitäten, sprich: die Produktion und Verbreitung von Wissen zu nehmen, um sie für ihre Zwecke zuinstrumentalisieren. Eines der spektakulärsten Beispiele ist der Fall Galilei, dessen Weltbild nicht in das der Kirche passte – das Ende ist bekannt.
Solche Auswüchse gibt es bis in die Neuzeit. Unter der Naziherrschaft wurde in Deutschland arische, in der DDR marxistisch-leninistische „Wissenschaft“ betrieben. Heute kommt neben Kirche und Staat noch eine dritte Macht vermehrt ins Spiel: die Wirtschaft, die durch Vergabe sogenannter „Drittmittel“ Einfluss auf Forschung und Lehre zu nehmen sucht. Kurz: Die akademische Freiheit ist ein Gut, das es immer wieder aufs Neue zu beschützen gilt, wenn wir nicht Gefahr laufen wollen, dass die Suche nach Wahrheit und Erkenntnis für wie auch immer geartete Ideologien missbraucht wird...
