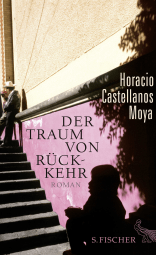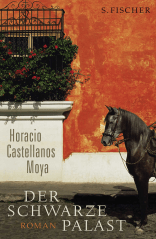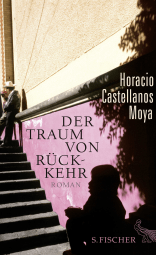
Der Traum von Rückkehr
Castellanos Moya ist der bedeutendste und engagiertes ...
Michi Strausfeld spricht mit dem salvadorianischen Schriftsteller Horacio Castellanos Moya über Flucht und Rückkehr und über seine Bekanntschaft mit Roberto Bolaño.
Der Protagonist Ihres letzten Romans (›Der Traum von Rückkehr‹), Erasmo Aragón, lebt im Exil in Mexiko, weil er vor dem Bürgerkrieg in El Salvador fliehen musste. Wie viele Menschen verließen damals ihre Heimat?
Während der 80er Jahre gab es eine enorme Emigration wegen des Bürgerkriegs. Die Mehrheit ließ sich in den USA nieder – heute lebt dort etwa ein Viertel der Bevölkerung, viele andere flohen nach Mexiko, Kanada und Australien. Die beiden letztgenannten Länder hatten damals ein aktives Hilfsprogramm für Flüchtlinge aus El Salvador. Das Hauptausfuhrprodukt des Landes sind seine Menschen. In Wirklichkeit werden sie vertrieben, weil El Salvador nicht die bescheidensten Bedingungen für das Überleben garantiert.
Sie selbst waren auch bedroht, mussten flüchten, lebten in vielen Ländern, u.a. zwei Jahre in Frankfurt im Programm »Städte der Zuflucht«. Wie lange sind Sie schon »on the road«?
Ich war mehrmals im Exil. Das letzte Mal verließ ich El Salvador 1997, um nie mehr dort zu leben. Ich wurde bedroht wegen der Publikation eines schmalen Romans, ›El asco. Thomas Bernhard in San Salvador‹ – ›Der Ekel. Thomas Bernhard in San Salvador‹. In den letzten Jahren bin ich einmal pro Jahr für wenige Wochen zurückgekehrt. Aber wieder dort zu leben kann ich mir zur Zeit nicht vorstellen.
Das Exil macht Erasmo Aragón krank, er fühlt sich verfolgt, hat Wahnvorstellungen, schlimmste Erinnerungen, von denen er nicht weiß, ob sie geträumt oder wahr sind. Macht Exil krank?
Natürlich. Das Exil schafft neue Möglichkeiten, aber auch Unglück. Wenn man gezwungen ist, sein soziales Umfeld zu verlassen, beeinträchtigt das den Menschen. Es erzeugt Probleme der Zugehörigkeit, der Identität, psychische und emotionale Störungen. Das Gefühl von Verlust, das Heimweh, die Sehnsucht nach einer Rückkehr, all das führt zu krankhaften Befindlichkeiten. Nach verschiedenen Exilerfahrungen in mehreren Ländern und Kontinenten fühle ich mich wie ein Teilchen, das nicht mehr in die Maschine passt. Ich kann mich an eine Stadt, an ein Land gewöhnen, aber niemals habe ich das Gefühl dazuzugehören. Mein Gefühl von Zugehörigkeit findet nur in der Erinnerung statt.
Sind persönliche Erfahrungen von Ihnen oder Freunden in den Roman geflossen? Leben Exilanten immer ein wenig in der Vergangenheit, in der Heimat?
Ja, es gibt Erinnerungen und Erfahrungen, die in den Roman hineingeflossen sind, aber sie wurden den Bedingungen der Fiktion untergeordnet. Damit will ich sagen, sie sind der Rohstoff, aber während des Schreibvorgangs wird er verändert, verwandelt sich in etwas anderes, je nach den Anforderungen der Erzählung.
Aragón möchte zurück, unbedingt, aber er hat auch Angst davor. Ist die Rückkehr »sicher« für ihn oder muss er befürchten, die Vergangenheit nehme ihn dort psychisch und physisch sogleich wieder gefangen? Er ist hin- und hergerissen. Ist auch dies symptomatisch?
Zwischen zwei Fronten zu stehen, ist typisch für einen Exilierten, vor allem bei Aragón, der unter fragwürdigen Bedingungen in sein Land zurückkehren möchte, denn der Bürgerkrieg ist ja noch nicht beendet. Die Illusion einer Rückkehr ist immer sehr stark. Und im Falle Aragóns vermischt sie sich mit einer anderen, ebenfalls starken Illusion: dem Wunsch, ein neues Leben anzufangen. Aber natürlich hat er Angst, denn die Anführer des Bösen bewegen sich weiterhin frei in seiner Heimat. Diese innere Spannung, die aus dem Widerspruch zwischen Begeisterung und Furcht entsteht, kann sehr destruktiv sein, vor allem, wenn sie sich mit viel Alkohol verbindet, wie bei ihm.
»Nach-Bürgerkriegs-Gesellschaften« sind höchst problematisch – oft wird der Krieg nur mit anderen Mitteln weiter geführt. Gilt das auch für El Salvador?
In El Salvador gab es eine recht erfolgreiche politische Lösung, die in langen Verhandlungen vereinbart wurde. Die beiden sich bekämpfenden Gruppierungen stimmten einem demokratischen Prozess zu. Nach ihren Erfolgen bei den Wahlen ist die Ex-Guerrilla jetzt an der Macht – ein Beweis dafür, dass das politische System funktioniert hat. Das Problem liegt darin, dass sich die Violencia nur anders aufgestellt hat: sie ist nicht mehr politisch, sondern kriminell. Die tägliche Mordrate kann so hoch sein wie während des Krieges. Und der Terror dominiert unverändert den Alltag, die Kultur. Was man zuvor als politischen Krieg erlebt hat, erlebt man nun als Krieg gegen die Kriminalität. Es ist eine kranke Gesellschaft: Terror macht krank.
Ist ›Der Traum von Rückkehr‹ ein politischer Roman?
Jeder Roman ist politisch, auch wenn er dies nicht beabsichtigt. ›Der Traum der Rückkehr‹ behandelt vor allem die psychischen und emotionalen Probleme eines Intellektuellen im Exil, der in ein noch nicht befriedetes Land zurückkehren möchte. Die Politik darf nur im Hintergrund stehen.
Sie schreiben – so haben Sie einmal gesagt – »dialogische« und »monologische« Romane. ›Der schwarze Palast‹ war ein Roman voller Dialoge, dieser hier ist ein langer Monolog. Könnten Sie das etwas erläutern?
Das sind Dinge, die einfach mit einem geschehen, Talente, die mit den Sinnen zusammenhängen. Ich gehe beim Schreiben vom Gehör aus, und deshalb sind die Stimmen der Schlüssel meiner Ausdrucksmöglichkeiten. Ich kann den genauen Plan eines Romans entwickeln, mit einer zusammenhängenden Handlung und klar definierten Personen, aber ich muss die Erzählstimmen hören, sonst kann ich nicht mit dem Schreiben anfangen. Ich muss sie hören und fühlen, um der Geschichte Leben zu verleihen. Andere Autoren gehen vom Blick aus, für sie ist die Beschreibung das Wesentliche.
Sie zählen zur »Generation Bolaño«, jenen Autoren, die in den 50er Jahren geboren wurden. Kannten Sie ihn? Können Sie etwas über ihn und sein Werk sagen?
Ja, ich habe Roberto Bolaño kennengelernt, als ich einmal ein paar Tage in Barcelona verbrachte. Er lud mich ein, den Tag bei ihm in Blanes zu verbringen. Ein überaus intensiver und großzügiger Mensch. Er hatte einen begeisterten Artikel über meine Arbeit geschrieben (enthalten in seinem Band ›Entre paréntesis‹), bevor wir uns persönlich begegnet sind. Wir hatten mehrere gemeinsame Freunde. Er kam durch El Salvador, als er 1973 von Chile nach México unterwegs war - nach dem Staatsstreich von Pinochet. Ohne Zweifel ist er der bedeutendste Schriftsteller meiner Generation, hatte den größten Ehrgeiz, was die Bedeutung seines Werks angeht. Was uns verbindet ist auch die Tatsache, dass wir die letzte Generation lateinamerikanischer Autoren sind, die während des Kalten Krieges herangewachsen ist.
Dies ist Ihr elfter Roman. Viele von ihnen sind untereinander lose verbunden, vor allem durch die Personen – hier z.B. begegnen wir Don Chente aus ›Der Schwarze Palast‹ wieder. Leben Sie mit Ihren Figuren weiter?
Fünf Romane sind lose verbunden, weil Personen oder Angehörige der Familie Aragón vorkommen (›Aragóns Abgang‹ (dt. 2003, Rotpunkt), ›Desmoronamiento‹, ›Der schwarze Palast‹ (dt. 2008, S. Fischer,) ›La sirviente y el luchador‹, ›Der Traum von Rückkehr‹). Alberto Aragón ist z.B. in allen fünf Romanen präsent (mit ihm begann der Zyklus 2003), mal als Haupt-, mal als Nebenfigur. Und natürlich werden die Figuren zu einem festen Bestandteil im Leben des Autors, vor allem wenn er schreibt, aber auch in den Stunden der Muße, in denen neue Geschichten allmählich Gestalt annehmen.
Das Interview führte und übersetzte Michi Strausfeld