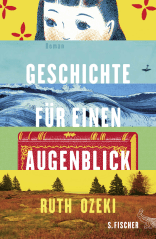
Schreiben nach dem Riss in der Zeit
Mit ihrer ›Geschichte für einen Augenblick‹ ist Ruth Ozeki ein ganz und gar gegenwärtiger und zugleich zeitloser Roman gelungen. Wir haben mit ihr über vorlaute Teenager im Kopf, Japan prä- und post-Tsunami, das Reale im Roman, Baby-Zen-Priester und Katzen gesprochen.

Eine der Hauptfiguren Ihres Romans ›Geschichte für einen Augenblick‹ ist die Schriftstellerin Ruth, die auf einer kanadischen Pazifikinsel lebt, genau wie Sie. Wie ist es da gerade? Schicken Sie uns eine Postkarte?
Seltsamerweise schneit es zurzeit. Sehr ungewöhnlich für diese Küstenregion. Es liegt fast ein halber Meter Schnee, und es schneit immer noch, in dicken, feuchten Flocken. Der Wald sieht wundervoll aus. Die dunkelgrünen Zedernzweige biegen sich unter dem Gewicht des Schnees, und die Kiefern sind weiß gepudert. Ich bin zur Post in Whaletown gelaufen und dann zum Anleger, um aufs Meer zu gucken. Das Wasser war dunkelgrau und kaum vom Himmel zu unterscheiden. Ich stand am Anleger und habe verfolgt, wie die Fähre die Insel umrundete und langsam durch den Schneeschleier näher kam. Es war wunderschön.
Drei Frauen stehen im Zentrum Ihres Romans – der japanische Teenager Nao, die bereits erwähnte Schriftstellerin Ruth, und Naos Urgroßmutter Jiko, eine buddhistische Nonne. Zwischen der fiktiven Figur Ruth und Ihnen gibt es einige Parallelen, aber wie steht es mit den anderen beiden, wie kamen sie ins Spiel?
Nao war die Figur, mit der alles anfing, dicht gefolgt von ihrer Urgroßmutter. Ruth kam erst viele Jahre später dazu. Sie war tatsächlich so etwas wie ein Nachklapp.
Naos Stimme habe ich zum ersten Mal im Dezember 2006 vernommen, als sie einfach so in meinen Kopf hereinplatzte und sich mir vorstellte: »Hallo! Ich heiße Nao, und ich bin Sein-Zeit, ich bin Sein, und ich bin Zeit. Weißt du, was das ist? Wenn du einen Moment hast, erzähl ich es dir.« Als ich diese Worte hörte, war mir schon einiges klar. Ich wusste, dass Nao ein japanisches Schulmädchen war, das in Tokio lebte. Ich wusste, dass sie schikaniert wurde und möglicherweise selbstmordgefährdet war und dass sie darüber in ihrem Tagebuch berichtete. Aber anders als andere Tagebuchschreiber schrieb sie nicht für sich, sondern richtete ihr Tagebuch an jemand anderen. Sie hatte das Gefühl, dass es da draußen irgendwo eine Person gab, die ihr Tagebuch eines Tages finden und lesen würde; also schrieb sie für diesen zukünftigen Leser. Natürlich konnte sie während des Schreibens nicht wissen, wer diese Person sein würde – genauso wenig wie ich, aber als Autorin wurde es meine Aufgabe, ebendies herauszufinden.
Mir kam zwar recht früh der Gedanke, dass möglicherweise ich diese Leserin sein würde – schließlich war Naos Stimme in meinen Kopf geplatzt –, aber ich verwarf diese Idee sehr schnell wieder, weil sie mir zu selbstbezogen, zu postmodern, zu metafiktional erschien. Stattdessen ließ ich eine ganze Reihe von unterschiedlichen Figuren für die Rolle vorsprechen. 2011 schloss ich einen Entwurf des Romans ab, in dem Naos Leser eine namenlose, eigenschaftslose, irgendwie kränkliche Person unbestimmten Geschlechts war, die sich in einer Bibliothek versteckte. Ich muss wohl nicht hinzufügen, dass das eine völlig andere Geschichte war als die, die Sie jetzt lesen können.
Als ich diesen Entwurf gerade meiner Lektorin zukommen lassen wollte, ereignete sich im März 2011 das Erdbeben von Tohoku vor der japanischen Küste. Ich verbrachte die folgenden Tage und Wochen damit, mir die schrecklichen Bilder des Tsunamis anzusehen, der ganze Städte hinwegspülte. Ich habe Freunde und Familie in Japan, in Tokio und Sendai, ganz in der Nähe des Epizentrums, und machte mir große Sorgen. Zum Glück war ihnen nichts passiert, aber als ich dann die Explosionen in Fukushima sah und die Katastrophe, die darauf folgte, wurden meine Sorgen plötzlich global.
Katastrophale Ereignisse dieser Größenordnung halten gewissermaßen die Zeit an oder verursachen einen Riss, der die Zeit in ein Vorher und Nachher teilt. In den Wochen danach dämmerte mir, dass sich die Welt verändert hatte, dass sich Japan verändert hatte und dass mein Buch nicht länger relevant war. Ich hatte ein Buch geschrieben, das prä-Erdbeben, prä-Tsunami, prä-Fukushima war, und mittlerweile lebten wir in einer Post-Erdbeben-, Post-Tsunami-, Post-Fukushima-Welt.
Ich zog das Buch zurück und überlegte, was zu tun war. Die Ereignisse hatten eine interessante Frage aufgeworfen: Wie konnte ich als Autorin von Fiktionen, mit den Mitteln der Fiktion, auf eine sich gerade erst herausschälende Realität reagieren, die so derartig real war.
Ich wollte das Buch nicht aufgeben, aber eine Lösung hatte ich nicht. Eines Tages unterhielt ich mich mit meinem Mann Oliver darüber, und er schlug vor, dass ich mich selbst in das Buch einschreiben sollte, als Naos Leserin. Er glaubte, dass mein Eintreten in den Roman es mir erlauben würde, unmittelbarer auf die Katastrophe zu reagieren. Damit würde ich gewissermaßen den fiktionalen Rahmen des Romans aufbrechen und der Realität Einlass gewähren.
Auf diese Weise wurde Ruth also Teil des Buches. Und Oliver übrigens auch, denn ich sagte ihm, wenn ich drin bin, musst du auch rein, und er hatte nichts dagegen. Er sah es als interessantes Gedankenspiel.
Nao sagt über ihr an einen unbekannten Leser gerichtetes Tagebuchschreiben: »Es ist, als würde ich in der Zeit vorgreifen und dich berühren, und jetzt, da du es gefunden hast, greifst du zurück und berührst mich!« Ist dieses Vorgreifen einer der Gründe, warum Sie schreiben? Wann entsteht eine Verbindung?
Ja … und nein. Eigentlich denke ich gar nicht an Leser, wenn ich schreibe. Wenn ich schreibe, bin ich meine einzige Leserin, und ich schreibe in diesem Augenblick für mich selbst, an mich selbst, und versuche zu verstehen, was ich zu sagen versuche. Aber wenn ich einen Schritt zurücktrete und die Praxis des Schreibens etwas allgemeiner betrachte, dann bin ich einer Meinung mit Nao. Der Akt des Schreibens/Lesens ist eine Art Zeitreise, man projiziert sich in die Zukunft oder in die Vergangenheit. Die alten Griechen glaubten, dass beim Zitieren eines toten Dichters es der Dichter selbst war, der sprach – dass er von den Toten zurückkehrte und sich die Zunge des Sprechers lieh. Ich mag dieses Bild sehr; da möchte ich sofort sämtliche Sonette Shakespeares auswendig lernen und sie Tag und Nacht aufsagen.
Das ist es, was Verbinden bedeutet, oder? Der Akt des Schreibens/Lesens ist eine umfassende Übung im Verbinden. Es ist ein bisschen so, als würde man einen Stromkreis schließen.
Ihr Roman ist wunderbar reich an Themen und bezieht sich auf die Gegenwart wie auf die Vergangenheit, seien es der Tsunami und die Katastrophe in Fukushima, Mobbing unter Teenagern oder die jungen Kamikazepiloten im Zweiten Weltkrieg. Gleichzeitig fühlt er sich sehr universell und fast zeitlos an. Sehen Sie einen Zusammenhang mit der buddhistischen Idee von uns als Sein-Zeit? Hier zu sein und gleichzeitig Teil von etwas Größerem zu sein, einem Kreislauf gar?
Ich bin froh, dass das Buch etwas Universelles und Zeitloses hat, ich glaube, darum geht es aller Literatur – darum, so etwas wie Ewigkeit oder Zeitlosigkeit aufscheinen zu lassen durch das Erzählen von ort- und zeitspezifischen Geschichten.
Ich glaube, das ist keine buddhistische Idee, ich halte allerdings auch das Konzept von Sein-Zeit nicht für sehr buddhistisch. Es ist einfach eine nackte, ungeschönte Beschreibung dessen, was wir sind; für jeden nachzuvollziehen, der einen Moment innehält und den Tatsachen ins Auge sieht. Wir sind einfach, hier, jetzt, jedenfalls für den Augenblick. Und irgendwann in der Zukunft werden wir nicht mehr sein. Es ist Common Sense, aber so unfassbar beängstigend, dass wir allerlei Ablenkungen ersonnen haben – Philosophie, Religion, Götter, Kapitalismus, Technologie, Fernsehsendungen –, die unseren Geist von der unbestreitbaren Tatsache unserer flüchtigen und endlichen Natur fernhalten sollen.
Aber was das Buch angeht, stimmt es schon, dass darin buddhistische Positionen zu Zeit und Sein gewissermaßen zur Aufführung gebracht werden. Und das schließt eine Idee von Zirkularität ein, von Phänomenen, die sich in Spiralen bewegen, sich wiederholen und verändern, wie die großen ozeanischen Strömungen und Strudel.
Über die Nonne Jiko finden Zen und die Praxis der Meditation Eingang in den Roman, und im wahren Leben sind Sie Zen-Priesterin. Wie passen Zen und Schreiben zusammen? In meinem laienhaften Verständnis erfordert Meditation, die Dinge sein zu lassen und den Moment anzunehmen, so wie er ist, während das Schreiben eines Romans etwas Fortschreitendes impliziert, es erfordert, dass man ordnet, bewertet, konstruiert. Wie sehen Sie das?
Na ja, ich sollte vielleicht vorausschicken, dass ich noch eine Baby-Zen-Priesterin bin, ein Priesterlein in Ausbildung sozusagen. Man sollte meine Äußerungen also nicht allzu ernst nehmen. Außerdem weiß ich nicht genau, was das »wahre Leben« sein soll oder wie man es von einem fiktiven unterscheidet.
Was Zen und das Schreiben angeht, sind die beiden vielleicht doch nicht so unterschiedlich. In der Zen-Praxis lernen wir zu sehen, dass die Erfahrung unseres Lebens aus unzähligen Geschichten gewebt ist, Geschichten darüber, wer wir zu sein glauben, was wir mögen und nicht mögen, was wir wollen und nicht wollen, über unsere Hoffnungen und Träume, unser Leid und unsere Enttäuschungen. Das sind die Themen der Erzählung, die wir unser Leben nennen. Das Gleiche gilt beim Schreiben von Romanen, mit dem Unterschied, dass wir hier die Geschichte gleich als Geschichte sehen. Und selbst wenn wir wissen, dass es nur eine Fiktion ist, sind wir nur zu gern bereit, unsere Skepsis ruhen zu lassen und die Geschichte als wahr zu erleben, wenigstens für die Dauer der Lektüre.
Ich glaube, Ihr Verständnis von Meditation ist richtig. Es geht darum die Dinge so zu sehen, wie sie sind, und sich in Akzeptanz zu üben: Ja, so sind die Dinge, jetzt, in diesem Augenblick. Aber die-Dinge-wie-sie-sind, dabei geht es vor allem um Geschichten, oder? Wer jemals versucht hat zu meditieren, weiß, dass es nur um eine verdammte Geschichte nach der anderen geht. Meine Knie tun weh, mir ist langweilig, ich hätte nicht so ungeduldig mit meinem Kind sein sollen, ich habe vergessen, Milch zu kaufen … Die Geschichten steigen auf, und dein Geist jagt ihnen nach, aber dann fängst du dich, lass los, komm zurück, atme … bis die nächste Geschichte aufsteigt. Um den großen Zen-Meister Kurt Vonnegut zu zitieren: »So geht das.«
Soweit ich sehen kann, ist der einzige Unterschied zwischen Meditation und Schreiben der, dass man beim Meditieren die Geschichten loslässt, während man sie beim Schreiben verfolgt und einfängt. Aber beide Praktiken entwickeln ein Bewusstsein für den Geist und dafür, wie der Geist Geschichten generiert.
Interessant ist auch, dass Zen eine Praxis ist, die auf direkte Erfahrung gründet und traditionellerweise geschriebenen Texten eher mit Verachtung begegnet. Aber natürlich drückt sich diese Verachtung für das geschriebene Wort in Hunderten von Zen-Texten aus, die über Jahrhunderte überliefert wurden. Solche Arten von Paradoxien liebe ich an Zen.
Sie sind in Connecticut aufgewachsen, als Tochter einer Japanerin und eines Amerikaners, Sie haben in New York und Japan gelebt und leben nun auf einer kanadischen Insel mit ihrem Ehemann, der deutsche Wurzeln hat. Was heißt Zuhause oder Heimat für Sie?
Das ist schwierig. Ich habe wirklich überall gelebt, und ich glaube, dass ich deshalb zur Meditation gefunden habe – wo auch immer ich gerade bin, wenn ich mich hinsetze und meditiere, wird dieser Ort zu meinem Zuhause.
Ihr Roman stand auf der Shortlist zum Man Booker Prize 2013, befindet sich zurzeit auf der Shortlist des amerikanischen National Book Critics Circle Award (Daumen drücken!), wurde mit dem Preis der Unabhängigen Buchhändler in Großbritannien ausgezeichnet und hat erst kürzlich den wunderbaren Kitschies Award erhalten, der »an die progressivsten, intelligentesten und unterhaltsamsten Werke geht, die Elemente des Spekulativen oder Phantastischen enthalten.« Der Roman hat außerdem die britische Bookshop Band inspiriert, zwei Songs zu komponieren und einzuspielen – »For The Time Being« und »With Words Alone« . Daraus kann man nur schließen, dass der Roman viele verschiedene Menschen anspricht, dass er Leser ganz unterschiedlicher Hintergründe erreicht. Das ist sicher erfüllend, aber vielleicht auch ein bisschen überwältigend. Hat sich Ihr Leben verändert?
Jedes Buch, das ich geschrieben habe, jeder Film, den ich gemacht habe, hat mein Leben verändert, aber es ist das Schreiben und Schaffen, das verändernd wirkt, nicht die Rezeption oder Anerkennung. Letztere ist natürlich schön, verstehen Sie mich nicht falsch, und ich bin froh, dass mein Buch gut aufgenommen wird, aber das ist nicht der Punkt. Ich schreibe oder schaffe nicht dafür. Wenn ein Buch oder Film fertiggestellt ist und in die Welt hinausgeschickt wird, hat das Ganze nicht mehr viel mit mir zu tun. Es ist immer noch mein Werk, aber es gehört mir nicht mehr wirklich. Es beginnt sein eigenes Leben. Ich wünsche diesem Buch weiterhin ein schönes Leben und hoffe, dass ich bald wieder meine Arbeit aufnehmen und ein neues Projekt beginnen kann.
Wie bereits anklang, sind Sie auch Filmemacherin. ›Geschichte für einen Augenblick‹ scheint als Roman sehr stark die Kunst des Romanschreibens an sich auszuleuchten, aber das Buch hat auch eine enorme visuelle Qualität. Sehen Sie eine Verfilmung?
Eine Verfilmung fände ich ganz wunderbar. Ich würde sie nur nicht selbst übernehmen wollen. Der Buchtrailer stammt allerdings von mir, er ist auf meiner Website zu sehen (www.ruthozeki.com). Die Verlagswelt hat sich in den letzten zehn Jahren ziemlich verändert, und als ich das erste Mal davon hörte, dass Autoren und Verlage nun Trailer produzieren, um Bücher zu bewerben, fand ich das eher witzig und ein bisschen albern. Dann ging mir auf, dass ich ja selbst das Handwerkszeug dafür habe, und habe selbst einen gedreht. Wir hatten großen Spaß dabei, und ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen.
Ihr Buch zu lesen hat etwas sehr Erfüllendes und Inspirierendes, man bekommt sofort Lust, in eine Hütte an der wilden Küste von British Columbia zu ziehen, sich der Zen-Meditation zu widmen und endlich, endlich Proust zu lesen. Hat Sie der Roman selbst auch mit etwas überrascht, Einsichten, die sie so nicht erwartet haben – und verraten mögen?
Oh, wow. Ja, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll! Der gesamte Prozess des Schreibens besteht aus Überraschungen und unerwarteten Einsichten, warum sollte man sonst schreiben? Jeden Tag setzt man sich an den Computer und wartet darauf, dass das Unerwartete eintritt, und wenn man die Geduld aufbringen kann, tut es das auch. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, manchmal große Würfe. Und dieses Buch, mehr als meine beiden ersten, steckte voller Überraschungen.
Die größte Überraschung für mich war wohl, mich selbst in der Rolle von Naos Leserin wiederzufinden. Rückblickend erscheint das vollkommen stimmig, und ich kann nicht umhin, mich zu fragen, warum ich nicht früher darauf gekommen bin.
Überrascht hat mich auch, wie viel Spaß es gemacht hat, eine fiktionale Version meiner selbst, meines Mannes, unserer Katze, unseres Lebens insgesamt zu entwerfen. Die Trennlinie zwischen Faktischem und Fiktion hat mich schon immer gereizt, und ich habe schon bei meinem ersten Film ›Halving the Bones‹, einem autobiographischem Film mit fiktionalen Ausrutschern, darauf balanciert. Es fühlt sich also so an, als habe sich mit diesem Buch ein Kreis geschlossen.
Zu guter Letzt: Pesto oder Pest. So heißt Olivers und Ruths Kater im Roman, den am Ende ein schrecklich blutiges Zusammentreffen mit ein paar Waschbären erwartet. Wie geht es ihm heute, im fiktionalen Universum?
-
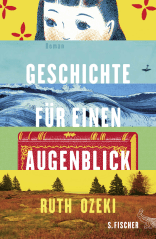 Ruth Ozeki erkundet, was es heißt, in diesem Augenblick, genau jetzt, ein Mensch zu sein – »bezaubernd, klug und herzze ...
Ruth Ozeki erkundet, was es heißt, in diesem Augenblick, genau jetzt, ein Mensch zu sein – »bezaubernd, klug und herzze ...
