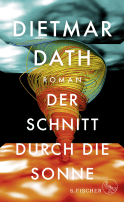
»Stell dir mal was Neues vor«
Dietmar Dath erzählt im Gespräch mit Sascha Michel von seinem neuen Roman »Der Schnitt durch die Sonne«.
In deinem neuen Roman »Der Schnitt durch die Sonne« reist eine Gruppe von Menschen zur Sonne, auf der es hochintelligente Lebensformen und einen großen Konflikt gibt. Warum ausgerechnet die Sonne und nicht einfach der Mars oder die Venus, wie man es aus anderen Science-Fiction-Romanen kennt?
Man soll nicht mit unbewaffnetem Auge in die Sonne schauen. Aber soweit die Menschheit weiß, ist dort jedenfalls mehr los als auf Mars und Mond, die man bis ins Detail kartographiert hat. Ich bin ja längst nicht der Erste, der sich die Sonne mithilfe von Science Fiction genauer angeschaut hat – die jüngere Ahnengalerie, wenn wir das Genre mal nur in seiner modernen Form nehmen, reicht von John Mastins »Through the Sun in an Airship« (1909) und Spekulationen darüber, welche Art Lebewesen dort möglich wären, wie sie zum Beispiel Olaf Stapledon in »The Flames« (1947) angestellt hat, bis zu David Brins »Sundiver« (1980), wo man das Feuermeer als Ozean erforscht, Dave Sims Comic »Cerebus: The Last Day«, wo die Sonne schlicht die Hölle ist, und schließlich Danny Boyles Film »Sunshine« (2007), in dem die Sonne einzuschlafen droht, wenn wir sie nicht wecken. Das Buch steht also in einer langen Tradition, und die einzige kleine Besonderheit ist die, dass ich mir nicht nur phantastische, sondern auch politische Gedanken darüber mache, was für Schätze, Abenteuer, Wissen durch dieses grelle Licht vor unserer Neugier geschützt sein könnten. Ich finde, wir dürfen uns mal dafür revanchieren, dass die Sonne sich mit ihren Strahlungswinden und sonstigen Scherzen dauernd in unsere moderne satellitengestützte Kommunikation einmischt.
»Die Zeit« hat Deinen Science-Fiction-Roman »Venus siegt« eine »spektakuläre Zumutung« genannt. »Der Schnitt durch die Sonne« ist einerseits noch viel spektakulärer, andererseits aber auch, ich sage mal: sehr geerdet. Das zeigt sich schon allein in der klaren, dreigeteilten Struktur des Romans, die buchstäblich vom »Hier« ausgeht und über das »Dort« der Sonne wieder zurück zum »Hier« führt: Im ersten Teil wird wie in dem Film »Die Glorreichen Sieben« ein Team zusammengestellt, das zur Sonne aufbrechen und bestimmte Aufgaben lösen soll. Die Reise zur Sonne spielt sich dann im zweiten Teil als eine Art Bewusstseinsreise und Simulation auf der Sonne ab, während die realen Körper und Hirne in einer Art MRT-Röhre auf der Erde liegen. Am Ende, also im dritten Teil, kehren die Helden zurück, wachen (leider nicht alle) auf der Erde wieder auf, und es stellt sich die Frage, was aus dem Abenteuer für das Leben hier in unserer Gesellschaft gelernt werden kann. Aber der Reihe nach: Was sind das für Menschen – es sind übrigens nur glorreiche fünf bzw. sechs – und warum werden ausgerechnet sie ausgewählt?
Wie bei jedem guten Team weiß und kann im Roman jede Frau und jeder Mann was anderes. Alles zusammen ergänzt sich dann hoffentlich. Das sind Fähigkeiten und Fertigkeiten, die man weder allein dem Geistigen, noch allein dem Leiblichen zurechnen kann – Musik wird zum Beispiel im Hirn geformt, aber auch wirklich gespielt und gesungen. Mir war das besonders wichtig, da ich den alten Aberglauben, Seele und Materie seien grundverschieden, nicht mag – nur, weil man nicht mit dem Finger auf die Dinge deuten kann, die geistig oder symbolisch gelten, heißt das nicht, dass sie reine Bewusstseinsangelegenheiten sind. Wenn du mir zwanzig Euro Kredit gibst, wenn ich bei dir was kaufe, ist das ein materielles Verhältnis, auch wir uns das nur im Kopf merken; und wenn sich unser Bewusstsein ändert, wegen Schuldenerlass oder Vergesslichkeit, besteht das materielle Schuldenverhältnis trotzdem weiter. So ist es auch mit der, wie du sagst, »Bewusstseinsreise«, die diese Heldinnen und Helden zur Sonne und zurück bringt. Das ist nicht einfach »Simulation«, sondern alles sehr materiell, sehr real, sehr folgenreich, wie der letzte Teil der drei Romanabschnitte zeigt.
Wie sich das für eine ordentliche Abenteuerreise gehört, haben Bernhard und Marianne, Aykut, Karel und Vera drei Aufgaben zu lösen, die mit dem sogenannten Koronakind zu tun haben. Wer oder was ist das Koronakind? Und überhaupt: Wie muss man sich intelligente Lebensformen auf der Sonne vorstellen?
Das Koronakind ist eine besondere Persönlichkeit unter denen, die auf der Sonne leben. Bei der Schilderung dieser Wesen wollte ich darauf hinaus, dass wir uns »Leben« und »Intelligenz« oft allzu beschränkt nach irdischen Modellen denken – »Leben« ist für uns das, was einer Pflanze oder einem Tier gleicht, und »Intelligenz« ist das, was mit uns zum Beispiel kommunizieren könnte. Die Science Fiction und die analytische Philosophie versuchen den Leuten seit Jahrzehnten zu erklären, dass solche Vorurteile uns daran hindern könnten, anderes Leben zu entdecken und zu verstehen, andere Intelligenzen. Der Ozean bei Lem im Roman »Solaris« (1961) ist auf andere Art intelligent als die biologischen evolutionären Algorithmen, die bei Greg Egan in der Erzählung »Wang’s Carpets« (1995) in einer einzigen Polymerkette, einem fünfundzwanzigtausend Tonnen schweren Molekül eincodiert sind, das auf natürlichem Weg entstanden ist. Beide wiederum unterscheiden sich von Lebensformen auf Siliziumbasis, über die wieder andere Leute nachgedacht haben, H. G. Wells zum Beispiel, oder von Methanatmern, oder von den leuchtenden Windseglern in Alice Sheldons »Up the Walls of the World« (1978) und so weiter. Es geht dabei um eine einfache Erweiterung des Horizonts, eine Toleranzübung: Stell dir mal was Neues vor – aber Menschen verstehen und wissen ja leider oft nicht mal, dass Leute, die was anderes glauben, die anders lieben oder anders essen als sie selbst, durchaus Menschen wie sie sind.
Du hast mal irgendwo geschrieben, dass jede Erzählung eine Welt erfindet, an die wir glauben müssen. Im Unterschied zur sonstigen Literatur gibt Science Fiction das aber ganz offen zu. Spektakuläre, bewusste Zumutungen also wie die Vorstellung des Koronakindes, trotzdem aber die gute alte »suspension of disbelief«, also der Anspruch, dass ich das als Leser erst einmal so schlucke und mitgehe. Wie hast du das – ganz technisch – gemacht, um diese beiden Seiten, Glaubwürdigkeit und »Realismus« einerseits, Zugeben der eigenen Setzungen andererseits, zusammenzubringen?
Vorsicht, geglaubt werden muss gar nichts. Scientology verlangt Glauben, Science Fiction nicht. Das ist der Punkt: Die Aufhebung des Unglaubens ist nicht einfach dasselbe wie die Einübung eines Glaubens. Aufhebung setzt nur die Skepsis aus, damit man erst mal weiterkommt. Literatur erwartet, dass man neugierig und ohne Zwangsvorstellungen sich was erzählen lässt, ohne dass das Ergebnis feststeht. Das ist der Unterschied zur Offenbarung, und bei Science Fiction ist der sehr explizit, weil da ja Sachen erforscht werden, die man aus der Erfahrung nicht kennt, die man erst in der Erzählung kennenlernen kann. Beim Realismus ist es leider oft so, dass nur bestätigt wird, was sich eh alle denken – die Welt ist ungerecht, irgendwer zieht immer die Arschkarte und dergleichen. Bei den größten Realistinnen und Realisten der Kunst freilich wird die Wirklichkeit so genau angeschaut, dass sie sich als sehr wundersam entpuppt – da berührt sich das dann mit dem scheinbaren Gegenteil, insofern bei der besten Science Fiction umgekehrt herauskommt, dass die größten erfundenen Wunder sehr viel über die Wirklichkeit verraten können.
Womit du ja auch rechnen kannst bei deinen Leserinnen und Lesern, ist ein bestimmtes Maß an popkultureller Prägung. Als ich zum Beispiel die Szene mit den Magnetresonanzröhren zum ersten Mal las, in denen deine fünf Helden zur Sonne reisen, beeindruckten mich nicht nur die Fachbegriffe, sondern ich kannte Vergleichbares aus Filme wie »Matrix«, »eXistenZ« oder »Inception« und ging deshalb buchstäblich mit hinein in die Röhre. Hinzu kommt die Fähigkeit bei jedem, der mit Filmen wie »Pulp Fiction« aufgewachsen ist, alles immer auch ironisch lesen zu können: Bei deiner Aufzählung von optisch-parametrischen Oszillatoren, Leuchtstrahlbündelzubehör, Faserkoppler und Klauen-Vakuumpumpe musste ich einfach auch lachen…
Ach, na ja, Wissen … das ist alles nicht mehr so wild wie früher, man kann doch heute alles googeln. Man muss aber nicht – ich habe gerade einen großartigen Science-fiction-Zeichentrickfilm gesehen, »Harmony« (2015) von Michael Arias und Takashi Nakamura. Da geht es um eine Gesellschaft, in der eine große Gesundheitsbehörde alle bevormundet. Ein junges Mädchen, das dagegen Widerstand leisten will, klärt seine Freundinnen auf und erwähnt dabei Michel Foucault, den französischen Philosophen, der viel über Bevormundung durch Institutionen wie Krankenhaus, Irrenhaus, Knast gearbeitet hat. Man kann den Film mühelos verstehen, wenn man nicht weiß, wer Foucault ist. Wenn man es weiß, freut man sich über den Hinweis auf den Hintergrund. Und wenn man es nicht weiß, aber gerne wissen will, kann man wie gesagt googeln oder sich die Bücher holen. Früher gab es diese Schwellen, da war dann zum Beispiel Popkultur das, wozu sich auch Leute ohne Bildung leicht Zugang verschaffen können. Oder Naturwissenschaft und Technik war was für Fachleute. Heute ist das anders. Pop ist selber total kompliziert geworden und umgekehrt kann man das komplizierteste Zeug im Netz nachschauen – es gibt auf Youtube Videos, die in ein paar Minuten die Differenzialrechnung erklären oder was das Yoneda-Lemma ist, man muss es sich nur anschauen und halt mitdenken. Es geht mir darum, eine Haltung zu entwickeln, die nicht dauernd Angst hat vor dem Unbekannten und die keine Wissenshierarchien mehr an und für sich gelten lässt, sondern nur noch Gebrauchswerte von Wissen – wenn ich mich für die Musik einer Band interessiere, die das macht, was früher Rock oder Pop hieß, kann es nützlich sein, mich in Bildender Kunst auszukennen, bei Sonic Youth zum Beispiel. Oder ich lasse es. Was ich wissen muss, hängt ja bei Kunst, populär oder nicht, einfach davon ab, wie tief ich eintauchen will. Wie schön das für mich ist. Außerdem verwandelt sich Wissen, wenn es in eine Fiktion eingespeist ist. Schummeln ist da erlaubt, Wissen kann verwandelt werden, abgewandelt wie in dem Buch, alles ist erlaubt, was der Story dient, den Figuren, dem Abenteuer, der Liebe, dem Krieg um Recht und Unrecht.
Überhaupt nicht zum Lachen ist das, was sich auf der Sonne abspielt. Bernhard mag dort noch so sehr wissen, dass die ziemlich attraktive Frau in Bronzehaut, mit der er da gerade spricht, in Wirklichkeit ein gigantischer Tornado auf der Sonne ist und ihre Darstellung nur eine Rechnersimulation. Aber innerhalb der vom Roman gesetzten Fiktion ist diese Amazone total real und ziemlich gefährlich. Was ist los auf dieser Sonne und was passiert dort mit den Menschen?
Was die Menschen, die dort zu Gast sind, auf der Sonne sehen und hören, wird von den Rechenvorgängen, die sie in dieser Geschichte am Leben erhalten, ihren Seh- und Hör- und Erlebnisgewohnheiten angepasst. Das heißt, die Menschen sehen dort Irdisches, weil sie auf diese Art leichter verstehen und einordnen können, was da passiert – die Amazone zum Beispiel ist einfach etwas, dem auf der Erde eine Person entspricht, die das Glück gehabt hat, in eine herrschende Gruppe hineingeboren zu sein. Sie hat nie Not, Angst oder einen unerwarteten Gedanken von innen gesehen und kann sich nicht vorstellen, jemals im Unrecht zu sein. Das macht sie zu einer gefährlichen Feindin, wenn darum gekämpft wird, wie das Verhältnis zwischen verschiedenen Wesen und Intelligenzen in Zukunft aussehen soll. Genau wie hier.
So geerdet der erste und dritte Teil des Romans sind, so entfesselt und spektakulär ist der mittlere Teil, der vom »Dort« der Sonne handelt. Man könnte sagen: Dort ist der für jede Literatur entscheidende Möglichkeitssinn ganz in seinem Element. Möglich ist dann zum Bespiel auch, dass sich Marianne in Mark und Karel in Karla verwandelt. Warum dieser Wechsel der Geschlechtsidentitäten auf der Sonne?
Auf dem Weg zur Sonne wird die Zusammensetzung der Menschengruppe in mancherlei Hinsicht verändert; das betrifft die Zuschreibung verschiedener Eigenschaften, ist aber ganz normal bei Reisen, etwa wie die optimale Zimmerbelegung im Hotel.
Auf der Sonne herrscht Krieg. Mitten in diesem Krieg aber erzählst du auch eine Liebesgeschichte. Was verbindet Vera und Aykut, woran scheitern sie?
Das Schwierige bei Nähe und Intimität ist, dass man andere Menschen als verschieden von sich selbst erlebt, dass diese Verschiedenheit aber nicht als Machtgefälle enden darf. Das klappt selten, und wie es bei den beiden nicht klappt und dass das trotzdem ganz und gar nicht bedeutet, dass diese Liebe wertlos wäre, wird erzählt.
Was beim Lesen vor allem des Mittelteils sofort auffällt, sind immer wieder ins Schriftbild eingefügte Diagramme und Gleichungen. Das ist deshalb nicht verwunderlich, weil die dritte Aufgabe der Menschen lautet, die Sprache des Koronakindes zu finden und sie aus Mathematik und Physik zu bauen. Warum diese so wichtige Rolle der Mathematik?
Die Welt ist ja erstaunlicherweise so, dass wir sie mit Mathematik auf eine Art beschreiben können, die uns Vorhersagen erlaubt. Bedeutende Naturwissenschaftler wie Einstein oder Eugene Wigner haben sich gefragt, warum das so ist; niemand weiß es sicher. Da waltet ein Geheimnis, aber zugleich steckt dieses Geheimnis in der klarsten Art des Denkens, die wir kennen. Im Buch geht Vera auf die Jagd nach dem richtigen Diagramm für eine schwierige Beziehung zwischen dem Allgemeinen und dem Besonderen und bezieht sich dabei u.a. auf die seit den 1940er Jahren in der Mathematik entwickelte Kategorientheorie. Das Buch zeigt diese Jagd live. Ich finde so etwas spannend, auch, weil es sich ein paar trickreiche Freiheiten mit der Wahrheit und der tatsächlichen Kategorientheorie nimmt. Mir ist klar, dass diejenige Literatur, die sich dafür begeistern kann, dass die Welt sich mittels logischer Folgerungen erfassen lässt, eine Minderheitenposition in der Literatur besetzt. Aber so viel von unserem Leben ist davon durchwirkt, am Computer, im Flugzeug, beim Essen und Schlafen und Lieben in dieser Neuzeit hier. Das sichtbar zu machen, kommt mir interessant vor.
Diesseits von inhaltlichen Fragen der Kategorientheorie und Wahrscheinlichkeitsrechnung sorgt die Mathematik im Roman ja zunächst mal einfach für Unterbrechungen des üblichen Leseflusses, für Sprünge vom Plot ins Diskursive, auch für Unverständlichkeit. Geht es womöglich genau darum als Leseerfahrung: um dieses Springen und Nicht-Verstehen? (Vor dem bürgerlichen Realismus, bei den Romantikern, und später dann noch mal kurz in der Moderne gehörte diese Art zu lesen ja mal zum Selbstverständlichsten der Welt.)
Was den Lesefluss für die einen unterbricht, steigert bei anderen die Aufmerksamkeit.
Alle kennen das doch aus dem Alltag: Handlungen werden von Gedanken unterbrochen, Gedanken von Handlungen. Wer nur konkrete Geschehnisse erzählt, nur Action, wie zum Beispiel Karl May, produziert komischerweise irgendwann Text, der durch das dauernde »und dann, und dann, und dann« bald langweiliger ist als das Allerabstrakteste, weil die Aufzählung des stumpf Konkreten keinen gedanklichen Kontext mehr herstellt. Was keinen übergeordneten Kontext hat, verliert seinen konkret fasslichen Charakter früher oder später und wird reines Wortgeratter. Ich biete halt verschiedene Ereignisebenen an, mal passiert was mit der Faust, mal was im Kopf. Wie weit man sich auf die einzelnen Ebenen einlässt, ist der Freiheit überlassen. Man kann das Abenteuer lesen, ohne mehr vom Gegenstand der Kämpfe zu verstehen, als dass sie auch mathematisch gedacht werden können. Wer einen Roman über Beethovens Leben schreibt, kann das vielleicht besser, wenn sie oder er Noten lesen kann, aber den Roman schreibt man so, dass er sich auch ohne Notenlesenkönnen genießen lässt. Es gibt Leute, die wollen nur den Zaubertrick sehen, das ist legitim. Andere freuen sich, wenn ihnen auch noch vermittelt wird, wie das Kaninchen in den Hut gekommen ist. Das Buch ist für beide.
Mit den letzten Fragen sind wir bereits wieder auf der Erde gelandet: bei der Frage, was die Erfahrung auf der Sonne für unser eigenes Leben bedeutet, wie man das »dort« Erlebte »hier« übertragen kann. Diese Frage stellen sich auch deine Figuren am Ende. Jedenfalls Vera, Aykut und Bernhard. Mark und Karla können sich die Frage nicht mehr stellen, weil ihre Rückkehr ins frühere Geschlecht nicht gelingt. Heißt das: Es gibt Grenzüberschreitungen und Bewusstseinsreisen, die für unsere Körper bzw. Hirne nicht verkraftbar sind?
Das ist der Punkt, an dem man sich streiten kann und sollte: Sind alle Grenzen, die wir für materiell halten, wirklich in der Natur verankert oder anderswo? Es gibt zum Beispiel das Gerücht, dass Menschen bestimmte Drogen biologisch offenbar nicht verkraften, weil ja so viele Menschen an deren Gebrauch sterben. Das könnte aber mit gesellschaftlichen Verhältnissen zu tun haben, mit sozial erzeugter Not – Mick Jagger und Keith Richards sind noch ganz gut beieinander, und die haben anregende Chemie wirklich nicht verschmäht. Sie sind halt sehr reich. Also: Auf der Sonne begegnet meinen Figuren neues Wissen über Naturvorgänge, aber auch über Gesellschaftliches. Nach der Rückkehr müssen sie das sortieren, und wenn’s zuvor schon spannend war, wird’s dadurch nur noch spannender.
»Selbst der Strahl der Sonne, der in die Schattenplätze fällt, ist ein Bild dieses ewigen Krieges.« So lautet ein Motto deines Romans. Googelt man danach, stößt man auf Karl Marx' frühe Studien zur antiken Philosophie, wo es weiter heißt: »Ein lärmender Kampf, eine feindliche Spannung bildet die Werkstätte und Schmiedestätte der Welt. Die Welt ist im Innern zerrissen, in deren innerstem Herzen es so tumultuarisch zugeht.« »Der Schnitt durch die Sonne« ist ein Buch, wie mir scheint, über genau diese Zerrissenheit, im naturphilosophischen wie politischen Sinn. Ich musste dabei auch an den Science-Fiction-Film »Arrival« denken: an den schrecklichen Moment, wo auf sämtlichen Monitoren der Weltgemeinschaft nur noch das Wort »Disconnected« steht. Entscheidend ist aber, dass weder in deinem Roman noch in »Arrival« oder zum Beispiel in dem Film »Interstellar« jene Zerrissenheit, von der Marx spricht, das letzte Wort hat. Der Ausweg liegt im Teilen von Wissen und Geschichten, darin, gemeinsam Probleme lösen zu können. Woher kommt der neue Optimismus bei solchen Filmen und am Ende deines Romans?
Ich weiß nicht, ob das ein Trend ist; auf jede konstruktive Zukunftserzählung kommen immer noch zehn Dystopien. Mahnen und Warnen in allen Ehren, das sind keine Beschäftigungen, denen man lange nachgehen kann, wenn man sich Geschichten ausdenkt, die mehr wollen als Flugblätter und Leitartikel zu illustrieren. In den besseren Dystopien stecken schon immer positive Perspektiven. Peter Hacks hat es 1990 am besten gesagt: »Indem einer Kunst macht, verrät er, dass er mit dem Weltende nicht rechnet. Er gibt sich nicht die ganze Mühe, um einen befristeten Stoff für einen befristeten Verbraucher herzustellen. Würde er mit dem Weltende fest rechnen, würde er die Sache lassen. Wie unerfreulich die Rechnungen insgesamt seien, die der Künstler der Menschheit aufzumachen genötigt ist: Dass die Menschheit abstirbt, kann für die Kunst immer nur ein Zwischenergebnis sein.«
Das Gespräch mit Dietmar Dath führte Sascha Michel, Lektor im S. Fischer Verlag.
