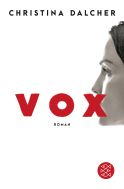
Wir sind mehr als 100 Wörter
Mit ihrem Überraschungsdebüt »Vox« liefert uns die Amerikanerin Christina Dalcher die erschreckend realistische Vision einer Welt, in der Frauen entmündigt werden – und treibt damit auf die Spitze, was wir aktuell in unserer Gesellschaft erleben: Fanatismus und Sexismus. Ein Gespräch mit der Autorin.
In »Vox« haben Sie zwei Figuren in direkten Kontrast zueinander gesetzt: Die politisch inaktive Jean und ihre engagierte Freundin Jackie, die an jedem Protestmarsch teilnahm. Was wollten Sie mit diesen beiden Gegensätzen zeigen?
Jackie, die leibhaftig erst später im Roman auftritt, begann als eine Art Spukgespenst, als die bohrende Stimme, die zu Jean sagt: »Hab ich dir doch gesagt, Mädel!« und »Du hast dir dein eigenes Grab geschaufelt, also leg dich hinein.« Jean mag vielleicht niemals zu einer Aktivistin werden, wie Jackie sie ist, doch sie verändert sich im Laufe der Geschichte; sie wird mehr wie ihre Freundin, während sie immer ihre eigene Identität behält. Wir müssen nicht einander kopieren, um im gleichen Team zu spielen, aber wir können viel von Anderen lernen.
Wie war es, in Jeans Kopf zu stecken, während Sie »Vox« schrieben?
Es war ein besonderer Ort, an den ich jedes Mal aufs Neue eintauche, wenn ich Passagen aus dem Roman lese. Jean zu sein, ließ mich für eine Weile eine Bandbreite von Situationen und Emotionen erleben, manche davon bekannt, andere wiederum fremd. Wenn ich ihre Szenen schrieb, war ich eine Mutter, eine Ehefrau, eine Frau mit Reue, eine Frau mit der Macht, eine ernste Sprachstörung zu heilen, eine Liebhaberin. Was den letzten Teil angeht – es war nicht wirklich schrecklich für mich, mit Lorenzo ins Bett zu steigen.
Ist Jean eine Feministin für Sie?
Ich denke von Jean als Humanistin, als Verfechterin der Gleichheit, als Person, die intelligent genug ist, alle Menschen als gleich und gleich geboren zu betrachten. Aber hier liegt der Haken – Jean sieht das als selbstverständlich an, niemals hat sie den Gedanken in Betracht gezogen, dass nicht jeder ihre Sichtweise teilen könnte. Soweit Feminismus ein Ruf nach Gleichheit ist, können wir Jean als Feministin sehen, ja.
Jeans Teenagersohn erkennt sehr leicht die Wahre-Frauen-Bewegung an. Warum ist seine Rolle in dem Roman so wichtig?
Steven zeigt uns, wie formbar Menschen sein können, im positiven wie im negativen Sinne. Als Jugendlicher scheint sein Denken (und Überdenken) völlig natürlich – er ist zwar noch ein Kind, aber bald ein Erwachsener, und er steuert ein kompliziertes System, eine Sammlung neuer Ideen, die noch im Wandel begriffen sind, und deren Bedeutung und Sinn er zu verstehen versucht.
Viele der schaurigen Momente in »Vox« drehen sich um Sonia, Jeans sechsjährige Tochter, und die Frage, ob sie jemals eine Sprache erlernen und verwenden wird.
Im Roman können wir eine sich anbahnende Katastrophe erspüren, die wir aber niemals ganz zu fassen bekommen. Mit sechs Jahren ist Sonia in einem sehr wichtigen Alter – wir können diese Phase als »Benutz es, oder verlier es!« bezeichnen. Ich meine das sprichwörtlich. Für das Lernen gibt es viele entscheidende Zeiträume, und die Theorie ist, dass das Gehirn von Kindern in der frühen Jugend sehr formbar ist, wir diese Eigenschaft mit der Pubertät aber verlieren.
Welche Figur war für Sie am schwersten zu schreiben?
Ich schreibe ein wenig Flash Fiction, also sehr kurze Kurzgeschichten, manchmal mit nicht mehr als hundert Wörtern. Flash erlaubt mir, mit verschiedenen Stimmen und Figuren zu experimentieren, so konnte ich problemlos vom italienischen Liebhaber Lorenzo über die Aktivistin Jackie zu Sharon, der bodenständigen, immerschlauen Landwirtin springen. Jeans Ehemann Patrick war etwas schwieriger. Ich wollte ihn als grundsätzlich guten Kerl, zugleich passiv. Aber nicht einfältig, schließlich ist er der Wissenschaftsberater des Präsidenten. Seine Tatenlosigkeit musste glaubwürdig sein.
Was veranlasste Sie »Vox« zu schreiben?
»Vox« begann als Flash Fiction von etwa 700 Wörtern für einen Wettbewerb mit einem Endzeitthema. Ich stellte mir eine Welt vor, in der sich ein biologischer Kampfstoff rasant verbreiten und eine bestimmte Art von Sprachverlust herbeiführen würde, ein erschreckendes Szenario. Ich gab ihr den Titel »Wernicke 27X«.
Als ich dann von einem Anthologieprojekt hörte, in dem ausschließlich Autorinnen über weibliche Hauptfiguren schrieben, erinnerte ich mich wieder an diese Geschichte. Und ich fragte mich, wie ich den Schrecken noch erhöhen, die Idee des Sprachverlusts noch erweitern könnte. Ich beobachtete lange das aktuelle politische Klima, und fand dort die Antwort: Indem nur die Hälfte der Bevölkerung betroffen wäre. So wurde »Vox« geboren.
Ist die Wernicke-Aphasie eine echte Sprachstörung?
Ja, es gibt sie wirklich. Wenn das menschliche Gehirn ein Trauma erleidet und das Sprachvermögen schädigt, nennt man das Aphasie. Vom griechischen a = ›nicht‹ und phanai = ›sprechen‹. Es gibt viele verschiedene Erscheinungsformen. Diejenige, die ich in »Vox« verwende, ist die Wernicke-Aphasie, auch »fließende Aphasie« genannt. Anstatt mit dem Sprechen Probleme zu haben, kann der Erkrankte tatsächlich sehr fließend sprechen. Es klingt jedoch nach Buchstabensuppe, denn ein Wernicke-Patient erkennt die Bedeutung der Worte nicht mehr.
Was sollte der Leser aus der Lektüre von »Vox« Ihrem Wunsch nach mitnehmen?
Viele Leser werden »Vox« vermutlich als feministischen Roman lesen, in vielerlei Hinsicht ist er das auch. Aber ich hoffe, die Menschen lesen darin auch eine Geschichte von Unterdrückung, vom auftretenden Horror, wenn eine Interessengruppe, egal welche, mit einer bestimmten Agenda so mächtig wird, dass sie nicht mehr aufzuhalten ist. Obwohl ich »Vox« als Warnung geschrieben habe, wollte ich auch zeigen, wie sehr unsere Menschlichkeit von unserer Sprache abhängt. Im Buch erreichen wir nie den Punkt, in der das Sprachvermögen komplett ausgelöscht wird, aber die Gefahr zeichnet sich ab. Wie würde unsere Welt aussehen, wenn wir (oder manche von uns) das Vermögen zu kommunizieren, zu denken, uns selbst auszudrücken, verlieren würden?
Ich würde mir wünschen, dass die Leser zwei Gedanken mitnehmen: 1) Wie schnell kann sich die Welt verändern, wenn wir nicht aufpassen. Und 2) Wie essentiell ist das Geschenk der Sprache, dieses erstaunlich komplexe Vermögen, das wir so oft als selbstverständlich betrachten, für unsere Existenz.
Aus dem amerikanischen Englisch von Teresa Pütz
