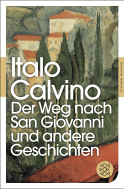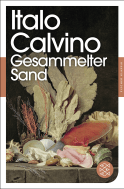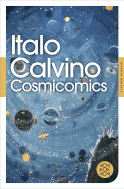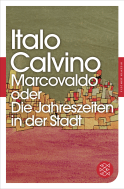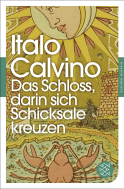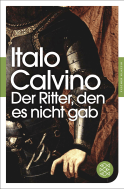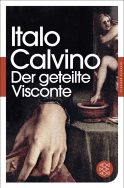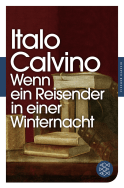Calvino: Olga Martynova: Bartleby und die Konsistenz
Vor 30 Jahren schrieb Italo Calvino seine berühmten Harvard-Vorlesungen. Zur Erinnerung und Bestandsaufnahme im Wintersemester 2015/16 haben sich mehrere Autorinnen und Autoren diese Vorlesungen noch einmal angesehen: Olga Martynova über die Fähigkeit, Bilder vor dem eigenen Auge entstehen zu lassen.

Gut. Wir steigen, Calvino folgend, die Leiter hinauf, bekommen den Aufschwung der Leichtigkeit und erreichen über die Sprossen der Schnelligkeit, der Genauigkeit, der Anschaulichkeit und Vielschichtigkeit die feste Form der letzten Trittstufe, der Konsistenz. Wir versuchen die Geschenke, die aus den letzten Jahren des vergangenen Jahrtausends zu uns in die ersten Jahre des laufenden geschickt wurden, in Empfang zu nehmen, ihrer würdig zu sein.
Sagen Sie, aber ehrlich, haben Sie eben eine Leiter vor Ihrem inneren Auge gesehen? Haben Sie das Rascheln des Geschenkpapiers gehört? Wenn ja – dann sind wir alle gerettet. Wenn nein, dann versuchen wir trotzdem, über das Wunder der Literatur zu sprechen. Über die Hoffnung.
Wenn Calvino seine Liste der zu bewahrenden Werte erstellt, macht er das im vollen Bewusstsein, wie gefährdet die Literatur und die Buchkultur an der Schwelle zum neuen Jahrtausend sind. In Anschaulichkeit warnt er davor, dass wir in der Welt, in der wir ständig von allen möglichen visuellen Informationen angegriffen werden, die Fähigkeit verlieren, die Bilder vor unseren Augen entstehen zu lassen, was die Grundlage und Voraussetzung für die Literatur ist: »Wird sich die Fähigkeit, Bilder in Abwesenheit der Dinge heraufzubeschwören, noch in einer Menschheit entwickeln, die immer mehr von der Sintflut vorfabrizierter Bilder überschwemmt wird?« Diese vor 30 Jahren gestellte Frage ist von entscheidender Dringlichkeit. Dabei – und das finde ich an Calvino erstaunlich und einzigartig – ist er voller Hoffnung. Alle Probleme, vor denen die Literatur steht, sehend, leistet er sich den Luxus der Naivität und reicht uns seine sechs auserwählten Eigenschaften des literarischen Textes, als sähe er die Möglichkeit nicht, dass wir ihn überhaupt nicht verstehen.
Genauso großzügig und »wissend naiv« hätte seine letzte Vorlesung sein sollen. Ausgerechnet das letzte Wort in dieser Reihe, zu dem Calvino keinen Text schaffte, ist am schwersten zu bestimmen. Es gibt nur einen Hinweis von Ester Calvino, dass ihr Mann dafür auf »Bartleby« von Herman Melville Bezug nehmen wollte. Wir können nur vermuten, was er aus dem Begriff Konsistenz hätte entwickeln können.
Was für Melvilles Erzählung charakteristisch ist: Der Erzähler nimmt sich die Zeit, um alle Begleitumstände zu schildern. Bevor er die Hauptfigur vorstellt, den Kanzleischreiber Bartleby, stellt er sich selbst vor und erzählt ausführlich über seine drei anderen Angestellten. Dann, als die Hauptfigur endlich zum Vorschein kommt, wird uns berichtet, wie der Erzähler den Arbeitsplatz für seine neue Schreibkraft eingerichtet hat: »Bartleby wies ich kurz entschlossen eine Ecke in der Nähe der Tür zu, jedoch auf meiner Seite, damit ich diesen stillen Menschen in bequemer Rufweite hätte, wenn irgend eine Kleinigkeit zu erledigen wäre. Ich stellte sein Pult in die Nähe eines kleinen Seitenfensterchens, durch das man ursprünglich auf einige schmutzige Hinterhöfe und Ziegelmauern hatte sehen können, das aber jetzt, da inzwischen gebaut worden war, überhaupt keine Aussicht mehr bot, nur noch ein wenig Licht. Drei Fuß vor dem Fenster erhob sich eine Wand, und das Licht kam von hoch oben, zwischen zwei hohen Gebäuden, wie durch eine schmale Öffnung in einer Kuppel. Um die Sache weiter zufriedenstellend einzurichten, brachte ich einen hohen grünen Wandschirm an, durch den Bartleby meinem Blick völlig entzogen wurde, während er meiner Stimme erreichbar blieb. Auf diese Weise waren, soviel als möglich, Abgeschlossenheit und Geselligkeit vereint.« (Aus dem Amerikanischen von Jürgen Krug)
Wie gesagt, wir können nur vermuten, was Calvino uns sagen würde, aber ich sehe, wie Melville die Konsistenz der Erzählung herstellt. Er baut ein Postament, auf das er die eigentliche Handlung aufsetzt. Erst wenn wir über alle Umstände Bescheid wissen, beginnen, uns gut in der Notarkanzlei zu orientieren, wird uns die herzzerreißende Geschichte anvertraut, eine Parabel auf Elend, Mitleid und die Unzulänglichkeit aller Versuche, angesichts des menschlichen Elends ein reines Gewissen zu haben. So werden wir in eine höchst realistische, materielle Welt hineingeführt, um dort vor das Rätsel phantastischer Vorgänge gestellt zu werden und vor einen rätselhaften finalen Aufruf: »Ja, Bartleby! Ja, Menschentum!«
Auf eine ähnliche Weise habe ich versucht, mit meinem kleinen Text, um Calvino zu ehren, ein Postament für meine finale Behauptung aufzubauen, damit sie Konsistenz gewinnt. Ich mit meinem Kulturpessimismus fühle mich von Calvinos Zuversicht beschämt und zugleich aufgemuntert. Vielleicht wird die Literatur ungeachtet all unserer Versuche, sie abzuschaffen, doch irgendwie weiter bestehen? Ich kann nicht einmal sagen, dass wir mit allen uns zugänglichen Mitteln, mit dem besagten Überfluss an Bildern, mit der immer stärkeren Kommerzialisierung und dem immer schwächeren Widerstand dagegen am Ast sägen, auf dem wir sitzen. Nein, wir haben den Ast bereits abgesägt. Und – wir sitzen immer noch auf ihm. Das ist ein Wunder der Literatur, rufe ich aus unserem Jahrtausend ins vorige und nehme dankbar die Geschenke Leichtigkeit, Schnelligkeit, Genauigkeit, Anschaulichkeit, Vielschichtigkeit und Konsistenz an, die dieses Wunder weiterhin ausmachen sollen.