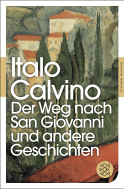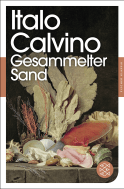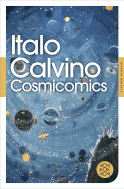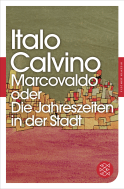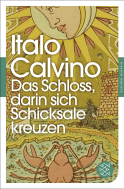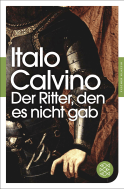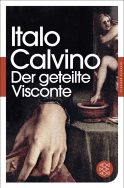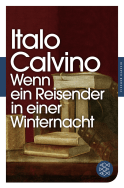Calvino30: Alberto Manguel: Multiplizität
Vor 30 Jahren schrieb Italo Calvino seine berühmten Harvard-Vorlesungen. Zur Erinnerung und Bestandsaufnahme im Wintersemester 2015/16 haben sich mehrere Autorinnen und Autoren diese Vorlesungen noch einmal angesehen: Alberto Manguel über die vielen Seinsformen in uns.

Vom Hüter der Robben, dem Meeresgott Proteus, erzählt die Sage, er habe in die Zukunft schauen können und beständig seine Gestalt gewechselt. Diese Geschichte wirft einige Fragen auf: Wenn wir ähnlich dem Gestaltenwandler Proteus von der Kindheit ins hohe Alter hinüberwechseln, wenn unsere kindliche Einfalt durch Erfahrung abgelöst wird und diese abermals von Einfalt, wenn wir von vergänglicher zu wirklich vergehender Materie werden, wie können wir da eine feste, einzige Identität haben? Und was kann inmitten des unaufhörlichen Bedrängens und Abebbens, des allgemeinen Fließens dieser Welt an einem bestimmten Ort oder zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich klar definiert werden? Nie sind wir einzig; wir sind viele. Die Multiplizität ist unsere eigentliche Natur.
»Wer bist du?« Jeder von uns muss sich eines Tages mit dieser schwierigen Frage auseinandersetzen, die die Raupe Alice im Wunderland stellt. Die Antworten, die wir im Verlauf unseres Lebens darauf zu geben versuchen, sind niemals restlos überzeugend. Wir sind das Gesicht im Spiegel, der Name und die Nationalität, die uns gegeben werden, das Geschlecht, das unsere Kultur uns zuschreibt, der Widerschein im Auge unseres Gegenübers, ein Traum für den, der uns liebt, und ein Albtraum für denjenigen, der uns hasst. Wir sind der knospende Körper in der Wiege und der starre Leib unter dem Leichentuch. All dies sind wir, und ebenso das Gegenteil dieser Dinge, der Schatten unserer selbst. Wir sind die geheimen, ausgelassenen Passagen in der von uns gegebenen Beschreibung. Wir sind jemand, der gerade erst ins Leben tritt, und gleichzeitig sind wir schon jemand gewesen – vor langer Zeit. Unsere Identität mitsamt der Zeit und dem Ort, in denen sie verwurzelt ist, ist fließend und unbeständig wie Wasser.
Zeit, Erfahrungen, Feuer und Wasser, Gewohnheiten, Reisen, Jahreszeiten, Empfängnis und Tod, Träume, Perspektiven und Gefühle verändern uns. Weil wir einen korrumpierbaren Körper besitzen, werden wir alt und zerfallen. Deshalb glauben wir, dass die Unsterblichkeit ein Zustand ewiger Beständigkeit ist, aber diese Vorstellung entgleitet uns, weil wir sie immer anders erinnern und beschreiben. All die alten Metaphern, die wir in Äonen erfunden haben, um uns zu definieren, sind Bilder des Wandels: der sich dahinschlängelnde Fluss, das fallende Blatt, der geformte Ton, die Asche. Unsere Identität liegt zwischen der Person, die wir nicht mehr sind, und derjenigen, die wir vielleicht eines Tages sein werden. Sie ist nie ausschließlich gegenwärtig, gewinnt aber auch zu keiner anderen Zeit volle Gestalt. Sobald wir »ich bin« sagen, bestimmen wir uns als etwas, das außerhalb unseres Selbst liegt, wie die abgeworfene Haut einer Schlage – eine weitere Metapher der Verwandlung. Durch sprachliche Tricks kreieren wir die Illusion von Beständigkeit, die vergeblich unseren unerfüllbaren Wunsch illustriert, ewig zu leben. Gewöhnlich glauben wir, der Ursprung unserer Existenz sei in der Vergangenheit zu finden, während Miguel de Unamuno dachte, die Zeit fließe von der Zukunft in die Vergangenheit und wieder zurück. Tatsächlich leben wir in beiden Gezeitenströmen, zurückgeworfen zu den Geistern unseres vormaligen Lebens und fortgetrieben in die Zukunft unserer noch kommenden Identitäten.
Weil wir uns lediglich bei den Gütern der Welt bedienen, anstatt sie als Allgemeingut mit allen zu teilen, verlieren wir wie die Diebe in Dantes Hölle unsere eigene Gestalt. Im siebten Graben des achten Höllenzirkels treffen Dante und Vergil auf eine Unzahl von Schlangen. Die armen Seelen der hierhin versetzten Diebe müssen nackt durch dieses Gedränge rennen. Als Dante genauer hinschaut, erkennt er voller Schrecken, dass die Körper der Sünder und die sie quälenden Schlangen miteinander verschmelzen. Der Angreifer wird zum Opfer und dann wieder zum Angreifer, die Formen gehen ineinander über, Gestalt verliert sich in Gestalt, »so wie auf dem Papier im Feuerbrande/ allmählich eine dunkle Farbe vorrückt,/ die noch nicht schwarz ist, und das Weiße auslöscht.« Weil sie in ihrem Erdenleben von anderen etwas genommen haben, das nicht ihr eigen war, besteht die Höllenstrafe der Diebe darin, alles zu verlieren, bis hin zu ihren individuellen Merkmalen, „und keiner glich mehr dem der er gewesen.“ Ihre Bestrafung gemahnt uns an unsere eigene Multiplizität: wir sind eins mit der Welt, ein Plural, kein Singular. Es steht uns keine Herrschaft über sie zu.
Zu allen Zeiten haben wir uns und die Welt als Ergebnis einer Metamorphose gedacht, einer Entwicklung, die noch immer im Gange ist. Vielleicht hat uns die Betrachtung von Samen, Kokons oder Eiern diese Vorstellung eingegeben, in der sogar der Tod nicht das Ende bedeutet. Geschichten von Seelenwanderungen und Transformationen, die durch Sünde und Erlösung beeinflusst werden, spuken noch immer in unseren Köpfen: Denn wir wollen glauben, dass Körper und Geist nach dem Tod noch für etwas anderes gut sind, denn als Dünger für die Rosen.
Der Großmeister der Multiplizität ist ohne Frage Ovid, der in allem eine Geschichte gesehen hat. Für Ovid stellen die Dinge dieser Welt manifeste Antworten auf die Rätsel dar: der Lorbeerbaum ist eine Antwort auf die Frage nach der Geschichte von Daphne und Apoll, die Nachtigall ist die verkörperte Geschichte der Philomela. Die von uns wahrgenommene Welt ist nichts als ein eingefrorener Augenblick in einer sich noch immer abspielenden Geschichte. Und sie wird sich weiterentwickeln, in etwas, das wir noch nicht erahnen können. In dieser Hinsicht sind seine Geschichten über die Metamorphosen beispielhaft für das sich beständig wandelnde große Ganze, das sich selbst paradoxerweise nie verändert. Ovid fasst diesen Gedanken in Buch XV (seiner ›Metamorphosen‹) zusammen:
»Alles verändert sich nur, nichts stirbt. Herüber, hinüber
irrt der belebende Hauch, und auch in andre beliebige Glieder
ziehet er ein und geht aus Tieren in menschliche Leiber
und in Getier von uns und besteht so ewige Zeiten.
Wie das geschmeidige Wachs, zu neuer Gestalt sich bequemend,
weder verbleibt, wie es war, noch hält an den selbige Formen,
aber dasselbe doch ist; so bleibt auch, lehr’ ich, die Seele
immer sich gleich und begibt sich nur in verschiedene Formen.«
Als Zeugen dieses Wandels sind wir zwiegespalten. Wir beklagen die Vergänglichkeit der Dinge, wie sie alt werden und zu Staub zerfallen, doch gleichzeitig freuen wir uns über die Veränderungen, die das Neue mit sich bringt: wenn der Schnee auftaut und die ersten Blüten treiben. Wir nennen Veränderungen schmerzhaft, aber wir freuen uns über die Erfahrung der Erneuerung. Wir haben Angst im Spiegel ein Gesicht zu sehen, in dem wir uns nicht mehr wiedererkennen, trotzdem bewundern wir reifes Alter und die Weisheit, die sich zuweilen mit ihm einstellt.
Ernest Renan sagt in seinem ›Séminaire d’Issy‹, »endlose Vielfalt scheint mir das Gesetz der Welt«. Das trifft besonders auf den Leser zu. Unsere Bibliotheken sind Metamorphosen-Kataloge, in denen nicht nur vielgestaltige Figuren wie Melusine, Gregor Samsa, Dr. Jekyll, Pinocchio und Dorian Gray zu finden sind, sondern auch unser eigener multipler Charakter. Unsere Bücher verändern uns, und wir wandeln uns mit ihnen, so dass wir nie zweimal die gleiche Geschichte lesen. Innerhalb dieses Katalogs ist der Kafka, den wir nach (oder vor) Wilde gelesen haben, nicht derselbe Kafka wie derjenige, den wir vor (oder nach) der Lektüre von Stevenson kennenlernen. Doch im Unterschied zu den Schlangen sammeln wir Leser, Schicht um Schicht, unsere alten Häute. Denn, um mit Dante zu sprechen, das Papier dieser Bücher wird uns nie mehr völlig weiß erscheinen.
Alle Figuren in der Literatur sind en train de devenir, sie sind immerzu darin begriffen, etwas anderes zu werden. Sie sind sie selbst und doch wieder nicht. Ihre Eingebungen, Wünsche und Albträume gehen ein in die, welche sie erträumt, gelesen oder geschrieben haben. Die Welt der Literatur existiert in einem Zustand des konstanten Flusses, als strebe sie ohne Unterlass danach, etwas anderes zu werden: etwas besseres, noch fremderes. Als strebte sie endlos nach der Unsterblichkeit. Deshalb gilt in diesem Universum nicht nur eine Betrachtungsweise, denn alles formt sich konstant neu. Das erinnert an die eindringlichen Worte des heiligen Paulus (1 Korinther 15, 51):
»Seht ich enthülle euch ein Geheimnis: Wir werden nicht alle entschlafen, aber wir werden alle verwandelt werden – plötzlich, in einem Augenblick, beim letzten Posaunenschall. Die Posaune wird erschallen, die Toten werden zur Unvergänglichkeit auferweckt, wir aber werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muß sich mit Unvergänglichkeit bekleiden und dieses Sterbliche mit Unsterblichkeit.«
Eine weitere Szene aus ›Alice im Wunderland‹ illustriert diesen paulinischen Gedanken einer ewig währenden Multiplizität: In ihr wird nicht nur die multiple Identität von Alice angedeutet, sondern auch die ihrer Leser. Sie findet sich in einem der ersten Kapitel des Buches. Nachdem Alice den Tunnel des Kaninchenbaus hinunter ins Wunderland gefallen ist, hat sie dort das Gefühl, als sei sie nicht mehr sie selbst, und fragt sich, wer sie nun eigentlich ist. Doch anstatt zu verzweifeln entscheidet sie sich einfach dafür, so lange zu warten, bis jemand kommen und nach ihr rufen wird: »Komm wieder herauf, Herzchen.« Dann wird sie antworten: »Wer bin ich? Sag mir das erst, und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen, wenn nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin.«
Auf diese Weise werden die vielen Gesichter, die unserem forschenden Blick in Träumen und im alltäglichen Leben begegnen (es sind immer unsere eigenen), schließlich zu einem Teil von uns. Zunächst mag uns ihr Auftauchen amüsieren oder verwirren, aber mit der Zeit werden sie für uns zu einer zweiten Haut. Proteus veränderte zwar dauernd seine Gestalt, aber nur solange, bis ihn jemand packte und festhielt: Erst dann konnte der Gott als der gesehen werden, der er wirklich war: eine Amalgam aus allen seinen multiplen Identitäten. Ebenso verhält es sich mit den Myriaden an Identitäten, die uns ausmachen. Immerzu verändern sie sich, zerrinnen vor unseren Augen und vor den Augen anderer, bis wir irgendwann dazu in der Lage sind, zu dieser Vielfalt das Wort Ich zu sagen. Dann hört sie auf, Illusionen, Wahnbilder oder Spekulationen zu sein und wird zu einer Epiphanie von erstaunlicher Eindringlichkeit.
Aus dem Englischen von Achim Stanislawski
Literatur:
Dante Alighieri, Göttliche Komödie, XXV. Gesang, übers. v. Herman Gmelin, Stuttgart 2001.
Die Bibel. Einheitsübersetzung, Stuttgart 1980.
Ovid, Metamorphosen, übers. von J. H. Voß, Frankfurt am Main 1990.
Lewis Carroll, Alice’s Abenteuer im Wunderland, übers. v. Antonie Zimmermann, Leipzig 1869.