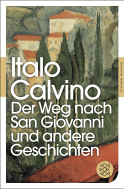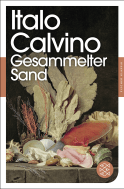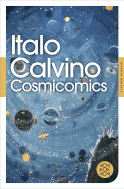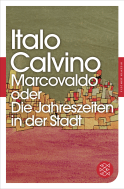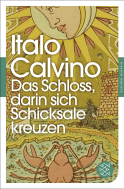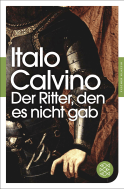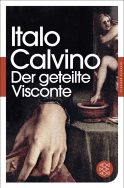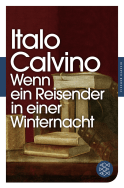Calvino30: Caterina Bonvicini: Viva Calvino!
Vor 30 Jahren schrieb Italo Calvino seine berühmten Harvard-Vorlesungen. Zur Erinnerung und Bestandsaufnahme im Wintersemester 2015/16 haben sich mehrere Autorinnen und Autoren diese Vorlesungen noch einmal angesehen: Caterina Bonvicini hat schon als Kind ihren Landsmann Calvino gelesen.

Dreißig Jahre ist es her, dass Calvino seine Harvard-Vorlesungen ›Sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend‹ schrieb. Ich werde bald einundvierzig und kann fast siebenunddreißig Jahre der bedingungslosen Liebe zu ihm feiern. Ja, ich habe ihn entdeckt, als ich vier war.
Mama las mir nicht nur die ›Italienischen Märchen‹ vor, die Calvino aus verschiedenen Dialekten in sein wunderbar präzises Italienisch übertragen hatte, sondern nahm die Geschichten für mich auch auf Kassette auf, so dass ich sie immer hören konnte, auch wenn sie nicht da war. Die Einaudi-Ausgabe, aus der wir lasen, habe ich noch immer. Auf Seite 573 des zweiten Bandes ist ein riesengroßer Kaffeefleck, da muss meine Mutter eine ganze Espressotasse verschüttet haben, aber das wundert mich nicht, sie hatte immer ein besonderes Talent für Missgeschicke. Dieser Fleck erinnert mich daran, dass sie mir Calvino im Bett vorlas, morgens.
Abgesehen vom Kaffeefleck, findet sich neben jedem Märchen eine Zeichnung von mir. Da ich noch nicht schreiben konnte, hatte ich mir ein paar Zeichen ausgedacht, um meiner Zustimmung Ausdruck zu verleihen. Da gibt es Rauten, durchgestrichene Kreise (die wie Planeten aussehen), Männchen, denen die Haare zu Berge stehen, auf dem Kopf stehende Zetas und verschiedene weitere Kritzeleien, die hier schwer in Worte zu fassen sind. Ich kann nur sagen, dass meine Lieblingsgeschichten, wie ›Kicherling und der Ochse‹, mit einem VV markiert sind, was bedeutet: Viva Calvino! Das weiß ich, weil ich die Schallplatten meiner Mutter mit denselben Zeichen bekritzelte, und Mozart ist voller VVs (Viva Mozart!).
Meine ganz persönliche Konstellation der Leichtigkeit nahm bereits hier ihren Anfang. Ich ging noch in den Kindergarten, aber einige elementare Fixsterne hatte ich bereits ausgemacht.
Lesen gelernt habe ich mit ›Marcovaldo oder Die Jahreszeiten in der Stadt‹. Und Schreiben auch, glaube ich. Ich war in der Grundschule, als mein Name in Schreibschrift zum ersten Mal in einem Buch auftauchte. Neben einem blauen Stempel, den mir meine Großmutter geschenkt hatte: ›Caterina Bonvicini Ex Libris‹. »Wenn du ein Buch verleihst, weiß dann jeder, wem es gehört«, sagte sie.
1985, als Calvino seine Harvard-Vorlesungen ›Sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend‹ schrieb, war ich elf und las, auf einem Baum sitzend, seine Romantrilogie ›Unsere Vorfahren‹. Ich identifizierte mich mit dem ›Baron auf den Bäumen‹. In unserem Garten gab es einen relativ kleinen Feigenbaum, auf den ich leicht klettern konnte, mit einem verkrüppelten Ast, einem ausnehmend bequemen natürlichen Sitz. Mein Hund Jerome, ein riesiger Airdale Terrier mit struppigen Locken und herzerwärmendem Beschützerinstinkt, schlief unten, neben dem Baum. Die Ausgabe, die ich auf dem Feigenbaum las, habe ich heute nicht mehr, weil ich damals einen Bibliotheksausweis beantragt hatte und alles nur auslieh. Es gefiel mir, einen Titel nach dem anderen auf einer Karteikarte zu notieren und zu sehen, wie sie mit mir zusammen weiter wuchs.
Obwohl mein Großvater bei den Partisanen gewesen war und mir alles und noch viel mehr über den Widerstand erzählen konnte, fand ich erst im Gymnasium einen Zugang dazu, als ich Pavese, Vittorini und Fenoglio las. Damals tauchte auch Calvino wieder in meinem Leben auf, in einer Garzanti-Ausgabe von 1989. Daraus schließe ich, dass ich fünfzehn war, als ich ›Wo Spinnen ihre Nester bauen‹ gelesen habe. Viele Passagen im Vorwort sind wild unterstrichen und mit diversen NBs (Nota Bene) versehen. Der Roman war nie einer meiner Lieblinge, aber im Vorwort spricht Calvino davon, was es bedeutet, das erste Buch zu schreiben. Und das war es, was ich gerade tat (mit Bleistift, in ein kariertes Schulheft – wer weiß, wo es gelandet ist). Natürlich war es eine ziemliche Pfuscherei, die ich da fabrizierte, schließlich war ich erst fünfzehn, aber anscheinend machte ich mir schon Gedanken über das, was ich tat.
»Solange dieses erste Buch nicht geschrieben ist, hat man jene Freiheit des Beginns, die man nur einmal im Leben nutzen kann«, schrieb Calvino, »das erste Buch legt dich schon fest, obwohl du eigentlich noch gar nicht festgelegt bist«.
Damals konnte ich noch nicht ahnen, dass ich dann tatsächlich mein erstes Buch ausgerechnet bei Einaudi veröffentlichen würde, mit vierundzwanzig, im selben Alter wie Calvino, als sein erster Roman ›Wo Spinnen ihre Nester bauen‹ herauskam.
Bereits in meinem ersten Buch, das »dich schon festlegt«, wie Calvino sagt, kam der Leichtigkeit in meinem Schreiben der größte Stellenwert zu. Und das war keine zufällige Entscheidung. Sondern eine bewusste, nein, mehr als das: eine verinnerlichte.
Ich begann diesen Roman 1998, während meiner Abschlussprüfungen in Sprach- und Literaturwissenschaften an der Universität von Bologna. Ich hatte mir das zweite Examen in Italienischer Literatur bis zum Schluss aufgehoben, weil ich das Studium mit einem wunderbaren Stoff glanzvoll abschließen wollte. Mit dem Thema, das ich gewählt hatte, schloss sich in gewisser Weise ein Kreis, dessen Anfang in meiner Kindheit lag. Es war ein Kurs über Calvino. Über all seine Bücher, all seine Aufsätze, dazu verschiedene Publikationen über ihn. Damals nahm man seine Sache in Bologna ernst: Man war gründlich und las auch mal dreißig Bücher für eine Prüfung. Leider hatte ich mir damals angewöhnt, alles mit einem Textmarker anzustreichen, und so habe ich die opera omnia meines Lieblingsautors ruiniert. Aber Calvino ist mir ein für alle Mal ins Blut übergegangen.
Nachdem ich mir in den ersten zwanzig Jahren eine Überdosis Calvino zugemutet hatte, habe ich ihn in den folgenden zwanzig Jahren kaum einmal zur Hand genommen. Nur um die Bücher von einem Ort an einen anderen zu bringen, bei meinen vielen Umzügen. Ich habe sie immer mitgenommen, in jede Wohnung, in jede Stadt, von den kaffeebefleckten ›Italienischen Märchen‹ bis zum letzten Werk. Es war mir wichtig, ihn bei mir zu haben, falls ich ihn brauchte. Erst jetzt wird mir bewusst, dass ich einen Umgang mit Calvino pflegte, wie es ein Kind mit der Stimme seiner Mutter tut. Diese Idee mit der Aufnahme war genial und im Grunde ziemlich avantgardistisch. Ich verdanke meiner Mutter und diesem ›Kicherling‹ viel, das ist gar keine Frage.
Das Märchen ›Kicherling und der Ochse‹ erzählt von einer Kichererbse, aus der ein Kind wird, das aber so winzig ist, dass es von niemandem gesehen wird. Doch seine Stimme ist kräftig, und jedes Mal verändert sie das Schicksal derjenigen, die sie hören. Wer konnte sich vorstellen, dass auch meine Schriftstellerei ihren Ursprung in einer Kichererbse haben würde?
Schaue ich in den Spiegel, einen literarischen, von der Art, wie Calvino sie so sehr mochte, woran erkenne ich seinen Einfluss auf mich? Mein Blick ist eine Mischung aus Melancholie und Humor.
»Wie Melancholie die leicht gewordene Traurigkeit ist, so ist Humor das Komische, das seine körperliche Schwere verloren hat.« Das ist die Alchemie der Leichtigkeit.
Was ich schreibe, ist weder tragisch noch komisch. Ich arbeite mit meiner Verzweiflung wie mit meinem Lachen – niemals die Leichtigkeit aus dem Blick verlierend -, damit das Schreiben die Dinge ein wenig von der glühenden Materie wegrückt, die mich zu sehr gefangen nimmt. Ich glaube, dass Leichtigkeit die Gnade der Distanz ist.
Wenn ich meine Stirn betrachte, sehe ich drei nicht besonders hübsche Falten, die sie horizontal durchschneiden. Um nichts auf der Welt würde ich sie mit Botox füllen. Ich bin stolz auf diese schrecklichen Falten. »Es (…) [gibt] eine Leichtigkeit der Nachdenklichkeit (…), so wie es bekanntlich eine Leichtigkeit der Frivolität gibt; ja die nachdenkliche Leichtigkeit kann sogar die Frivolität als schwer und opak erscheinen lassen.« Meine Falten markieren eine Grenze: diese Grenze. Ich wäre eine schwere, opake Person, wenn ich meine Falten glätten ließe. Das bin ich nicht. Diese drei Falten sind da, und sie werden sich tiefer eingraben, und das ist gut so, solange meine Sätze sich umgekehrt proportional zu ihnen verhalten.
Ich betrachte meine Oberschenkel, meine Knie, meine Waden, meine Füße. Leider war ich nie dünn, aber Leichtigkeit hat nichts mit Magerkeit zu tun. Im Gegenteil. Man braucht gut trainierte Muskeln, vor allem in den Beinen, um leicht zu sein. Und ich pflege meine Muskeln. In letzter Zeit gehe ich sogar laufen, weil ich entdeckt habe, dass das Laufen immens viel mit meinem Schreiben zu tun hat.
Um zu verstehen, wie wichtig die Muskeln in den Beinen für die Leichtigkeit sind, müssen wir für einen Augenblick die Harvard-Vorlesungen beiseitelassen und Skifahren gehen. Ich bin immer für Exkursionen außerhalb der Literatur zu haben, meiner Meinung nach dienen sie dazu, später wieder besser hineinzufinden. In diesem Fall ist die Exkursion rein metaphorisch, aber zum Luftschnappen eignet sie sich trotzdem. Wir bewegen uns von einem Buch zum nächsten und machen einen Abstecher in eine Erzählung Calvinos: ›Abenteuer eines Skifahrers‹.
Am Skilift steht eine lange Schlange. Während alle anderen drängeln und schubsen, ist da ein Mädchen mit einer himmelblauen Kapuze, die sich etwas abseits hält. Sie geht zu Fuß den Berg hinauf, leichtfüßig auf ihren Steigfellen. Schon hier wird deutlich, dass die Leichtigkeit »mit Präzision und Entschlossenheit zu tun hat, nicht mit Unbestimmtheit und Zufallsergebenheit«.
Dieselbe Gruppe, die so gedrängelt hat, stürzt schließlich vom Gipfel den Hang hinunter, fährt Schuss, um Mut oder wer weiß was zu beweisen. Sie nicht, sie bevorzugt ihr »gleichmäßiges Vor und Zurück«. Diese Piste steht für die Literatur. Und das skifahrende Mädchen mit der himmelblauen Kapuze meint die Leichtigkeit (Viva Calvino!).
Calvino und sein Streben nach Leichtigkeit, denn das ist es, ein Streben. Im Grunde ist die Leichtigkeit eine Art Utopie. Eine Übung in Demut, eine körperliche Anstrengung, aber vor allem eine Utopie. Eine Art unerreichbarer Planet, der Planet des Perfekten Schreibens, der nicht existiert. Auf diesem Planeten unterläuft den Menschen niemals ein falsches Zeichen, ihnen fliegen die richtigen Worte mühelos zu. So wie das Mädchen mit der himmelblauen Jacke nie eine falsche Bewegung macht, nie eine Kurve verfehlt.
»Alle Bewegungen gelangen ihr auf die einfachste und natürlichste Art«, schreibt Calvino, »passend zu ihrer Person, ohne auch nur einen Zentimeter übers Ziel zu schießen, ohne den Schatten einer Anstrengung oder Verwirrung oder Verkrampfung im Bemühen, etwas um jeden Preis zu machen, einfach nur so, auf ganz natürliche Weise. Wobei sie sich sogar auch je nach dem Zustand der Piste erlaubte, ein paar etwas ungewisse Bewegungen zu machen, wie jemand, der auf Zehenspitzen geht, was ihre Art war, Schwierigkeiten zu überwinden, ohne erkennen zu lassen, ob sie sie ernst nahm oder nicht. Kurzum, nicht mit der sicheren Miene dessen, der eben tut, was getan werden muss, sondern mit einer Spur von Zurückhaltung, als versuchte sie, einen guten Skifahrer zu imitieren, und bekäme es dann sogar jedes Mal besser hin(…)«, schreibt er weiter, »(…)ihre wie eine oszillierende Klammer gezeichnete himmelblaue Figur [war] durchaus noch erkennbar, ja sie blieb die einzige, die man verfolgen und unterscheiden konnte, dem Zufall und dem Chaos enthoben. Die Luft war so klar, dass der Junge mit der grünen Sonnenbrille glaubte, im Schnee das dichte Netz der geraden und schrägen Skispuren zu erraten, die Streifen, die Buckel, die Löcher, die Eindrücke der Skistockteller, und ihm schien, dass da in dem formlosen Sammelsurium des Lebens die geheime Linie verborgen war, die Harmonie, die allein das himmelblaue Mädchen zu finden vermochte, und dass genau dies ihr Wunder war, jederzeit im Chaos der tausend möglichen Bewegungen die eine und nur diese eine zu wählen, die richtig und klar und leicht und notwendig war, die eine Geste und nur diese eine von tausend, auf die es ankam.«
Raffaele La Capria schreibt in seinem Aufsatz ›Il passo dell’anatra‹ (›Die Gangart der Ente‹) – für uns Italiener inzwischen ein Klassiker –, wie mühsam es ist, die Leichtigkeit zu erreichen. »Sollte ich mich wirklich für einen Stil, eine Gangart entscheiden, die mir am besten gefällt, würde ich sagen, es ist die der Ente, die ohne erkennbare Anstrengung ruhig und gleichmütig in der Strömung des Flusses treibt, während ihre Füße unter Wasser wild und angestrengt rudern. Aber man sieht es nicht.«
Die Leichtigkeit ist ein Ergebnis, so würde ich es nennen. Im Verborgenen strampelt man sich wie wild ab, doch die Anstrengung darf nie sichtbar werden, alles muss ganz natürlich erscheinen, mühelos, selbst wenn die Mühe enorm ist. Wie Wisława Szymborska in ›Unter einem kleinen Stern‹ schreibt: »Nimm mir nicht übel, Sprache, dass ich pathetische Worte entlehne und mir dann Mühe gebe, sie leicht erscheinen zu lassen.«
Calvino behandelt das Thema der Leichtigkeit nicht nur in den Harvard-Vorlesungen. Zum Beispiel schreibt er in ›Gesammelter Sand‹ über eine Ausstellung von Fausto Melotti im Forte di Belvedere in Florenz. Die Leichtigkeit der Skulpturen Melottis (darunter eine mit dem Titel ›Die Eintagsfliegen‹) inspiriert ihn zu einem Dialog zwischen einem Schwarm Eintagsfliegen, geflügelten Wesen, deren Lebensdauer nicht mehr als anderthalb Stunden beträgt, und einer Festung. Der Schwarm stößt im Flug an die Mauern der Festung, geht zum Sturm auf den Hauptturm über und nimmt die Wehrtürme ein. Die Festung wehrt sich mit den Worten: »Nur wer zum Dauern geschaffen ist, kann behaupten, zu sein. Ich dauere, also bin ich; ihr nicht.« Darauf antworten die Fliegen: »Wir huschen durchs Leere so wie die Schrift übers weiße Papier und die Flötentöne durch die Stille. Ohne uns bleibt nur die allmächtige und allgegenwärtige Leere, die so schwer ist, dass sie die Welt erdrückt, die Leere, deren vernichtende Kraft sich mit kompakten Festungen überzieht, die massive Leere, die nur aufgelöst werden kann durch das Leichte und Schnelle und Feine.«
Und damit kommen wir auf den Punkt. Warum nach Leichtigkeit streben? Wenn die Literatur ein Streben nach Bewusstsein ist, sagt Calvino, wenn man in ihr etwas Existentielles sieht, dann kann das Streben nach Leichtigkeit als Reaktion auf die Schwere des Daseins verstanden werden.
Meiner persönlichen Konstellation der Leichtigkeit kann ich noch viele Sterne, also viele VVs hinzufügen. Einige meiner Viva-Rufe gelten geliebten Dichterinnen und Dichtern wie Emily Dickinson, Eugenio Montale oder Patrizia Cavalli. Doch am meisten wünsche ich mir, dass mein Schreiben dem ›Akrobaten‹ Wisława Szymborskas ähneln möge, der von einem Trapez zum anderen springt, »durch die bestürzte Luft« »mühsam leicht, geduldig flink, mit kalkulierter Eingebung«. Viva Szymborska!
Aus dem Italienischen von Julika Brandestini.
›Der Akrobat‹ und ›Unter einem kleinen Stern‹ zitiert nach dem Band der Polnischen Bibliothek ›Hundert Freuden‹, Suhrkamp Verlag, 2. Aufl. 1991 (Übers. von Karl Dedecius).
Alle Texte von Italo Calvino wurden nach der Ausgabe seiner Werke im Fischer Taschenbuch Verlag zitiert.