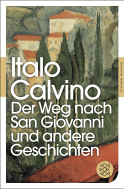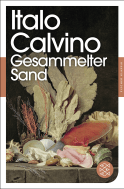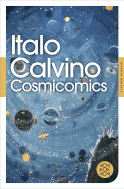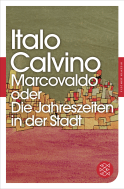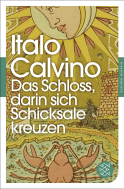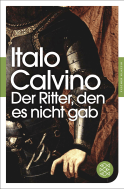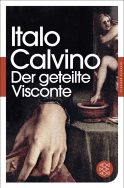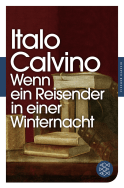Calvino30: Thomas Brussig: Worüber wir reden, wenn wir von Literatur reden
Vor 30 Jahren schrieb Italo Calvino seine berühmten Harvard-Vorlesungen. Zur Erinnerung und Bestandsaufnahme im Wintersemester 2015/16 haben sich mehrere Autorinnen und Autoren diese Vorlesungen noch einmal angesehen: Thomas Brussig über Literatur als Methode.
›Sechs Vorschläge für das nächste Jahrtausend‹ nannte Italo Calvino seine Vorlesungsreihe an der Harvard-University im Jahre 1985, und ihm wird wohl bewusst gewesen sein, dass, wann immer Schriftsteller »Vorschläge« machen, diese kopfnickend entgegengenommen, im Folgenden aber ignoriert werden. Nun zielen Calvinos Vorschläge gar nicht mal auf ein allumfassendes Weltverbesserertum, wie es der Titel mit so einem Absolutwort wie »Jahrtausend« noch suggeriert, sondern lediglich auf die Literatur – ignoriert werden können sie trotzdem. Das »kopfnickende Entgegennehmen« erleben wir insofern, dass Calvinos Vorlesungsreihe übersetzt, gedruckt, verbreitet und seinen Schriftsteller-Nachfahren zum »Sagt mal was dazu« vorgelegt wird. Unser Job wäre nun, seine Vorschläge zu ignorieren.
Kern seiner These – und es ist an Unis immer gut, mit einer »zentralen These« aufzuwarten – ist, dass die Literatur, wenn sie dauerhaft sein will, sozusagen eine Wetterfestigkeit fürs dritte Jahrtausend erlangen will, bestimmte »Werte oder Qualitäten oder Eigenheiten« haben muss, die da wären Leichtigkeit, Schnelligkeit, Genauigkeit, Anschaulichkeit, Vielschichtigkeit und Haltbarkeit.
Warum gerade diese sechs Qualitäten? Wenn Calvino acht, neun oder zwölf Vorlesungen hätte halten sollen, wäre er vielleicht auch auf »Authentizität«, »Welthaltigkeit«, »Relevanz« oder »Erfahrungssättigung« gestoßen, um mal ein paar Säue zu nennen, die von unseren lieben Kritikern saisonal durchs Dorf getrieben werden. Und hätte Calvino nur vier Vorträge halten dürfen, dann wäre ihm schnell klar geworden, dass »Leichtigkeit«, »Schnelligkeit« und »Genauigkeit« ein und dasselbe sind, und zwar »Eleganz«.
Ärgerlich ist diese Aufzählung auch, weil es Calvino besser weiß. Denn er spricht selbst vom »unendlichen Universum der Literatur«. Ich würde Calvino nicht mehr ernst nehmen können, wenn er behauptet, Literatur dürfe nicht anders als leicht, schnell, präzise usw. sein. Aber womöglich muss man an amerikanischen Universitäten, die schon damals die Brutstätte einer mittelalterlich-geistfeindlichen political correctness waren und die sich wenige Jahre später in den Klauen der strukturalistischen Bestie befanden, mit vereinfachenden Thesen aufwarten. In dem Land, in dem Hollywood-Erzähldoktrinen herrschen, werden eben Literatur-Ingredienzien-Aufzählungen erwartet. Ich unterstelle, Italo Calvino spielte in Harvard den Schriftsteller. Ein Meisterkoch, der wusste, dass er eine Woche in der Frittenbude stehen muss. Tatsächlich war er jedoch Schriftsteller und Literatur-Liebender genug, dass auch sein Show-Auftritt bemerkenswerte Gedanken und Auffassungen aufblitzen lässt. Kern dieses Artikels wird das Interesse für einen einzigen Satz Calvinos sein. Doch dazu später. Zunächst will ich mich Calvinos Liste widmen, genauer: sie zusammenstreichen.
Dass »Leichtigkeit« und »Genauigkeit« ein und dasselbe sind, wird jeder, der schreibt, sofort verstehen, und alle anderen, wenn sie einen Moment innehalten und darüber nachdenken. Über Leichtigkeit redet Calvino leider wie der Blinde von den Farben. Seine Aussage, dass seine Tätigkeit schon immer, »vorwiegend darin bestand, Gewicht wegzunehmen«, klingt zwar gut – ich weiß sofort, was er meint –, aber ich glaube ihm nicht. Ein wahrer Leichtigkeits-Missionar würde nicht vom »unendlichen Universum« sprechen, wenn »Universum« genügt.
Calvino weiß, dass Leichtigkeit wichtig ist, er interessiert sich für sie – aber er beherrscht sie nicht. Was sich auch an Schlampigkeiten zeigt (schlampig ist ein Gegenteil von präzise und Präzision die Voraussetzung für Leichtigkeit), wenn er über Leichtigkeit nachdenkt. So bringt er den zunächst einleuchtenden, auf jeden Fall gut klingenden Gedanken ins Spiel »Es gilt, leicht zu sein wie ein Vogel, nicht wie eine Feder.« Und er schreibt sogar: »Für mich verbindet sich Leichtigkeit mit Präzision und Bestimmtheit, nicht mit Vagheit und Zufall.« Abgesehen davon, dass er hier höchst selbst Leichtigkeit und Genauigkeit in Symbiose sieht, ist das Vogel-Feder-Bild überhaupt nicht präzise. Es ist vage, und Vagheit lehnt Calvino erklärtermaßen ab. Doch würden mir Erstleser oder Lektor sagen, mein Text sei leicht wie eine Feder, müsse aber leicht sein wie ein Vogel, wäre ich hilflos, wüsste nicht, was gemeint ist. »Ich soll ihn also vogelleicht machen, den Text? Ihm das Federleichte austreiben und mit Vogelleichtem impfen? Von welchem Vogel reden wir eigentlich? Pinguin ja wohl nicht. Vielleicht Adler? Spatz? Eule? Taube? Zaunkönig, Schwalbe, Möwe?«
So wie Leichtigkeit und Genauigkeit in einem symbiotischen Verhältnis stehen – und dass das eine dem anderen IMMER hilft, weiß jeder, der mal erlebt hat, das ein (gut durchdachter) Satz mehr sagen kann als ein Absatz, dass ein (treffendes) Wort mehr sagen kann als ein Nebensatz – so stehen auch Genauigkeit und Anschaulichkeit in Symbiose. Anschaulichkeit hilft IMMER der Genauigkeit – und umgekehrt. Auch hier gilt: dass Genauigkeit sowohl mit Leichtigkeit als auch mit Anschaulichkeit symbiotisch verbunden ist. Dass Präzision ein absolutes Muss für Texte mit literarischem Anspruch ist[1], ist längst bekannt. Ein Autor, dessen Namen ich vergessen habe, berichtete von seiner Grundschullehrerin, die während des Aufsatzschreibens klatschend durch die Reihen schritt und forderte: »Sei präzise, sei präzise!«
So komme ich nicht umhin, die ersten vier Calvino-»Vorschläge« einzudampfen: »Leichtigkeit« und »Genauigkeit« sind ein und dasselbe, »Genauigkeit« und »Anschaulichkeit« auch. (Pedanten und Wortklauber, die über die Wörter »sind dasselbe“ stolpern, biete ich »haben große Schnittmengen« an.) Kommt nun noch »Schnelligkeit« dazu (die schon naturgemäß nicht so weit von Leichtigkeit entfernt liegt), haben wir »Eleganz«. Die ist in Deutschland verpönt. (Warum eigentlich?)
Die beiden letzten Punkte in Calvinos Liste, »Vielschichtigkeit« und »Haltbarkeit« sind natürlich auch synonym. Haltbarkeit erhält ein Werk einzig und allein dadurch, dass es immer wieder neu gelesen wird, nie ausinterpretiert ist – also vielschichtig. Es ist mir manchmal geradezu peinlich, nach einigen Jahren Büchern wiederzubegegnen, die ich einst für ihre klare Intention liebte. Nichts gegen Bücher, die mal genau zu ihrem Moment das Richtige waren, aber »Haltbarkeit« bedeutet nun mal, für jeden Moment etwas Richtiges zu bieten – und das geht nur durch Vielschichtigkeit. Über ›Hamlet‹ schrieb mal einer, dessen Namen ich leider vergessen habe, Shakespeare verlange im ›Hamlet‹ von uns, etwas zu verstehen, was er, Shakespeare, selbst nicht verstanden habe. Nun mag ein Buch wie ›Der kleine Prinz‹ vielleicht beweisen, dass auch, gelinde gesagt »Unterkomplexes« dauerhaft sein kann. Möglichen Einwänden aus der »Kleinen-Prinz«-Forschung, dass wir es hier mit einem vielschichtigen Werk zu tun haben, beuge ich mich sofort. Sorry, da hab ich wohl was übersehen.
Ein grundsätzliches Missverständnis zwischen der Literatur und denen, die sich mit ihr beschäftigen liegt darin, dass die Literatur als ein Apparat zur Hervorbringung von Werken betrachtet wird. Das ist ungefähr so, als würde die Evolution als ein Prozess zur Hervorbringung von Arten verstanden. Von Literatur zu sprechen, bedeutet im landläufigen Verständnis, von Werken zu sprechen. Und über Literatur allgemein zu sprechen, heißt dann, von den großen Werken, den Klassikern, dem Kanon, zu sprechen. Aber mal ehrlich: Was gibt dem ›Don Quixote‹ das Zeug zum Klassiker? Es ist nur ein Bild (und womöglich ein [Anti-]Heldentypus; ähnliches gilt für den ›Schwejk‹). Was ist mit den sieben Bänden Proust? Werden üblicherweise reduziert auf die Sache mit der Madeleine (keine Geliebte, sondern ein Gebäck). Beim ›Mann ohne Eigenschaften‹ haben wir nicht mal die Reduktion auf ein Bild, sondern nur die parodistische Vervielfältigung des Titels (wie »Land ohne Eigenschaften«). Eine Zeitschrift machte sich mal den Spaß, einen Auszug vom ›Mann ohne Eigenschaften‹ inkognito an diverse Verlage zu schicken und dann deren Absagen zu veröffentlichen; nur ein Verlag antwortete wohl »ganz interessant, bitte mehr« – doch kein einziger Verlag erkannte das Manuskript als eine Schöpfung Musils. Einen weiteren deutschen Klassiker, Goethes ›Faust‹ habe ich mir mal im Theater ungekürzt reingezogen (Regie Peter Stein, mit Bruno Ganz und Robert Hunger-Bühler), und als nach zwei Tagen endlich alles vorbei war, guckte sich das Publikum mit etwa dem Ausdruck von Stolz an, mit dem du eine Zahnarztpraxis nach stundenlanger Wurzelbehandlung verlässt. Und selbst der Klassiker aller Klassiker, Shakespeares ›Hamlet‹, endet in der Mehrheitsmeinung mit den Worten »Der Rest ist Schweigen«, einfach weil die eigentliche Schlussszene, Fortinbras’ Eintreffen am dänischen Hof, üblicherweise für die Bühne weggekürzt wird. Was ich damit sagen will: Wenn wir unsere Klassiker nicht kennen, dann gibt es sie nicht. Und wenn die Literatur klassische, dauerhafte Werke hervorbringen soll, dann ist sie von erschreckender Ineffizienz. Ach, dann ist sie komplett gescheitert. Wenn wir über Literatur reden, führt ein Reden über und ein Suchen nach Klassiker(n) in die Sackgasse.
Worüber ich rede, wenn ich über Literatur rede: über die Methode. Und jetzt zitiere ich den einen Satz Calvinos in seinen Vorlesungen, der meinen Dreh- und Angelpunkt bildet: »Im unendlichen Universum der Literatur tun sich immer neue Wege auf, die es zu erkunden gilt, nagelneue und uralte Wege, Stile und Formen, die unser Bild von der Welt verändern können... «. Literatur ist also eine Methode, unser Bild von der Welt zu verändern. »Ein Leser klappt das Buch zu, hebt den Blick und schaut anders in die Welt« heißt es bei einem Schriftsteller, dessen Namen ich vergessen habe. Wobei mir letztere Beschreibung noch besser gefällt, da sie die veränderte Weltsicht als Einzelleistung kenntlich macht, während Calvino durch die Verwendung von »unser Bild« die Deutung zulässt, wir würden synchron unser Weltbild ändern (was eine Steuerbarkeit suggeriert, die es nicht gibt).
Dass die Literatur eine »Weltbildveränderungskapazität« hat – darin liegt ihr eigentlicher Wert, auch wenn das riesige Segment der Trivialliteratur sich für diese Fähigkeit der Literatur überhaupt nicht interessiert. Ja, meine Vorstellung von der Welt verändern – das kann Literatur richtig gut. Solange es Menschen gibt, die Fragen an die Welt haben, wird auch gelesen.
Calvino schreibt, dass sich in der Literatur »immer neue Wege« auftun. Betrachtet man die Literatur der letzten einhundert Jahre, dann sieht man, wie die Literatur permanent in Rückzugsgefechte verwickelt wird, in denen sie sich aber auf uneinnehmbare Anhöhen zurückgezogen hat, von denen aus sie ihren Einfluss auf das Denken und die Debatten geltend macht.
Film – Fernsehen – Digitalisierung, das sind die übermächtigen nicht-literarischen Bataillone. Der Film hat den Roman als dominierende Erzählform abgelöst; ein Stoff wie ›Der Graf von Monte Christo‹, oder – aber klar doch! – ›Die Odyssee‹ würde heute gleich verfilmt werden. Der Roman hat sich daraufhin der Subjektivität zugewandt. Die gab es selbstredend schon früher (Robinson Crusoe und Simplex), und auch zu welcher Wucht Subjektivität in der Lage ist, weiß man seit dem ›Werther‹. Dass Filme nicht so ins Gehirn kriechen können[2], nicht mal annähernd, wissen wir spätestens seit ›Natural Born Killers‹, dem filmgeschichtlich ehrgeizigsten Versuch, Subjektivität zu verfilmen. Der Film, eine Scheußlichkeit von 1993, ist zu Recht vergessen, während Subjektivität in der Literatur quicklebendig ist und zwischen ›Tschick‹ und ›Blechtrommel‹, zwischen ›Der Fänger im Roggen‹ und ›Auslöschung‹ ein riesiges Spektrum existiert. Ebenso hat der Film, der von ganz, ganz wenigen Erzählparadigmen dominiert wird, mittelbar eine Explosion der literarischen Formen induziert. Während der (Hollywood-)Film überwiegend linear erzählt, erfindet jeder gute Roman mittlerweile seine eigene Form. Da werden ganz selbstverständlich (und höchst originell!) Chronologien aufgebrochen, Vielstimmigkeiten erzeugt, Perspektiven gewechselt... Wofür ein Film wie ›Pulp Fiction‹ gefeiert und in eine Ausnahmestellung gehoben wird, das ist in der Literatur längst selbstverständlich. Welche Erneuerung der Literatur durch den Film aufgezwungen wurde, ließe sich detailliert in einem eigenen Vorlesungszyklus aufzeigen. Für den Moment halten wir fest, dass der Film die Literatur ähnlich folgenreich unter einen Modernisierungsdruck setzte, wie die Fotografie die Malerei.
Das Fernsehen hingegen ist nicht nur der große Konkurrent, sondern auch der eindeutige Sieger, wenn um unser Zeitbudget gebuhlt wird. Anfang der neunziger Jahre kursierte die Zahl, dass wir durchschnittlich, ob Kind, ob Greis, 318 Minuten täglich (!) vor dem Fernseher zubringen. (Angeblich ist der Fernsehkonsum sogar noch weiter gestiegen.) Verglotzte Zeit wird nicht verlesen. Allerdings ist das Fernsehen schon seit Jahrzehnten offizielles Verblödungs- und Zeitvergeudungsinstrument, das sich ins Joch des Quotendrucks begeben und eine erwartungslose Zuschauerschaft herangezüchtet hat. (Ich selbst verpasse gelegentlich gutes Fernsehen, weil ich vom Fernsehen gar nichts mehr erwarte. Und enttäuschende Quoten bieten den Fernsehbossen ein Alibi, sich von gelegentlich aufkeimenden Qualitätsintentionen zu verabschieden.) Mit der allgemein üblichen Formulierung »vor der Glotze abhängen« geht der Fernsehzuschauer auf Distanz zu sich selbst; doch es gibt bezeichnenderweise keine Formulierung, mit der ein Leser zu Distanz auf sich selbst geht (etwa »mit der Schwarte herumschlagen« o.ä.). Insofern hat das Fernsehen dem Buch das Profil geschärft: Das Buch ist das Andere. Wir haben an das Buch die Erwartung, dass es uns bereichert; fürs Triviale haben wir ja das Fernsehen. Niemand schaltet den Fernseher ein, um den Blick auf die Welt zu verändern. Im Gegenteil: Jeder Viel-Glotzer weiß, dass er sich heute nicht mehr daran erinnern kann, was er gestern gesehen hat. Wohingegen jeder Leser ins Schwärmen gerät über das Buch, das er gerade liest.
Im Moment erleben wir eine interessante Evolution des Formats Fernsehserie, das die epische Breite und den psychologisch differenzierten Helden für sich entdeckt. Wird ein Roman wie Jonathan Franzens ›Unschuld‹ in Zukunft vielleicht gleich in sieben Staffeln mit je dreizehn Fünfundvierzigminütern kommen, als DVD-Box anstatt als Roman? Abgesehen davon, dass ›Unschuld‹ (wie viele andere ähnliche Bücher) mit unverfilmbarer Subjektivität aufwartet, werden auch andere panoramatische Werke, die ins Beuteschema der neuen Fernsehserien passen, ihre fernsehgerechte Ersetzbarkeit mit literarischen Mitteln zu verhindern wissen (und sich mithin auf eine weitere uneinnehmbare Anhöhe zurückziehen).
Während Film und Fernsehen die Literatur der letzten hundert Jahre insbesondere dahingehend beeinflussten, was der Leser von ihr erwarten darf, fasst die Digitalisierung Literatur in ihrer Entstehung an. Die digitale Revolution bedeutet, dass Wissen praktisch jederzeit ganz leicht verfügbar ist. Wozu man früher einen Vormittag lang in Bibliotheken recherchierte, das holt man sich jetzt mit wenigen Klicks. Es ist gängige Alltagspraxis, mit dem Smartphone – auch in Gesprächen – zu klären, wer der Urheber eines Zitats ist, wie ein bestimmtes Produkt erfunden wurde, ob eine bestimmte Berühmtheit noch lebt.[3] Wenn der Zugang zu Wissen aber so lachhaft einfach ist, brauchen wir keine Bücher mehr, die ein enzyklopädisches Wissen ausbreiten. Schriftsteller, die noch vor dreißig Jahren wie die letzten Universalgelehrten wirkten und es vielleicht auch waren, werden durch die Digitalisierung zu Abschreibern degradiert. Ist das schlimm? Nö. Denn im »unendlichen Universum der Literatur tun sich immer neue Wege auf«, und so vermute ich, dass die Digitalisierung der Literatur einen weiteren Subjektivitätsschub verpassen wird, indem wir es mit Büchern zu tun bekommen, die voll von Dingen sind, die sich nicht aus dem Internet ziehen lassen. Literarisch wird sein, was sich nicht googlen lässt. Uns werden Phantasten eine völlig verrückte Weltsicht eröffnen – und nach dreihundert Seiten werden wir zugeben: Dat stimmt! Überhaupt werden Unterdrückte, Randfiguren (auch Randfiguren des Empfindens) stärker an unser Ohr dringen, und ich erlaube mir schon jetzt die Prophezeiung, dass besagte Phantasten, Flüchtlinge, Unterdrückte und Randfiguren »nur« die Erzähler sind, erschaffen von Schriftstellern, die ihr Talent im Kontrast zu dem, was uns die Digitalisierung bringt, zum Leuchten bringen. Es gibt die Redewendung: »Der lügt wie n Augenzeuge! «, und die Literatur wird Augenzeugen hervorbringen, deren Wahrheit im Dissens zu dem steht, was sich im Netz nachlesen lässt.
Das Schöne an der Literatur ist, dass sie für alle Probleme auch eine Lösung parat hat, da ist sie wie die Evolution. Calvino spricht von »Wegen, Stilen und Formen«, »nagelneue und uralte«. Die Literatur als Methode ist unverwüstlich.
Zurück zu Calvino. Der Zufall will es, dass ich mit einem seiner Zuhörer befreundet bin, mit dem Literaturwissenschaftler und Goethe-Kenner Eric Denton. »Eric, du warst tatsächlich in Harvard, als Calvino seine Vorlesungen hielt? Wie wars denn? Erzähl! « – »Puh, ist lange her. Aber es war großartig. Calvino hat darüber geredet, wie die Literatur in Zukunft beschaffen sein muss. Oder worauf sich Schriftsteller konzentrieren müssen. So was. « – »Und wie war das? « – »Wie gesagt, es ist lange her. Ich weiß nur, dass es vor allem großartig war. Er hat so ziemlich dasselbe gesagt, was du immer sagst. Wenn du übers Schreiben redest, denke ich jedes Mal, das habe ich alles schon damals gehört. « – »WIE BITTE? « – »Ja, er hat gesagt, man muss schreiben können und was zu sagen haben. « – »Lieber Eric, ich fürchte, da lässt dich dein Gedächtnis im Stich. Calvino sprach von Leichtigkeit, Schnelligkeit, Genauigkeit und Anschaulichkeit, sowie von Vielschichtigkeit und Haltbarkeit. « – »Hab ich doch gesagt: Man muss schreiben können und auch was zu sagen haben. «
Kurzum: Italo Calvino ist ein Meister des Ausbreitens und Eric Denton ein Meister des Zusammenfassens.
[1] Mangel an Präzision kann als Stilmittel eingesetzt werden, zum Beispiel in wörtlicher Rede, in subjektiven Erzählperspektiven. Als Autor musst du wissen, wie du Präzision dosierst. Präzise müssen nicht unbedingt die Formulierungen sein – aber die Vorstellungen von den Typen, die reden.
[2] Filme kreieren Posen, Augen-Blicke, magische Momente, die größer sind als das Leben. Auch Filme dringen ins Hirn, aber sie benebeln mehr als sie klären. Es ist kein Zufall, dass sich die Werbung des Films bedient, aber so gut wie nie der Literatur.
[3] Ich habe bewusst darauf verzichtet zu checken, ob ›Natural Born Killers‹ tatsächlich von 1993 ist. Ebenso habe ich darauf verzichtet, die aktuelle Minutenzahl des Fernsehkonsums zu ergoogeln; »318 Minuten zu Anfang der neunziger Jahre« halte ich für ausreichend, um das Problem zu illustrieren. (Die Zahl 318 habe ich mir damals gemerkt.)