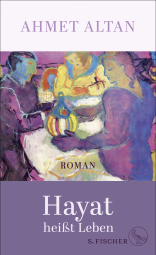
Geschwister-Scholl-Preis 2019: Laudatio für Ahmet Altan von Christiane Schlötzer-Scotland
Am 25. November 2019 erhielt unser Autor Ahmet Altan den Geschwister-Scholl-Preis der Stadt München für »Ich werde die Welt nie wiedersehen – Texte aus dem Gefängnis«. Lesen Sie hier die eindrucksvolle Laudatio für Ahmet Altan von Christiane Schlötzer-Scotland, der Türkei-Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung.
»Die Morgendämmerung zog herauf«, und: »Ich wusste, dass sie kommen würden.« So beginnt Ahmet Altans Gefängnistagebuch. Es ist ein friedlicher Septembermorgen, mit der ganzen Schönheit, die der Himmel über Istanbul zu bieten hat. Das Licht, das Wasser. Ahmet Altan fragt die Polizisten, ob sie einen Tee möchten? Und er erinnert sich in diesem Augenblick an seinen Vater, den Schriftsteller Cetin Altan, der 45 Jahre zuvor an einem Morgen von der Polizei aus seiner Wohnung abgeholt wurde. Der Vater fragte die Polizisten: Wollen sie einen Kaffee?
Als würde sich alles wiederholen in der Türkei, weil dieses Land, wie Altan sagt, »sich in seiner Geschichte sehr langsam bewegt«. Wie unter Zwang, dieselben Fehler immer wieder zu machen.
In seiner Verteidigungsrede vor Gericht im Februar 2018, einem furiosen historischen Kolleg, erinnert Altan an ein Ereignis aus der Endzeit des Osmanischen Reichs, im März 1909. Ein paar Tausend Offiziere versuchten damals gegen die Regierung der Jungtürken zu putschen. Bis heute ist nicht bekannt, wer der militärische Anführer dieser angeblich religiös motivierten Rebellen war. Altan zieht Parallelen zum Putschversuch vom Juli 2016: Auch der Kommandant dieses Putschversuchs ist bis heute unbekannt. Die Rebellion von 1909 festigte die Macht der Jungtürken. Sie schufen danach ein Regime von Unterdrückung und Angst. Da wird die Parallele offenbar. Auch der Putschversuch von 2016 kratzte nicht an der Macht von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Im Gegenteil, die dilettantische Erhebung gab ihm die Chance, seine autoritären Vollmachten auf eine neue Stufe zu heben. »Nach dem 15. Juli 2016 baute die AKP ein Regime von Unterdrückung und Angst auf«, so sagte Ahmet Altan – vor dem Gericht.
Der Autor legt sich auch vor seinen Richtern keinen Maulkorb an, er lässt sich nicht zum Schweigen bringen. Und er bleibt misstrauisch, was die Hintergründe des Putschversuchs betrifft, der zu seiner Verhaftung führte. Die Anklage gegen ihn ist dagegen voller absurder Gewissheiten. Altan zerpflückt sie im Gerichtssaal. Er seziert aber nicht nur dieses Dokument juristischer Peinlichkeiten, sondern auch den Zustand der Justiz in der Türkei. Er hält ein Plädoyer für die Macht des Rechts, und sagt den Richtern ins Gesicht, dass sie ihren Beruf verraten, wenn sie politisch willfährige Urteile fällen. Altan sagt: »Eine Justiz, die schon tot ist oder gerade stirbt, hat einen fauligen Geruch.« Altans Autopsie ist schonungslos.
In seinem 1998 erschienen Roman mit dem Titel »Wie ein Schwertstreich«, der im ausgehenden Osmanischen Reich spielt, lässt Altan eine seiner Heldinnen zu ihrem Sohn sagen: »Hast Du endlich aufgehört, dich zu fürchten, Hikmet?« Die Mutter ist eine Osmanin mit in Paris erworbener Grandezza, der Sohn katzbuckelt aus Angst vor dem Sultan sich durchs Leben. Angst, auch das sagte Altan vor dem Gericht, ist die größte Stärke der absoluten Macht, aber auch ihre größte Schwäche. »Die Angst, die sie verbreiten, ist die Nahrung und das Gift ihrer Macht.«
Man würde zu gerne wissen, was die Richter dachten, als Altan vor ihnen stand und diese Brandrede hielt. »Bravo! Sperrt alle ein!«, schleuderte er dem Staatsanwalt entgegen. »Das ist eure Zeit. Aber die Zeiten ändern sich. Zeiten ändern sich immer«, sagte er.
Ahmet Altan wurde 1950 in Ankara geboren. Als das Militär 1960 putschte, war er ein Kind, als es 1971 wieder putschte, wurde sein Vater verhaftet. Als die Partei Erdogans versprach, die Macht des Militärs politisch in die Schranken zu weisen, begrüßte der Publizist Altan das. Er lobte in den ersten Jahren Erdogans Kurs. Bei Erdogans linken Gegnern machte er sich damit keine Freunde. Der Publizist Ahmet Altan ist ein Mann, der sich zwischen viele Stühle gesetzt hat.
Der Zustand seines Landes ist für ihn heute eine »Tragödie« – oder wahlweise auch eine »Komödie«. Denn wäre das Ende nicht so bitter, dann könnte man lachen über diese juristische Theatralik: Drei Texte für eine Zeitung und ein Fernsehauftritt, und dafür lebenslange erschwerte Haft, die in der Türkei die abgeschaffte Todesstrafe ersetzt.
Bei dem Fernsehauftritt, einen Tag vor dem Putschversuch vom Juli 2016, sagte Altan, und das ist der Satz, der angeklagt wurde: »Die AKP wird ihre Macht verlieren, und sie wird vor Gericht gestellt werden.« Dies wurde als »unterschwellige« Botschaft an die Putschisten gewertet. In der Sendung plädierte Altan für einen Machtwechsel bei den nächsten Wahlen.
Es gibt Urteile des türkischen Verfassungsgerichtshofs, die stellen fest: Nachrichten zu verbreiten, sei für einen Journalisten kein Verbrechen. Kommentare auch nicht. Dem Strafgericht war das egal. Das Urteil stand wohl schon im Voraus fest. In seinem Buch, das hier mit dem Geschwister-Scholl-Preis ausgezeichnet wird, zitiert Altan Elias Canetti in Bezug auf die Richter: »Hochangesehen, in Sicherheit und Seelenfrieden, hören sie sich, von vorneherein entschlossen, sich nicht erweichen zu lassen, die Gesuche der Menschen an.«
An dem Morgen, als die Polizisten in seine Wohnung kamen, kochte Altan sich seinen Tee. »Ich goss mir einen Tee ein, füllte eine Schale mit Müsli und Milch.« Die Polizisten durchsuchten derweil seine Wohnung, verrückten die Möbel. Es ist die Normalität im Unnormalen, die Altan mit wenigen Worten so meisterlich beschreibt.
Ich kenne das Gefühl einer parallelen Wahrnehmung. Ich gehe in Istanbul aus meiner Wohnung, zwänge mich durch die Touristenschlange vor dem Galata-Turm, sehe die gut gefüllten Cafes, Istanbuler beim Sonntagsfrühstück, mit dem Raki-Glas in der Hand in der Nacht. Ich bewundere die unbezwingbare Schönheit dieser Stadt, genieße die süße Normalität des Alltags, und stehe im nächsten Augenblick in Gedanken wieder vor einem Hochsicherheitsgefängnis oder in einem der Gerichtssäle, in denen ich in diesem und dem vergangenen Jahr so viele Stunden zugebracht habe: in Prozessen gegen Journalisten und Akademiker oder gegen den Unternehmer und Kulturmäzen Osman Kavala.
Die Anklagen sind stets so absurd wie bei Altan, so dass ich mir denke, kein Richter kann damit einen Menschen hinter Gitter schicken, für Jahre oder Jahrzehnte. Dass es doch geschieht, ist ein Beweis für die Angst, die Altan beschreibt, die Angst der Macht vor dem Machtverlust, und daher vor jeglicher Opposition.
Bei einem meiner Gerichtsbesuche habe ich einen falschen Gang erwischt, bin in einem Untergeschoss gelandet. Da lagen Berge von rosa Akten am Boden, Schnellhefter, achtlos übereinandergeworfen, wie zusammengekehrt und vergessen. Jede rosa Akte ein Menschenschicksal. Bei Ahmet Altan habe ich dann die Beschreibung eben dieses Aktenberges wiedergefunden, man hat ihn auf dem Weg zur Verhandlung daran vorbeigeführt. Welch ein Kafka-Szenario: »ein aus rosa Akten bestehender geheimer Friedhof«. Altan notierte: »Wir stoßen die Ordner mit den Füßen zur Seite und bahnen uns einen Weg durch den Korridor… manchmal treten wir auch darauf, und dabei überfällt mich ein unangenehmes Gefühl, als ob ich auf Menschen treten würde.«
Man fragt sich, wird dieses Kapitel der türkischen Geschichte irgendwann aufgearbeitet werden? Und von wem? Wird jemand in diesen Akten lesen, oder werden sie vernichtet, bevor sich eine neue Schicht der Geschichte auf die alte legt? So wie in Istanbul einfach immer wieder auf die alte Stadt eine neue Schicht gebaut wird. Wo sie Straße teeren, ohne vorher den Müll wegzuräumen.
Wer einen Schriftsteller von der Sprachkraft Altans einsperrt, muss eigentlich wissen, dass er zum Zeitzeugen und zum Ankläger wird. Sein Gedächtnis hält auch die Geschichten fest, die ihm seine Mitgefangenen erzählen. Sie komplettieren das Bild einer Epoche der großen Verwirrung. Aber Altan glaubt, schon deren Ende zu erkennen. Er lässt dabei sogar der Regierung noch eine Chance der Umkehr: Entweder sie wird umkehren… oder sie wird wahrscheinlich von ihrer eigenen Basis abgesetzt werden. Wörtlich sagte er in seiner Verteidigungsrede: »Die wirkliche große Gefahr für Erdogan sind nicht die Stimmen seiner Gegner, sondern das Schweigen seiner Unterstützer.«
Die AKP hat zuletzt schon ein paar prominente Mitglieder verloren. Monolithisch ist die Macht nicht mehr. Erdogan hat sich deshalb bei den letzten Wahlen mit einer ultranationalistischen Partei, der MHP, verbündet. »Nationalismus ist eine verbreitete Dummheit«, ein billiger Treibstoff der Politik, sagt Altan. Das Bündnis der AKP mit den Ultranationalisten spielt auch im Fall Altan eine Rolle, ich komme noch drauf.
Das Gericht in Istanbul verurteilt Altan am 16. Februar 2018 als »glaubenskämpferischen Putschisten«, einen Mann, der weder gläubig ist, noch je für einen Putsch eintrat. Zehn Tage später verurteilt das Gericht ihn noch einmal, diesmal aber als »marxistischen Terroristen«.
Der objektive Widerspruch dieser Urteile stört die Justiz nicht. Bis das Verfassungsgericht interveniert. Die höchste Justiz ist noch weniger druckempfindlich als die untere Ebene. Das Verfassungsgericht ordnet im Januar 2018 Altans Freilassung an. Das aber wird von einem Strafgericht wieder korrigiert. Untere Gerichte haben in der Türkei zuletzt öfter Urteile der obersten Gerichte ignoriert.
So wird Altan im Februar 2018 erneut zu lebenslanger Haft verurteilt, wie auch sein Bruder Mehmet, ein Wirtschaftsprofessor, der 2016 mit ihm verhaftet wurde.
Damit ist die juristische Geisterbahnfahrt noch nicht zu Ende. Im Juli 2019 hebt der Kassationsgerichtshof, das höchste Berufungsgericht, das Urteil gegen Altan wieder auf und verweist erneut auf die untere Ebene. Mehr juristische Blamage ist eigentlich nicht möglich.
Man kann dies aber auch so interpretieren: In Ankara wird ein Weg gesucht, Ahmet Altan aus der Haft zu entlassen.
Am 4. November 2019 entscheidet dann tatsächlich ein Strafgericht: Altan wird entlassen. Vorher verurteilt es ihn noch zu zehn Jahren und sechs Monaten, wegen »Unterstützung einer Terrororganisation«. Dies ist nach türkischen Kriterien ein milderer Vorwurf. Und weil er schon mehr als drei Jahre im Gefängnis saß, kommt er frei. Vor den Toren des Hochsicherheitsgefängnisses von Silivri bei Istanbul wartet seine Tochter. Freunde nehmen ihn in Empfang. Sein Bruder Mehmet Altan ist bereits früher entlassen worden, am 4. November wurde Mehmet sogar freigesprochen.
Die Bilder von Ahmet Altans Entlassung werden auch in der Türkei verbreitet. Wenige Stunden später legt der Generalstaatsanwalt Widerspruch ein. Der wird von einem Gericht zuerst zurückgewiesen. Der Staatsanwalt geht dann zum nächsten Gericht. Das gibt dem Widerspruch statt.
Am Abend des 11. November stehen die Polizisten wieder vor Altans Wohnung. Diesmal haben sie nicht bis zum Morgen gewartet.
Das ist der letzte Stand. Das neue Urteil von Anfang November ist noch nicht rechtskräftig. Altan wird wieder in Berufung gehen. Vor seiner erneuten Verhaftung hat er noch einen Text für den Guardian geschrieben. Darin heißt es: »Ich weiß, dass es möglich ist, dass sie mich wieder verhaften.«
Warum wusste Altan das? Weil das Irrationale stärker ist als die Rationalität? Weil ihm ein Richter, fast bedauernd sagte, »ach hätten Sie doch immer nur Romane geschrieben und sich nicht mit politischen Themen befasst«? Wie zum Beispiel schon vor Jahren mit dem Schicksal der Armenier oder der Kurden?
Als er 1995 den Türken empfahl, sie sollten sich für einen Moment vorstellen, sie lebten in einem Staat namens Kurdiye, nicht Türkiye, gegründet von einem Mann mit dem Namen Atakurd, nicht Atatürk, zeigte ihm die damals als liberal geltende Zeitung Milliyet die Tür. Und ein Staatsgerichtshof verurteilte ihn zu 20 Monaten Haft.
Altans frühe Romane wurden in Millionenauflagen gedruckt, und übrigens auch wegen ihrer erotischen Freizügigkeit besonders beäugt und viel gelesen. Sie sind von großer sprachlicher Schönheit. Heute sucht man sie vergebens in Istanbuler Buchläden.
Nach Altans Freilassung sagte Devlet Bahceli, der Chef der mit Erdogan verbündeten Ultranationalisten: Einige Freisprüche und Haftentlassungen stünden »im Gegensatz zum Gewissen der Nation«. Es scheint klar, wen er meinte. Die Verurteilung Altans war eine politische Entscheidung, ihn freizulassen, war auch eine politische Entscheidung, ebenso wie die, ihn wieder festzunehmen. Es ist gut möglich, dass diese Entscheidungen nicht von den selben Personen getroffen wurden. Altan ist nun womöglich Opfer eines Machtkampfs in der türkischen Justiz.
Der türkische Literaturnobelpreisträger Orhan Pamuk schrieb vor einer Woche in der Süddeutschen Zeitung, Altans mutiges und entschlossenes Auftreten nach seiner Freilassung habe ihn wieder ins Gefängnis gebracht, weil diese Courage den Unterdrückern Angst mache. Und weiter: »Solange Altan in Haft bleibt, wird uns dieses immer bizarrer werdende Unrecht weiter vergiften.«
In seinem Gefängnisbuch reflektiert der Autor auch über das Heldentum. Er erinnert sich daran, dass sein Vater hunderte Male wegen seiner Schreibens verurteilt wurde. Dass sein Großvater zum Tod verurteilt wurde, weil er während des Befreiungskriegs Aufständischen half, nach Anatolien zu gelangen. Im letzten Moment konnte sich der Großvater retten.
Auch an seinen Urgroßvater erinnert er, der seine Artillerie-Ausbildung in Deutschland erhielt, und zehn Jahre lang an Kriegen teilnahm.
Ein Schriftsteller sollte eigentlich kein Held sein, schreibt Altan, und: »Es kommt vor, dass man auch mich für einen mutigen Mann hält. Das beschämt mich jedes Mal… Ich bin… eher jemand, der gern mutig wäre.« Er fragt sich auch, was ist wichtiger, der Text oder der Autor? Darf der Autor sich retten wollen, oder muss er seine Feder dafür einsetzen, anderen zu helfen?
Er schreibt: »Und wie bei Odysseus wird es auch bei mir Heldentum und Feigheit, Ehrlichkeit und Schlitzohrigkeit, Niederlagen und Siege geben.« Als Sieger fühlt er sich immer dann, wenn er mit der Kraft seiner Fantasie den Mauern des Gefängnisses entflieht, wenn er »mühelos durch Wände« geht.
Ich bin in München einst auf das Sophie-Scholl-Gymnasium gegangen. Ich kann mich erinnern, dass wir Schülerinnen stolz auf den Namen unserer Schule waren. Die Widerstandsgeschichte der jungen Sophie Scholl hat mich später auch stolz auf meine Heimatstadt sein lassen.
Ahmet Altan würde sich gewiss nicht mit dieser Heldin vergleichen. Aber darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass Menschen, die für die Freiheit des Wortes eintreten, bei aller Fehlerhaftigkeit, die auch ihnen unterlaufen kann, dafür büßen sollen, dass sie die herrschende Macht in Frage stellen. Wo aber fast jede Opposition kriminalisiert werden kann, von einer Justiz, die sich nicht scheut, das Recht in jede Richtung zu verdrehen, da gibt es keine Freiheit.
Altan hält dagegen mit seiner stoischen Souveränität, mit Optimismus und Ironie.
Die für mich schönsten Sätze in Altans Buch stehen auf der vorletzten Seite, er beschwört darin die Kraft der Literatur. Und sie sind ein vorausgeschickter Dank an die Leserin und den Leser: »Jedes Auge, das meine Zeilen liest, jede Stimme, die meinen Namen nennt, nimmt mich wie eine kleine Wolke bei der Hand und fliegt mit mir über weite Ebenen, Wälder, Quellen, Meere, Städte und Straßen. Ohne große Worte gewähren meine Freunde mir Gastrecht in ihren Häusern, Sälen und Zimmern.« So wie heute und hier in der Großen Aula dieser Universität.

-
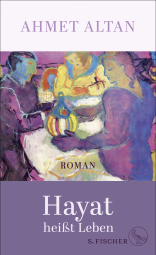 Ausgezeichnet mit dem PRIX FEMINA ETRANGER 2021 Fünf Jahre war der Autor Ahmet Altan - das Gesicht der türkischen Oppo ...
Ausgezeichnet mit dem PRIX FEMINA ETRANGER 2021 Fünf Jahre war der Autor Ahmet Altan - das Gesicht der türkischen Oppo ... -
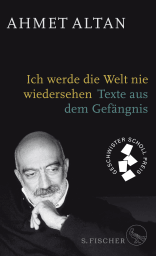
Ich werde die Welt nie wiedersehen
»Ich werde die Welt nie wieder sehen. Ich werde nie wieder den Himmel ohne den Rahmen sehen, den die Wände des Gefängni ... -

Wie ein Schwertstreich
»Wo auch immer ihr mich einsperrt, werde ich die Welt auf den Flügeln meiner Gedanken bereisen.« Ahmet Altan
Ah ...