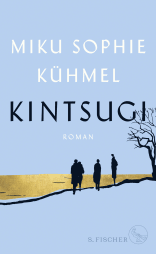
PRIDE BOOKS
Unsere Autorin Miku Sophie Kühmel über Edmund White, den Pride Month und Literaturempfehlungen aus der Community.
Es ist Juni in Berlin, ein lauer Sommerabend, Biergartenwetter. Aber ich bin in keinem Biergarten und nicht an der Spree und nicht in meinem kühlen Büro. Ich bin hier: in der Akademie der Künste. In einer Ecke. Auf dem Boden. Zwischen vielen, vielen Beinpaaren. Denn der Raum ist übervoll, das Publikum drängt sich bis hinaus auf den Flur. Lässt man den Blick durch die Reihen schweifen, aus leichter Untersicht, erkennt man vor allem: viele verschiedene Paare Füße, in Flipflops und Sandalen, in schicken Lackschuhen und klassischem Leder, ohne Socken, mit Socken, die Beine behaart und unbehaart, in Anzughosen oder Leggings oder Shorts und wann immer Wade oder Fußgelenk zu sehen ist, erkennt man auch: Da sind alle Hautfarben vertreten und mindestens drei Generationen. Es ist ein Abend des Poesiefestivals und auf der Bühne sitzen drei Poet*innen. Einer von ihnen ist Edmund White. Die Romane des heute 79-jährigen sind weltweit bekannt, er gilt als eine der wichtigsten literarischen Stimmen der queeren Szene und sagt soeben: »Ich hatte schon vorher schwule Bücher geschrieben, aber publizieren konnte ich die erst nach Stonewall.«
»Stonewall«, in der Szene ein geflügeltes Wort, jährt sich 2019 zum fünfzigsten Mal. Dahinter verbirgt sich der symbolträchtige Aufstand gegen die Polizeigewalt während einer der vielen Razzien in den Bars der Christopher Street im Manhattan der späten 1960er Jahre. Edmund White war 29. Er ging gerade mit einem Freund vorüber, als er die Aufstände bemerkte. Die Polizei hatte sich im Club verbarrikadiert. White blieb. Protestierte mit.
Aus heutiger Sicht betrachtet, gab es zur gleichen Zeit und auch schon zuvor eine Vielzahl solcher Ereignisse: in denen die Community der Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transpersonen und vielen weiteren, die sich unter dem breit aufgespannten Schirm des Begriffes »queer« wiederfinden, weil sie gesellschaftliche Normen um Geschlechtsidentität und/oder Sexualität nicht erfüllen, sich zur Wehr gesetzt und vor allem sich selbst sichtbar gemacht hatten.
Und jedes Jahr, im Pride Month Juni, wird diese Bewegung nun gefeiert. Mit Paraden und Partys, Ausstellungen, Diskussionen und Lesungen, wie auch heute in der Akademie der Künste. Die Veranstaltungen gelten zum einen dem Gedenken, zum anderen der politischen Arbeit. Neben Edmund White auf dem Podium sitzt auch die Poetin und Aktivistin Eileen Myles und sagt, gerade in unseren heutigen Zeiten sei es wichtig, sich auch im Sinne der Akzeptanz der LGBTQIA+ Community zu engagieren: »[...] wir haben politische Zustände als selbstverständlich angenommen, die sich durch den Rechtsruck gerade wieder verändern.«
Bis 1994 galt es in der BRD noch als Straftatbestand, wenn ein Mann Sex mit einem Mann hatte. Die Entkriminalisierung auf juristischer Ebene ist allerdings noch lange nicht gleich bedeutend mit einer gesellschaftlichen Akzeptanz zu lesen. Homophobie ist – auch abgesehen von der durchaus zu hinterfragenden politisch-ethischen Stabilität unseres Zusammenlebens – nach wie vor ein großes gesellschaftliches Problem. Auch hier. Dabei geht es nicht nur um strukturelle Problematiken, die auch post »Ehe für Alle« noch vorhanden sind, gerade etwa im Bereich der Transfeindlichkeit. Es geht um zahllose Übergriffe und flächendeckende Diskriminierung, sodass Deutschland was die Sicherheit für LGBTQIA+ betrifft, nicht einmal im grünen Bereich liegt.
»[...] es ist bequem, über Geschlecht als Kategorie herzuziehen und anderen vorzuwerfen, sie machten daraus eine Ideologie, wenn das eigene Geschlecht nicht in Zweifel gezogen oder benachteiligt wird, es ist einfach, Sexualität für etwas Intimes und Privates zu halten und irritiert zu reagieren, dass andere darüber sprechen, wenn der eigenen Sexualität zugestanden wird, etwas ganz Normales und Persönliches zu sein.«
(Carolin Emcke)
Der Pride Month Juni ist ein Monat, in dem dieser maßgebliche Teil unserer Gesellschaft laut und deutlich und bunt auf sich aufmerksam machen kann. Die Diskriminierung findet auch in den restlichen elf Monaten statt. Das sagt auch Marlon Brand vom Blog books are gay as fuck. Marlon ist Literaturwissenschaftler und beforscht die Bildung eines queeren Kanons. Auf seinem Blog spricht er über genre- und zeitübergreifende schwule Lektüren. Denn für die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Identität hat das Lesen als Praxis eine maßgebliche Rolle gespielt:
»Das war für mich am Anfang so eine Art Selbsttherapie, ich hab das als befreiend empfunden, mich endlich wieder zu finden, bei einer Lektüre zu denken: 'Das kenn ich doch, das hab ich durchlebt.' [...] Aber es geht mir dabei nicht ausschließlich um schwule Bücher. Literatur ist für mich ein Fenster zur Welt – das mir bewusst macht, dass meine Identität aus verschiedenen Splittern besteht, und dass das bei allen anderen auch so ist.«
Ein Text hat kein Gesicht. Gut, Roland Barthes würde sicher widersprechen, aber: ein Text kann, offener als viele andere Kommunikationssituationen, ein Forum für ungehörte Stimmen sein. Die Literatur als Organ einer diversen Gesellschaft: davon spricht Marlon Brand. Und diese Botschaft findet sich auch auf dem Poesiefestival wieder - denn neben Myles und White, beide im weitesten Sinne Teil der Generation Stonewall und außerdem beide weiß, sitzt auch der Lyriker Jericho Brown, dessen erste Antwort auf die Frage nach der Chance von Kunst für die queere Community lautet:
»Man kann sich in queere Kunst verlieben, in schwule Literatur zum Beispiel, ohne die Personen dahinter überhaupt zu kennen – und hat schon einen ganz anderen Bezug zur Thematik und auch der Community.«
Für manchen, mich eingeschlossen, bedarf es erst der Blase. Denn anders zu sein, ohne andere andere [sic!] zu sehen, erfordert Mut und kann, nach wie vor, vielerorts gefährlich sein. Zu meiner eigenen Queerness konnte ich erst stehen, als ich war, wo es egal war, wo es ganzheitlich akzeptiert war. Kaum vorstellbar sind für mich etwa Bedrohungen, von denen im Verlauf desselben Abends an der Akademie der polnisch-ukrainische Lyriker Eugeniusz Tkaczyszyn-Dycki in seinen Erinnerungen erzählt. Dass er, bedroht von den Polizeirazzien Polens, während anderswo bereits Pride Paraden Realität waren, gezwungen war, sich zu tarnen, zu verstecken, »bei jedem Schritt die Identität [zu] ändern.«
Literatur ist dabei nicht nur eine Möglichkeit, Lebensformen und -wirklichkeiten zu verkommunizieren; das Erzählen ist der queeren Szene, genau wie vielen anderen gesellschaftlichen Strömungen, als kulturelle Praxis immanent:
»Das Erzählen war immer zentral in der schwulen Szene. Man schlief miteinander und danach erzählte man sich seine Geschichten: Wie war dein Coming-out? Aus was für einer Familie kommst du? Aus was für einer Gegend? Man erzählte das immer wieder und war stets mit diesem eigenen Narrativ beschäftigt.«
(Edmund White)
Wenige Stunden später steht die brasilianische Lyrikerin Angelicá Freitas auf der Bühne, in deren Heimat sich gerade die politischen Bollwerke neu und zwar massiv invasiv gegen LGBTQIA+ ausgerichtet haben. Lee Mokobe folgt darauf und hinterfragt als Transperson aus Südafrika selbst die dieser Tage an so vielen Stellen wehende Regenbogenflagge als Symbol, denn:
»Rainbows fade. But I exist.«
Queere Geschichten zu erzählen – und sie zu lesen, sich mit ihnen auseinander zu setzen, ist nicht nur eine wichtige Aufgabe, sondern auch eine helle Freude. Deswegen habe ich einige Kolleg*innen um Buchempfehlungen gebeten:
Linus Giese empfiehlt Jayrôme Robinet: Mein Weg von einer weißen Frau zu einem jungen Mann mit Migrationshintergrund: »Es gibt viel zu wenig Bücher zum Thema trans, dieses hier sollten alle lesen: Jayrôme Robinet erzählt ehrlich, berührend, klug und sehr unterhaltsam von seinem Lebensweg!«
Frank Heibert empfiehlt Patrick Gale: Willkommen im Paradies: »Queere Figuren in der Literatur sind oft Opfer, queer zu sein ist oft der Hauptkonflikt des Romans, das Drama, das schwere Schicksal. Es gibt viele grandiose Bücher, die so funktionieren. Wir wünschen uns mehr Romane, in denen queere Figuren selbstverständlich auftreten, mit ihren Lebensproblemen oder -freuden, wie die anderen auch. Und es gibt einen britischen Autor, der selbst queer ist und seit jeher so schreibt, lange bevor die heutigen Debatten um Queerness losgingen: Patrick Gale. Auf Deutsch gibt es von ihm einen Roman, Willkommen im Paradies, zuletzt lieferbar als Fischer-Taschenbuch, heute nur antiquarisch. Ich kenne ihn, weil ich ihn selbst übersetzt und ursprünglich verlegt habe. Auch die anderen, immer gut geschriebenen, spannenden, unterhaltsamen und zugleich in die Tiefe gehenden Werke von Gale beinhalten verschiedenste queere Situationen und Figuren, und ich habe vor, für ihn in Deutschland einen neuen Verlag zu finden.«
Sarah Berger empfiehlt Anne Garréta: Sphinx.
