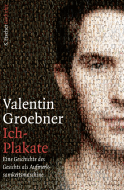
Fünf Fragen an Valentin Groebner
»Was mich an der Vergangenheit interessiert, [ist] ihr Nicht-mehr-da-Sein«, sagt Valentin Groebner über seine Faszination für die Geschichte. Zum diesjährigen Historikertag stellen wir fünf renommierten HistorikerInnen Fragen zur Geschichte und ihrer Wirkung.
1. Was kann Geschichte als Wissenschaft leisten, welche Funktion hat die Geschichte (einerseits als Wissenschaft, andererseits als Bezug auf das Vergangene) heute?
Dass sie Neues erzeugt – Frisches von früher. Das klingt paradox, aber ich meine das ganz wörtlich. Geschichte ist deswegen eine Wissenschaft, weil sie sich ändert, und weil sie ältere Erzählungen überprüft und korrigiert. Wir haben deswegen heute ein ganz anderes Bild vom Mittelalter oder von der Spätantike als unsere Eltern und Großeltern, und das ist auch gut so. Was sich dagegen nur vergleichsweise langsam ändert, sind die populären Geschichtsbilder. Die sind immer noch voll von Rittern, Hexen, Burgfräulein und den Geschichten von dekadenten Römern und der Völkerwanderung. In ihnen sind all die romantischen Motive des 18. und 19. Jahrhunderts für immer eingefroren, das ist der Geschichtstiefkühler. Wissenschaft ist dagegen die Frischware – inklusive Ablaufdatum.
2. Was fasziniert Sie an der Arbeit des Historikers, warum sind Sie Historiker geworden? Was wollen Sie als Historiker mit der Geschichte erreichen oder beitragen?
Das ist eine ziemlich persönliche Frage, hm. Historiker bin ich wahrscheinlich geworden, weil ich als Teenager bei Streitgesprächen über die Vergangenheit am Abendessentisch meinem Vater, Jahrgang 1923 und ehemaliger Wehrmachtsoffizier, ordentlich widersprechen wollte. Ich wollte nachlesen und es ganz genau wissen, und bei den Streitgesprächen ging es natürlich vor allem um die Geschichte des 20. Jahrhunderts. Dazu kamen dann ganz andere Impulse: Als Neunzehnjähriger bin ich in den Ferien in Südfrankreich zufällig in einem Zisterzienserkloster aus dem 12. Jahrhundert gelandet und war beeindruckt von der kühlen Strenge dieser Architektur. Ein paar Jahre später, bei den Protesten gegen die Frankfurter Startbahn West am Beginn der 1980er Jahre, kamen mir die Rituale der militanten Startbahngegner wie wilde mittelalterliche Karnevalsaufzüge vor. Offenbar war die Historie nicht einfach weg, sondern eine Art Materialreservoir. Versatzstücke daraus ließen sich in verschiedenen Formen immer wieder neu aufführen; in merkwürdigen Verwandlungen, aber meistens als Vehikel im Konflikt, wie beim Streit am Abendessentisch. Darüber wollte ich mehr herausfinden, und dieses überbordende theatralische Potential der Geschichte hat mich seither nicht mehr losgelassen – die Versuche, mit Zeug aus der Vergangenheit die eigene Gegenwart zu verändern.
3. Wieso mischen sich so wenige HistorikerInnen in das Zeitgeschehen und in aktuelle Debatten ein? Kann die Vergangenheit uns überhaupt etwas über die Gegenwart lehren oder zur Analyse aktueller Probleme beitragen?
Ich teile diese Einschätzung nicht, glaube ich. Im Gegenteil. Sind die Fachleute für die Vergangenheit wirklich wortkarg? Die Anzahl der Museen und Gedenkstätten hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt, von Fernsehserien und Filmen zu historischen Themen und touristischen Inszenierungen ganz zu schweigen. Geschichte wird ununterbrochen als Bedeutungsposaune und moralische Instanz aufgerufen. Dieses Reden von »unserer« oder »der eigenen« Geschichte geht davon aus, dass man früher eigentlich auch schon dabei gewesen wäre, vor 80, 200 oder 700 Jahren: ein Rückreisetraum, mit der Beschwörung der vermeintlichen eigenen Vergangenheit als Zufluchtsort, Panikraum oder moralisches Fitnesscenter.
Dabei geht es in der Regel um Autorität: Die Deutschen (und die Schweizer auch) mögen Leute, die wie Pfarrer oder Pfarrersfrauen aussehen und auch so sprechen. Es gibt viele Historiker, die auch gerne in dieser Rolle auftreten, als Mahner, Prediger und Oberlehrer. Das ist eine gut eingespielte Pose, die aus dem 19. Jahrhundert stammt, und sie prägt bis heute den Gebrauch von Geschichte im bildungsaffinen öffentlichen Raum, in Museen, in Festansprachen und im Feuilleton.
Mir kommt das ein wenig vor wie Huhu-Machen in ein großes hallendes Bedeutungsgewölbe hinein: Ein Heraufbeschwören von Bedeutungen und Verbindungen zu Früher, plus dazugehörigem Pflichtenheft. Ich fühle mich da unwohl. Wenn Historiker wie Pfarrer reden, dann reden sie – wie Pfarrer – die Hälfte der Zeit von ihrer eigenen Unentbehrlichkeit.
Was mich an der Vergangenheit interessiert, ist das genaue Gegenteil des üblichen Beschwörens von Erinnerung, Bedeutung und Dauer, fürchte ich: nämlich ihr Nicht-mehr-da-Sein. Anders gesagt: Mich interessiert, wie Dinge kaputtgehen. Die Erforschung der kollektiven Empfindungen und des Alltags von früher liefert immer wieder aufs Neue eine ziemlich deutliche Lektion: Diejenigen Empfindungen und Überzeugungen, die Menschen mit anderen geteilt und als ihre tiefsten, ursprünglichsten und wahrsten angesehen haben, die ändern sich am gründlichsten und schnellsten. Unbefleckte Empfängnis, Liebe zum allerhöchsten Kaiserhaus, Volksgemeinschaft, wissenschaftlicher Sozialismus, ökologische Selbstverwaltung, freies Spiel der Marktkräfte: Daran haben jeweils sehr viele Leute inbrünstig geglaubt. 30 oder 150 Jahre später ist das bizarr und unergründlich und nur noch schwer nachvollziehbar, wie jemand das überhaupt ernstnehmen konnte.
Geschichte, um es ein bisschen zuzuspitzen, macht ihre Protagonisten im Nachhinein sanft lächerlich, und deswegen vermag sie einem diesen klammheimlichen Schrecken einzujagen: Das war einmal alles ganz wichtig und eindrucksvoll – Kirchenlieder, Uniformen, Müslirezepte und die fusseligen Frisuren aus den Fernsehserien der 1980er Jahre.
4. Welche Rolle spielt für Sie Narrativität in der Geschichtswissenschaft?
Gerade weil die Rekonstruktion der Vergangenheit so unendlich viele Details aus den Archiven hervorbringt, kann sie gar nicht anders als erzählen: Nur so kann sie sich auf einige wenige Akteure, Orte und Faktoren konzentrieren und Argumente formulieren. Wir schreiben heute in einer ganz anderen Wissenslandschaft als unsere Kolleginnen und Kollegen vor 50 oder 100 Jahren. In den digitalen Kanälen gibt es unendlich viele Detailinformationen, die man sich mit ein paar Klicks sofort aus den Suchmaschinen und Datenbanken holen kann. Die Digitalisierung ist mit dieser unbegrenzten Fülle eine Erlaubnis: dafür, eine Geschichte – ein Ereignis, ein Argument, einen Beweis – so prägnant und knapp wie möglich zu erzählen. Sonst, ernsthaft, war die ganze Vernetzungshysterie für nichts gut.
Dasselbe gilt für den Umgang mit Theorie, dem großen Thema der Geschichtswissenschaft der letzten 50 Jahre. Akademische Theorie definiert sich immer als das Gegenteil von Normalwissenschaft. Mit ihrem institutionellen Siegeszug verwandelt sie sich aber selbst in Mainstream. Deswegen vervielfältigt sie sich so leicht zu ödem Jargon, hat aber keine Begriffe, das selbst zu beschreiben. Theorie hilft auch nicht gegen institutionelle Hierarchie, obwohl sie das seit den 1960er Jahren so beharrlich versprochen hat. Ja mei; es sind uns aber seither ja auch noch ein paar andere Gewissheiten abhandengekommen.
Erzählen ist ja nicht nur Vergnügen, sondern immer auch Ernstfall, Selbsttest. Man geht damit aufs Eis. Funktioniert meine Auswahl? Habe ich einen wesentlichen Faktor übersehen? Ist meine Schlussfolgerung falsch? Ich bin als erzählender Historiker deswegen Wissenschaftler, weil ich mich irren kann. Deswegen unterrichte ich auch gerne: Weil es einen zum Erzählen zwingt. Das führt häufig nicht zu den Ergebnissen, die man geplant hat, aber dafür zu anderen, unerwarteten.
5. Was wünschen Sie sich von einem historischen Sachbuch? Welches historische Sachbuch hat Sie zuletzt besonders beeindruckt und warum?
Ein gutes wissenschaftliches Buch erzeugt Konkretes: Es macht etwas, das vorher zwar auch irgendwie da war, aber vage und wolkig und nicht darstellbar, zu einem Gegenstand, den man beschreiben und analysieren kann. Und das Feld, von dem man dachte, es irgendwie zu kennen, stellt sich plötzlich als aufregend fremd und neu heraus. So ist das, wenn Diedrich Diederichsen ›Über Pop-Musik‹ schreibt und einem beim Lesen die Querverbindungen zwischen Medien, bewegten Bildern, Werbung und den endlosen Revival-Schlaufen seit den 1970er Jahren aufgehen. Wenn Monika Dommann in ›Autoren und Apparate‹ über die in den 1930er Jahren entstandenen Phantasien der zentralisierten Speicherung und Verfügbarmachung aller je existierenden Informationen schreibt – auf Mikrofilm, und dazu die erstaunliche Geschichte des Fotokopierers erzählt. Oder wenn Philipp Felsch in seinem ›Langen Sommer der Theorie‹ die linksradikale Verlagslandschaft der 1970er und frühen 1980er Jahre in Berlin schildert, inklusive der Posen, Kalküle, erbitterten Konkurrenzkämpfe und der Lust an möglichst unverständlicher Sprache. Ein gutes historisches Sachbuch zieht sozusagen das Tischtuch des vermeintlich Vertrauten weg, würde ich deshalb sagen, es zeigt bislang unbekannte Zusammenhänge, aber auch neue Lücken und Rätsel. Dadurch, dass wir etwas auf einmal sehr viel genauer und konkreter wissen, erzeugt es produktive Unordnung. Das wäre auch ein passendes Motto für eine neugierige Geschichtswissenschaft.
