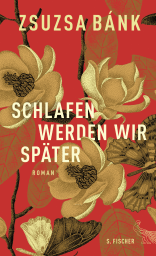
Interview mit Zsuzsa Bánk zu ›Schlafen werden wir später‹
Zsuzsa Bánk im Gespräch mit ihrem Lektor Jürgen Hosemann zu dem Roman ›Schlafen werden wir später‹.

Jürgen Hosemann: »Schlafen werden wir später« besteht ausschließlich aus E-Mails, die sich die beiden Hauptfiguren Johanna und Márta schreiben. Was macht denn für Sie als Autorin den besonderen Reiz dieser Form aus?
Zsuzsa Bánk: So konnte ich private und intime Stimmen entwickeln wie sonst nie. Ich habe zwar auch davor in der Ich-Perspektive geschrieben, aber nun hatte ich gleich zwei Ich-Perspektiven. Schon lange wollte ich solch einen Roman schreiben. Einen Roman, der zwei so intime Einblicke erlaubt. Das große Leben erzählt aus zwei kleinen Blickwinkeln – das geht nur im Tagebuch oder Brief. Alltag wollte ich beschreiben. Und viel Alltag wird beschrieben. Zwischen Aufstehen und Schlafen hören wir, lesen wir Beichte, Zweifel, Freude, Angst in vielen Nuancen und Härtegraden – das ließ sich in dieser Form fast mühelos, hürdelos fassen. In anderen Erzählformen sind Innenansichten logischerweise eingeschränkt, nur begrenzt möglich.
Für mich war es also ein Aufbruch, eine Befreiung hin zu einem gewagteren Schreiben, bei dem alles erlaubt war. Ich musste es Johanna und Márta nur sagen lassen. Sie dürfen fluchen, sie dürfen Lautmalerei benutzen, Peng! und Zisch!, auch Wörter wie »bekloppt« und »Kotze« und »Pisse«, das war in meinen anderen Romanen undenkbar. Das geht nur mit wörtlicher Rede, hier gegossen in Briefform. Es hat mir Freude gemacht einmal so zu schreiben, einmal das Korsett der Sprache ablegen zu dürfen, mich in der Sprache auszutoben, Wörter zu erfinden, Wort-Aneinanderreihungen, Mischungen und Wiederholungen, Verszeilen aus Mártas Gedichten, Lyrik-Einsprengsel. Einen Code zu entwickeln, der die Freundinnen wie ein Gesang, ein gemeinsamer Kanon verbindet, auf unauflösliche Weise.
Radikal subjektive Literatur fand ich immer schon umwerfend, Intimitäten, Seeleneinblicke, das große Ausziehen und Nacktdastehen. Tagebücher, Briefe, Romane als Lebensbericht, die werden ja auch zuhauf von Johanna und Márta zitiert, die Zitate spielen sie einander zu wie Tennisbälle, in ihnen spiegelt sich ihr Gefühlszustand, ihr Seelenstatus. Immer wieder bin ich auf solche Bücher gestoßen, Märta Tikkanens »Die Liebesgeschichte des Jahrhunderts« hat mich nahezu überwältigt, später dann die milderen Fomen, Tagebücher und Briefe von Sylvia Plath, Brigitte Reimann, Maxie Wander, also jede Art hingebungsvoller, intensiver Alltags- und Lebensbetrachtung, die praktisch vor nichts halt macht und nichts unausgesprochen lässt, die alles beleuchtet und alles beleuchten will. Zuletzt Connie Palmens quälend persönlicher Roman »I.M.« und Barbara Honigmanns Briefroman »Alles, alles Liebe!« Ich dachte immer, genau das will ich auch machen. Ich will auch einmal so schreiben: Kopf, Herz, Alltag, Vergangenheit, Liebe und Familie, das Innen und Außen, das Schreckliche und das Leuchtende – alles miteinander verbinden. Diesen Wunsch habe ich mir jetzt erfüllt.
Jürgen Hosemann: Wenn man die E-Mails Ihrer Hauptfiguren liest, staunt man über das sprachliche Niveau, auf dem da über Alltag gesprochen wird. Dinge des täglichen Lebens verwandeln sich plötzlich in sprachliche Ereignisse. Auch die Gefühlswelt der beiden Frauen erscheint reich und vielschichtig. Die Mails, die man selbst an seine Freunde schreibt, kommen einem dabei ganz kümmerlich vor. Schreiben Sie auch privat solche Mails wie die beiden Frauen im Buch?
Zsuzsa Bánk: Ja, ich schreibe auch solche E-Mails, lange lebensseziererische Briefe. Ausführlich, seelengräberisch, seelenumgräberisch, fragend, fragend, fragend, dreimal hintereinander fragend. Freunde sagen, ich rede sogar so. Nur weil das Abschicken so mühelos ist, muss man in Mails nicht zwangsläufig knapper oder oberflächlicher schreiben. Aber ich schreibe nicht so häufig. Ich habe keine Zeit, jeden zweiten Tag einen Brief von solcher Länge und stilistischer Ausgeklügeltheit zu schreiben. Wie Johanna und Márta das gelingt, ist mir ein Rätsel. Aber es gelingt ihnen.
Jürgen Hosemann: »Schlafen werden wir später« ist ein Buch über Freundschaft. Was ist denn das Entscheidende an einer langen tiefen Freundschaft?
Zsuzsa Bánk: Sie stellt keine Bedingungen. Das Fundament lautet: Du bist meine Freundin, DESHALB kannst du dir alles erlauben, und ich liebe dich trotzdem. Und nicht etwa umgekehrt: Du handelst oder bist so oder so, NUR DESHALB bist du meine Freundin. Funktionsgebundene, an eine Kondition gekoppelte Freundschaft ist wertlos. Liebesgebundene, zuneigungsgebundene Freundschaft hingegen echte Freundschaft.
Jürgen Hosemann: Unterscheidet sich so eine Frauenfreundschaft, wie sie im Buch beschrieben wird, von einer typischen Männerfreundschaft?
Zsuzsa Bánk: Das denke ich nicht. Ich mag keine Geschlechterzuordnungen. Es gibt Frauen, die kein Gefühl zeigen können. Und Männer, die sehr wohl eines haben und es auch artikulieren. Frauen sind womöglich eher in der Lage, einander zu sagen, ich liebe dich, ich hab dich lieb, du bist wunderbar, ich bin so glücklich, dass ich dich habe. Männer denken das vielleicht, sagen es aber nicht. Männer verletzen sich anders, Männer lieben sich anders. Aber sicher nicht weniger stark.
Jürgen Hosemann: Könnten Sie sich vorstellen, mit Ihren Hauptfiguren auch im wahren Leben befreundet zu sein? Und wäre Ihnen eine der beiden Frauen näher?
Zsuzsa Bánk: Unbedingt. Ich schreibe nur über Leute, die ich mag. Anders würde ich die lange Arbeit, das lange Zusammensein mit meinen Figuren nicht aushalten. Ich könnte mich sofort zu ihnen an den Tisch setzen und Schnaps trinken. In ihre Gesänge einstimmen. Ihre Lebensberichte anhören. Meine eigenen hinzufügen. Ich wohne ja in Mártas Nähe. Ich könnte zur Körberstraße spazieren und mich in ihren Hof oder auf ihr Dach setzen. Wie gerne hätte ich das einmal getan in den vergangenen Jahren. Ohne viel zu sagen mit Márta den Stadthimmel anschauen, wie sie das oft macht, wenn die Nacht in den Tag übergeht – oder umgekehrt.
Johanna habe ich mich schnell näher gefühlt, Johanna habe ich schnell geliebt. Johanna ist eher ein Typ, den ich mag. Ernst, selbstkritisch, zurückgenommen, trägt immer so ein blödes Päckchen aus der Vergangenheit mit sich herum. Nicht immer nett zu sich selbst, aber mit großer Fähigkeit zum kleinen Glück und zum Alleinsein. Mit ihr habe ich gelitten, ihr Glück war mein Glück. Jahrelang ist sie mit dem Zorn auf ihren Ex-Mann beschäftigt, dann geht dieser Zorn vorbei, und es gelingt ihr, noch einmal Mut zu fassen. Wenn das geschieht, bin ich genauso glücklich wie sie. Vielleicht noch glücklicher als sie. Ich denke: Gott, Johanna! Dass dir das gelingt!
Mit Márta bin ich erst später warm geworden. Gegen Ende habe ich erst wirklich gespürt, wie sie sich über die Jahre zusammengenommen hat, erst gegen Ende offenbart sie in einem winzigen Nebensatz ihre Angst um Johanna. Das hat mich dann doch umgeworfen. Wie lange sie gebraucht hat, das auszusprechen und zuzugeben. In dieser Offenbarung sehe ich die ganze große Márta.
Jürgen Hosemann: Ihr Roman verhandelt echte Lebensfragen: alleine leben oder mit einem Partner, Kinder oder keine, Großstadt oder Landleben, frei arbeiten oder fest angestellt. Gibt es etwas, was man von Márta und Johanna fürs eigene Leben lernen kann?
Zsuzsa Bánk: Bei Johanna und Márta kann man eines deutlich sehen: Das Leben geht weiter, es entwirft sich selbst neu, auch ohne unser Zutun. Es kümmert sich nicht um uns, aber wenn wir fallen, stehen wir wieder auf, wenn wir verletzt sind, klingt der Schmerz irgendwann ab. Wir wachen am nächsten Tag auf, obwohl wir gedacht haben, das geschieht nicht mehr, wir haben keine Kraft mehr dafür, nicht einmal mehr fürs Aufwachen. Es gibt bei beiden Frauen eine gewisse Gleichmäßigkeit von Auf und Ab, eine gewisse Symmetrie von Hell und Dunkel, von Trauer und Leichtigkeit, Schönheit und Scheußlichkeit, Tendenz immer zum Besseren. Beide wissen, fürs Leben kann man nichts lernen. Man kann sich nicht aufs Leben vorbereiten. Sowieso kommt alles anders. Hat man Glück, hat man talentierte Eltern, die einen mit einem unverzagten, lebensbejahenden Grundgefühl ausgestattet haben, dann geht man relativ gut durchs Leben. Márta hat sie, Johanna nicht.
Jürgen Hosemann: Johanna wird umgetrieben von den Gespenstern ihrer Vergangenheit, Márta von der Gegenwart in Form ihrer drei kleinen Kinder. Zum Schlafen kommen sie beide nicht, das Leben selbst hält sie wach. Sie haben selbst Familie und den Beruf einer Autorin mit allen Unwägbarkeiten. Wann schlafen denn Sie?
Zsuzsa Bánk: Später.
-
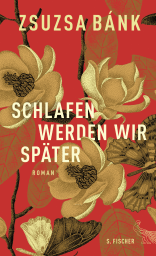 »Wir sehen in die Köpfe, wir sehen in die Herzen. […] Man will teilhaben, mitleiden, mitlachen, […] so poetisch und leb ...
»Wir sehen in die Köpfe, wir sehen in die Herzen. […] Man will teilhaben, mitleiden, mitlachen, […] so poetisch und leb ...
