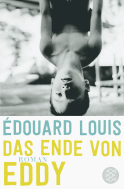
»Seine Tränen sind politisch«
Ein Interview mit Édouard Louis über seinen autobiographischen Roman ›Das Ende von Eddy‹, dessen Hauptfigur und einen magischen Film von Pedro Almodóvar.
Édouard Louis, Ihr Buch hat ganz unterschiedliche Leser berührt. Warum, glauben Sie, können sich so viele damit identifizieren?
Ich habe die Geschichte von Eddy erzählt, ein Porträt des Dorfes gezeichnet, in dem er aufwächst, der Menschen, die ihn umgeben, um die Erfahrung des Dominiertwerdens greifbar zu machen.
Des Dominiertwerdens?
Ja, Gewalt und Erniedrigung sind Teil unseres Lebens, ein mehr oder weniger unsichtbares Fundament unserer Existenz. Wer hat das nicht schon erlebt? Der Begriff des Universellen gefällt mir nicht besonders, aber dominiert zu werden, scheint mir etwas Universelles zu sein. Das kann einem begegnen, wenn man eine Frau ist, homosexuell, jüdisch, ein Einwanderer, ein Schwarzer, wenn man aus einfachsten Verhältnissen stammt oder vom Land in die Stadt zieht. Fast jeder wird im Laufe seines Lebens einmal geprägt von der Erfahrung, als minderwertig zu gelten. Ich habe mit meinem Roman versucht, der Erfahrung von Gewalt einen Platz in der Literatur zu geben – so wie Marguerite Duras es mit der Erfahrung des Wahnsinns gemacht hat.
Sie zeichnen in Ihrem Buch das Leben einfacher Leute auf dem französischen Land. Zugleich geht es um Eddy, einen Jungen, der homosexuell ist und dagegen ankämpft, ausgeschlossen zu sein. Wie wurden diese beiden Themen in der Rezeption des Buchs wahrgenommen?
In allen Ländern, in denen der Roman bisher erschienen ist, wurden beide Themen, Klasse und Homosexualität, immer zusammen gesehen. Genau darum ging es mir ja auch, zu zeigen, wie sich beides bedingt. Schwul zu sein im Iran, in Russland, im Marais in Paris, in Berlin oder in einem kleinen Dorf in Nordfrankreich ist eben nicht dasselbe. Eddy spürt, dass er sich für Jungs interessiert. Aber sein Begehren wird in dem Arbeiterdorf in Nordfrankreich, in dem er aufwächst, zurückgewiesen, weil dort Werte der Männlichkeit regieren, und Schwulsein wird mit Weiblichkeit assoziiert. Deswegen schämt sich Eddys Familie ja auch von Anfang an für Eddy, weil er diesen Werten nicht entspricht. In meinem Umfeld in Paris habe ich heute viele Freunde, die im linksliberalen Intellektuellenmilieu groß geworden sind. Sie sagen, dass sie sich nie schwul »gefühlt« haben, weil es bei ihnen zu Hause nie eine Rolle gespielt hat und immer akzeptiert war.
Eddy geht es anders.
Er wird ständig daran erinnert, wird gehänselt und schikaniert. Die anderen Kinder wollen nicht mit ihm spielen. Es gibt das Thema der Sexualität also nie unabhängig vom Thema des Milieus, der Klasse, das ist ein- und dasselbe. Begehren bezieht sich immer auf eine bestimmte Welt. Ich wollte aber nicht nur von mir selbst erzählen, sondern Strukturen und Mechanismen aufzeigen, die Eddys Leben und das seiner Umgebung bestimmen. Ich wollte zeigen, dass da etwas Größeres am Werk ist. Wenn Eddy heult, weil man ihn in der Schule verprügelt und als »Schwuchtel« bezeichnet, glaubt er, dass er persönlich daran Schuld trägt. Er versteht nicht, dass seine Tränen politisch sind. Er wird so behandelt, weil es homophobe Diskurse im Dorf gibt, weil es eine Geschichte der Homophobie gibt, die ihm vorausgeht.
Die Welt, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, kommt in der Gegenwartsliteratur selten vor. Warum, glauben Sie, ist das so?
Ich möchte von Leben erzählen, von denen man nicht spricht. Von denen, die Karl Marx einst als das »Lumpenproletariat« bezeichnet hat. Sie sind unsichtbar, weil wir sie unsichtbar gemacht haben. Wir sprechen nicht über sie. Die meisten Autoren leben in einer anderen Welt, einer Welt, in der auch unsere Politiker leben, unsere Dozenten an den Universitäten. Ich höre immer wieder, dass Leute sagen, soziale Klassen, das gibt es doch nicht mehr, Marx ist überholt. Ich halte das für falsch. Was ich in meiner Kindheit erlebt habe, zeigt, dass es nicht so ist. In allen Ländern, in die mich mein Buch auf Lesereise führt, sehe ich, dass es auch dort nicht so ist. ›Das Ende von Eddy‹ ist für mich ein Weg, Unsichtbares sichtbar zu machen.
Eddy, das waren Sie, bevor Sie sich in Édouard umbenannt haben. Im Buch erzählen Sie von Dingen, die Sie selbst erlebt haben. Wie sind Sie vorgegangen, um das Erlebte in einen Roman zu verwandeln?
Das Schreiben des Romans ist für mich ein Synonym für die Suche nach einer literarischen Ausdrucksform, die es mir erlaubt, etwas hörbar zu machen, was es normalerweise nicht ist. Ganz am Anfang habe ich mich vor allem in Acht genommen vor etwas, das man gemeinhin als »Stil« bezeichnet. Wenn man sich einmal mit dem Schreiben beschäftigt, hört man überall nur noch das Wort »Stil«. Aber was soll das überhaupt sein? Es gibt ein sterotypes Bild davon: Entweder eine Art imaginierten Proust-Sound, mit langen, ausschweifenden Sätzen. Oder das Reproduzieren dessen, was man avantgardistisches Schreiben nennt – ein Schreiben losgelöst von allem, ohne Zeichensetzung, mit vielen Ticks. Aber was die Stärke von Literatur ausmacht, ist ja, dass sie neue und unsichtbare Realitäten sichtbar macht, einen Unterschied machen kann. Marguerite Duras hat einmal gesagt: «Wenn ich schreibe, kümmere ich mich nicht darum, wie ich schreibe. Was zählt, ist, dass ich etwas sage.« Man muss sich also erst mal von der Ideologie des »Stils« befreien und etwas dagegen halten, was einen Unterschied machen kann. Eine andere Art zu schreiben finden, das Unsichtbare zu sagen. Denken Sie an William Faulkner oder Thomas Bernhard, denen es gelungen ist, in ihrem Schreiben etwas hörbar zu machen, das man vorher nicht gehört hat.
In Ihrem Roman schneiden Sie zwei Sprachen gegeneinander, die des Dorfes und die des Erzählers.
Ich habe nach einem literarischen Verfahren gesucht, das es mir ermöglicht, beide Sprachen übereinanderzulegen: Die meiner Kindheit, der Arbeiterklasse, meiner Familie. Und eine zweite Sprache, die, die ich heute spreche, nachdem ich nicht mehr bei meiner Familie lebe. Ich trage beide Sprachen in mir, und aus dieser Art der Schizophrenie heraus schreibe ich. Ich habe mir vorgenommen, mit der Sprache der einfachen Leute als Material zu arbeiten, um aus etwas Nicht-Literarischem Literatur entstehen zu lassen. Und es war mir wichtig, dass man den Roman flüssig lesen kann. Daher die Idee, die Sprache der Dorfbewohner kursiv zu setzen und unmittelbar in den Rest des Textes zu integrieren, so dass es fließend ineinander übergeht. Es hat lange gedauert, bis ich den Ton gefunden hatte, bis ich an dem Punkt war, wo diese beiden Sprachwelten aufeinanderprallten. Ich habe fünfzehn oder sechzehn Fassungen des Romans geschrieben, bis ich soweit war.
Sie zeigen sehr genau, wie schwer es Eddy in seinem Dorf hat, wie er gegen die Mechanismen der Ausgrenzung kämpft. Zugleich schreiben Sie auch empathisch und ohne Vorwürfe über Ihre Familie, die Dorfbewohner. Wie hat Ihre Familie auf das Buch reagiert?
Ich habe versucht, den Figuren, die in meinem Buch auftauchen, gerecht zu werden, aber auch nichts zu beschönigen. Bei manchen Sachen ist es mir schwergefallen, das aufzuschreiben, weil ich zuerst dachte, das ist zu intim. Aber dann dachte ich, genau das musst du aufschreiben, die Grenze zwischen Privaten und Öffentlichen ist fließend. Als es die ersten feministischen und homosexuellen Bewegungen gab, hat man ihnen zum Vorwurf gemacht, dass sie Privates und Öffentliches vermischen, dass ihr Privates doch niemanden etwas angehe. Alles, was man nicht hören wollte, wurde als Privatangelegenheit ausgelegt. Mich hat es interessiert, diese Grenze zwischem Privatem und Öffentlichen neu auszuloten.
Was haben Ihre Eltern gesagt?
Natürlich habe ich mit meinem Roman auch Unverständnis ausgelöst. Meine Mutter war sehr verletzt, nachdem sie das Buch gelesen hat. Sie hat sich in der französischen Presse beschwert. Vielleicht ein bisschen so wie die Familie von Knausgård in Norwegen, nachdem sie seine Autobiographie gelesen hat. Meine Mutter hat sich in dem Porträt, das ich von ihr zeichne, nicht wiedererkennen können. Sie war verletzt, weil ich in dem Roman zeige, wie sie als Frau unterdrückt wird. Man schämt sich natürlich, das zuzugeben, weil man denkt, dass es auf eine persönliche Schwäche hindeuten könnte.
Und Ihr Vater?
Er hat anders reagiert. Er hat vierzig Exemplare des Buches gekauft und an all seine Freunde verschenkt. Und er hat mir geschrieben, dass er sehr stolz auf mich ist. Ich habe ihn noch nie ein Buch kaufen sehen, ich weiß nicht, ob er überhaupt je eins in seinem Leben gekauft hat. Er hat immer gesagt, Bücher taugen nichts.
Wie gelingt es Eddy, sich zu befreien?
Anfangs geht es Eddy gar nicht darum, sich zu befreien. Flucht wäre für ihn so etwas wie Scheitern. Er versucht erst einmal verzweifelt, genau so zu sein wie alle anderen. Er versucht, sich in Mädchen zu verlieben, macht sich wie die anderen im Dorf über Schwule lustig, geht Fußball spielen mit den Jungs. Als er merkt, dass es nicht funktioniert, entschliesst er sich wegzugehen. Er ist dazu verdammt. Erst gegen Ende des Buches begreift er, dass das seine Rettung ist. Es geht mir in dem Roman auch darum, eine Archäologie des Willens zu schreiben, zu fragen: Warum hat er es an einem bestimmten Moment geschafft? Wie kann man etwas wollen?
Sie tragen heute nicht mehr den Vornamen, den Ihnen Ihre Eltern gegeben haben, Sie haben sich umbenannt in Édouard. Haben Sie Eddy hinter sich gelassen?
Ich denke schon. Das soll nicht heißen, dass nichts mehr von Eddy in mir steckt. Etwas von ihm bleibt in mir wie in jedem, der flieht. Denken Sie an den Transvestiten Agrado aus dem Almodóvar-Film ›Alles über meine Mutter‹: In einer Szene steht er auf der Bühne und zählt all die Schönheits-OPs auf, die er an sich hat vornehmen lassen: Die Nase, die Brüste, die Wangen etc. Und am Ende sagt er, dass genau das ihn ausmacht. Dass diese künstlichen Eingriffe das Authentischste an ihm sind, weil er sich selbst dazu entschieden hat. Diese Szene berührt mich jedes Mal. Agrado ist vielleicht die poetischste, politischste und subversivste Figur der Selbstfindung.
Eine letzte Frage noch: Wenn Sie sich wünschen dürften, wo die deutsche Ausgabe Ihres Romans in einem Buchladen liegen sollte, wo wäre das?
Wenn ich es mir frei wünschen dürfte, dann am liebsten in der Nähe der Bücher der Autoren, ohne die ich nie den Mut und die Kraft gehabt hätte, zu schreiben, Autoren, die ich mit Bewunderung lese und immer wieder lese – und die ich auch gelesen habe, als ich meinen Roman geschrieben habe. Das sind: William Faulkner, Didier Eribon, Herta Müller, Thomas Bernhard, W. G. Sebald und Marguerite Duras. Ach, und Pierre Bourdieu natürlich.
Interview: Friederike Schilbach
