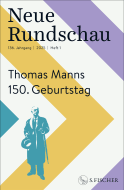
Thomas Manns 150. Geburtstag: Guillaume Perilhou »Der Tote in Venedig«
Ein Text von Guillaume Perilhou

Paris, den 1. November 2024
Lieber Roland,
gestern, in der Pariser Maison de la Poésie, wurde Thomas Mann gefeiert. Zumindest möchte ich es so verstanden wissen, denn Sophie Marceau hat dort Auszüge aus meinem zweiten Roman La Couronne du serpent gelesen, einem Briefroman, in dem es um Viscontis Verfilmung von Der Tod in Venedig geht. Marceau hat also aus den Briefen gelesen, fiktiven Briefen von Björn Andrésen, der im Film die Hauptfigur der Novelle spielt, den jungen polnischen Aristokraten Tadzio, dessen bloße Schönheit den alten Gustav von Aschenbach so überwältigt. Ich selbst wiederum las die Briefe Viscontis – grob zusammengefasst besteht mein Text aus dem Schriftwechsel zwischen Visconti und Andrésen sowie eingeschobenen Tagebuchfragmenten, auch diese frei erfunden –, und um dabei möglichst echt zu klingen, musste ich die Selbstsicherheit, ja den Hochmut des Regisseurs nachahmen, der den gerade einmal 15-jährigen Björn Andrésen an einem Wintertag des Jahres 1970 zum »schönsten Jungen der Welt« erklärte.
Wer hätte Andrésen besser verkörpern können als Sophie Marceau? Als 1980 La Boum in die Kinos kam, erfuhr auch sie sofortigen, totalen Ruhm. Zehn Jahre später zwar als er, aber doch auf die gleiche Art, und dabei sogar noch etwas jünger. Sie war gerade 14 geworden und schrieb abends vor dem Schlafengehen in irgendwelchen Hotelzimmern in London oder Tokio stapelweise Autogramme auf Briefe und Poster, nachdem sie tagsüber Werbespots gedreht, vor Kameras posiert oder Journalisten Interviews gegeben hatte. Es war Sophie Marceau, die mir manchmal in den Sinn kam, wenn ich mir Björns Erinnerungen vorstellte und den Wahnsinn des Berühmtseins beschrieb, den Erfolg in jungen, für manche zu jungen Jahren – nicht nur für Björn Andrésen, sondern auch für Sue Lyon, die für immer Lolita bleiben wird, für Judy Garland und noch viele andere. Sophie Marceau war nicht zu jung; Ausnahmen bestätigen die Regel, sagt man ja, und die Regel könnte lauten, dass frühe Bekanntheit Kinder und Jugendliche verbrennt und bis zur Übelkeit berauscht. Sophie Marceau ist eine Ausnahme, jedoch nicht die einzige: Bevor sie gestern die Bühne des Petit Théâtre in der Maison de la Poésie betrat, rief sie Shirley Temple in Erinnerung, die als Kinderstar der dreißiger Jahre und amerikanische Ikone mit beiden Beinen fest im Leben stand und später sogar Botschafterin der Vereinigten Staaten wurde. Am Ende der Lesung erhob sich das Publikum zum Applaus, wir wurden noch einmal herausgerufen; man beklatschte den Kinostar und die Filmkunst, das meisterhafte Können Viscontis, die sumpfige Herrlichkeit Venedigs im Schatten von Lübeck.
Dieser Moment war eine Hommage auf Björn Andrésen, der zugleich völlig vergessen wurde. Dabei war es doch gerade sein Unbehagen, das mich, anfangs noch etwas ziellos, zum Schreiben bewogen hat, so wie ich in meinem ersten Roman bereits über einen anderen 15-Jährigen geschrieben habe, einen Jungen, den ich Guillaume nannte, einfach, um die Leser zu täuschen, um sie glauben zu lassen, dass es um mich gehe, meine eigene Jugend, von der ich jedoch nur ausgegangen war, um eine andere zu erfinden, sowohl die, die ich hätte haben können, wenn ich weniger Glück gehabt hätte, als auch jene, die ich tatsächlich erlebt habe, irgendwie eine Mischung, ein Leben in überhöhter oder abgeschwächter Form, je nachdem, vielleicht auch beides; ich schrieb über Zurückweisung, Gewalt, Homophobie, ich musste darüber schreiben, um atmen zu können, als ob ich mich daran erinnern müsste, dass sie immer da ist, schlummernd, aber jederzeit bereit hervorzubrechen. Ich wollte über Björns Leben schreiben, von dem er sagte, dass er es verpfuscht habe, über seine Karriere als Musiker, die er verfehlt zu haben glaubte, und wahrscheinlich lag eben darin eine Angst, die ich von mir fernhalten wollte, die Angst davor, den falschen Weg einzuschlagen und das Leben zu verpassen, ein Schicksal, dem ich unbedingt entkommen wollte.
Ich hatte Tod in Venedig im Alter von 15 Jahren gesehen. So alt war auch Andrésen, als der Film gedreht wurde, von dem mir jenes schwere, diffuse Gefühl geblieben war, das andere vor mir schon hatten, eine Art verwirrte Langeweile. Was sollte dieser Film bedeuten? Was wollte Visconti, was sollte in all das Schweigen und die Blicke hineingelegt werden? Erst als ich vor ein paar Jahren auf Arte einen schwedischen Dokumentarfilm von Kristina Lindström und Kristian Petri sah, der den Schauspieler porträtiert, habe ich verstanden. Ich habe verstanden, dass ich mich in ihn hineinprojiziert, mich gegen meinen Willen mit ihm identifiziert hatte, weil ich spürte, dass dort etwas Entscheidendes passierte, etwas Morbides, ein Absterben, etwas, was das Leben ändert oder zerstört. Und genau so hat er den Filmdreh erlebt, seine Rolle war wie ein Mord, er war der Tote in Venedig, gestorben mit 15 Jahren, lebendig eingemauert in dieser viel zu großen Rolle, der Rolle des Fleisch gewordenen Begehrens vor den Augen der ganzen Welt. Die Frage war also: Wie konnte ein einfacher Blick, der Blick des Begehrens, ein Leben zerstören? Und weiter noch: Wie hatte man dieses Kind nur so allein lassen können? Andrésen schrie innerlich: »Ich wollte woanders sein, ein anderer sein.«
Vor kurzem habe ich ein Interview mit der Essayistin Mona Chollet gelesen, in dem sie darauf hinweist, dass Kinder in der Gesellschaft kein Gehör finden. Wahrscheinlich war es das, was mich antrieb, sosehr ich auch von der Furcht besessen war, Visconti aus einem anachronistischen Blickwinkel zu betrachten und ihn in Zeiten von MeToo und offen geäußerter Empörung als Triebtäter erscheinen zu lassen. Denn wie man es auch wenden mag: Visconti konnte nie auch nur das Geringste vorgeworfen werden, es gab von ihm während des Drehs weder deplatzierte Gesten noch unangemessene Äußerungen. Er selbst sagte es den anderen immer wieder: Der junge Schauspieler musste geschützt werden. Das Objekt der Begierde war Tadzio, nicht Björn. Aber war es dann auch vernünftig, diesem Jungen die Rolle zu geben?
Die so aktuelle Frage nach der Moral in der Kunst stellt sich hier in ihrer ganzen Breite. Darf man heute das künstlerische Schaffen noch als ein amoralisches Terrain betrachten? Legt das neu geweckte Bewusstsein dem kreativen Ausdruck kein Korsett an? Meine Antwort lautet, dass Kunst sich immer außerhalb der Moral bewegen muss und dass die Moral niemals eine Last auf den Schultern der Kunst sein sollte. Gleichzeitig müssen wir aber den Menschen mit Achtung begegnen, wir müssen uns immer wieder erinnern, dass Kinder wie Schwämme sind, sensible Pflanzen, lichtempfindlich und dürstend nach den Worten Erwachsener, dass Kinder Wesen sind, die noch wachsen müssen, erwachsen werden, eben weil sie es noch nicht sind. Wenn Visconti Andrésen während des Drehs geschützt hat, so tat er es, weil dieser Junge in seiner Kindlichkeit die ursprünglichste Kunst verkörperte, eine Kunst, die über allem steht, größer als das Leben, und größer als der Tod. In meinem Roman schreibt der Maestro folgende Worte aus Thomas Manns Novelle Tonio Kröger ab: »Er arbeitete nicht wie Jemand, der arbeitet, um zu leben, sondern wie Einer, der nichts will, als arbeiten, weil er sich als lebendigen Menschen für nichts achtet, nur als Schaffender in Betracht zu kommen wünscht.« Einzig das Schaffen war ihm wichtig, und angesichts dieser Überzeugung lässt sich auch das Ur-Trauma verstehen; der Beginn seines Scheiterns, wie Andrésen es nannte.
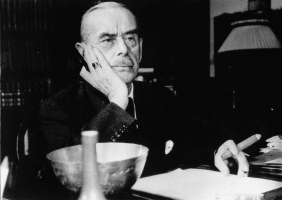
Es passierte im Anschluss an die Filmvorführung in Cannes. Auf dem Festival wurde Viscontis Werk zum ersten Mal der Öffentlichkeit gezeigt; zum ersten Mal gehörte der Film nicht mehr nur ihnen, und Björn, den Blicken der ganzen Welt ausgesetzt, war nunmehr Tadzio, einzig und allein Tadzio, das blonde Kind aus dem Norden, dessen Züge bald für immer mit den seinen verschmelzen sollten, was er damals noch nicht ahnen konnte. Auf der Pressekonferenz sagte Visconti zu den Journalisten, dass der junge Schauspieler neben ihm mittlerweile 16 sei und dass man sich bewusst machen müsse, dass er früher noch weitaus schöner war. Dass er weitaus schöner war, als er ihn ein Jahr vorher zum ersten Mal sah, mit nacktem Oberkörper in jenem Stockholmer Hotelzimmer, wo er das Casting abhielt. Vorsichtig hatte Visconti ihn gebeten, zunächst herumzugehen, dann seinen Pullover, sein T-Shirt und schließlich die Hose auszuziehen, zu lächeln, in die Kamera zu schauen und zu lächeln. Andrésen war ziemlich groß, und die Gefahr bestand, dass er älter als die Figur in Thomas Manns Novelle erscheinen könnte, Visconti zögerte daher einen Moment, aber eigentlich wusste er es schon, er wusste sehr genau, dass er an jenem Tag den Schauspieler gefunden hatte, den er seit Monaten suchte. Mit 16 Jahren war es für Andrésen also bereits zu spät: Vielleicht waren seine Züge im Vergleich zum Film schon etwas ausgeprägter, weniger fein, und womöglich wurde auch seine Behaarung langsam stärker.
Am selben Abend nahmen der Regisseur und Dirk Bogarde, der die Rolle des alten Komponisten Aschenbach spielte – in der Novelle geht es um einen alten Schriftsteller, doch Thomas Mann hatte einmal gesagt, dass ihn eigentlich Gustav Mahler zu dieser Figur inspiriert habe, Visconti hatte ihn also beim Wort genommen –, Björn mit in einen Nachtclub.
Einen Schwulenclub, wo er angemacht wurde. Andrésen erzählte später, dass er sich nicht daran erinnern könne, was damals passiert sei. Wie hat der Abend geendet, wie ist er wieder ins Hotel gekommen? Zurückblickend bleibt dem heute 69-Jährigen von jener Nacht nur eine Mischung aus Verwirrung und Wut, ein schwarzes Loch der Unmöglichkeiten und der Unruhe, kurz: Dissoziative Amnesie.
An dieser Stelle eine Anmerkung: Beim Lesen der Forschungsliteratur, an allererster Stelle Visconti, Une vie exposée von der Filmhistorikerin Laurence Schifano, bin ich auf das gestoßen, was später der Titel meines Buches werden sollte: Das Wappen des Hauses Visconti. Die Vorfahren des Regisseurs herrschten vom 13. bis zum 15. Jahrhundert über Mailand – Luchino entdeckte übrigens während der Vorbereitungen zur Verfilmung von Klaus Manns Erzählung Ludwig, dass er mit dem König von Bayern entfernt verwandt war – und schmückten ihre Paläste stolz mit einem Wappenschild. Darauf abgebildet war die eindrückliche Allegorie einer gewundenen Schlange, die eine Krone trägt und ein Kind verschlingt – als ob diese Geschichte seit 800 Jahren im Leben der Adelsfamilie vorbestimmt gewesen wäre. In einem 1829 in der Sammlung Die Orientalen veröffentlichten Gedicht schrieb Victor Hugo:
Ihr kennt die Schlüssel Roms, das Kind Mailands, das schreit
Im Schlund der Schlange bebend –
In der Ausgabe des Nouvel Observateur, in der das erwähnte Interview mit Mona Chollet erschien, fanden sich auch Auszüge aus einem Buch von Mara Goyet. Auch sie ist Essayistin und spielte im Alter von zehn Jahren in dem 1984 gedrehten Film Der Mann, der weint (La vie de famille) von Jacques Doillon. An der Seite von Sami Frey verkörperte sie die Tochter von Emmanuel, einem »geschiedenen, düsteren« Mann. Es geht um die Beziehung zum Vater, einem Vater, der sie eines Abends, als sie von Ängsten geplagt zu ihm ins Bett schlüpft, ermahnt, die Situation nicht »auszunutzen«. Einem Vater, der seine Tochter missbraucht, ohne dass je darüber gesprochen wird. Mara Goyet hat während des Drehs sexuelle Übergriffe weder selbst erlebt, noch wurde sie Zeugin davon, und dennoch kämpft sie bis heute mit den Erinnerungen. Schon bei der ersten Lektüre des Drehbuchs spürte sie ein Unbehagen, eine Beklemmung, etwas, was sie lieber nicht gesehen oder gewusst hätte, vergleichbar mit einem Film, den man sieht, obwohl man noch zu jung dafür ist, einem Horrorfilm beispielsweise, den man im Fernsehen heimlich mitschaut, wenn die Eltern gerade abgelenkt sind. Mara Goyet erzählt, dass sie das Gefühl gehabt habe, eine Abfolge von Sex- und Pornoszenen zu lesen, ohne dass es ihr damals möglich gewesen sei, mit jemandem darüber zu sprechen. Ihr Vater – ihr echter Vater wohlgemerkt – hatte das Drehbuch verfasst; wie also hätte sie ernsthaft annehmen sollen, dass er Dinge hineinschrieb, die unangebracht wären? Man hätte ihr vorgeworfen, für ihr Alter ganz schön verdorben zu sein, daher schwieg sie lieber, im Vertrauen, dass alles gut gehen würde und die Erwachsenen schon wüssten, was sie taten. Heute sagt Mara Goyet, sie sei »psychisch missbraucht« worden.
Beim Filmstart von Tod in Venedig äußerte Visconti einem Reporter gegenüber, dass keinerlei Gefahr bestehe, »in Sexualität abzudriften«, da es schließlich nur um ein platonisches Verlangen gehe, eine reine, den griechischen Mythen nachempfundene Liebe der Schönheit.

In diesem Moment öffne ich meine Ausgabe der Briefe von Thomas Mann. Vor mir liegt der erste Band, herausgegeben von Erika, 1961 erstmals veröffentlicht bei S.Fischer und 1966 dann bei Gallimard in der Übersetzung von Louise Servicen. Am 1. November 1934, auf den Tag genau vor neunzig Jahren also, schreibt Mann an seinen Verleger Gottfried Bermann Fischer über eine mögliche Verfilmung von Der Tod in Venedig, ein solches Projekt sei »ja interessant, obgleich mir die Verwirklichung noch recht unwahrscheinlich ist. Adolf Wohlbrück«, so der Autor weiter, »ist doch wohl zu schön, um wahr zu sein als Aschenbach. Für den Tadzio ist er zu alt.« Dazu muss man wissen, dass Władysław Moes, jener Junge, der Thomas Mann zur Figur des Tadzio inspirierte, zehn Jahre alt war, als er ihn an einem Ferientag im Frühling 1911 in Venedig zum ersten Mal sah.
Mann war vom ersten Blick an vernarrt in ihn. So erzählt es auch Katia Mann in ihren Memoiren, wo sie festhält, dass Thomas dem Kind zwar nicht durch die Straßen der Stadt folgte, wie er es später in seiner Novelle beschrieb, dass er von dem Jungen aber zumindest stark »fasziniert« war: »Er gefiel ihm über die Maßen, und er hat ihn auch immer am Strand mit seinen Kameraden beobachtet. [...] Und ich weiß noch, daß mein Onkel, Geheimrat Friedberg, ein sehr berühmter Kirchenrechtslehrer in Leipzig, ganz empört gesagt hat: Na, so eine Geschichte! Und ein verheirateter Mann! Schließlich ist er Familienvater!« Luchino Visconti, der sich sein ganzes Leben darum bemüht hat, Literatur fürs Kino zu bearbeiten, Autoren und ihren Werken, die für ihn über allem standen, eine Verfilmung zu schenken, hielt sich am Ende selbst für Gustav von Aschenbach oder sogar für Thomas Mann, und vielleicht war das im Grunde auch immer sein Ziel gewesen: selbst auch Literat zu werden.
Etwas später in seinen Briefen erwähnt Thomas Mann eine geplante Ausgabe der Neuen Rundschau, die Samuel Fischer gewidmet werden sollte, dem Schwiegervater Gottfrieds und zwei Wochen zuvor verstorbenen Verlagsgründer. Er schreibt, dass er vorhabe, für die Gedenkausgabe ein Kapitel aus dem dritten Band von Joseph und seine Brüder zu schicken, fragt sich aber – welche Überraschung! –, ob der Text nicht vielleicht zu lang sein könnte ...
Wie einschüchternd es ist, lieber Roland, an dieser Stelle selbst zu schreiben. Lass mich Dir meinen allergrößten Dank aussprechen, für die Einladung, dem deutschen Lesepublikum mein Buch vorzustellen, und für Deine wertvolle Unterstützung. Ich freue mich, dass bei der Gelegenheit auch die Eltern meines Lebensgefährten in Westfalen mich zum ersten Mal lesen können. Mit Freude und in Freundschaft möchte ich daher die Leserinnen und Leser dieser Zeilen auf der anderen Rheinseite grüßen.
Herzlich,
Guillaume Perilhou
Aus dem Französischen von Johannes Finkbeiner
______________________________________________
Dieser Text entstand exklusiv für die NEUE RUNDSCHAU 2025/1

Guillaume Perilhou
Guillaume Perilhou, geboren 1990, war Literaturjournalist und arbeitet heute im Verlagswesen. Nach »Ils vont tuer vos fils« (2022) erschien 2024 sein zweiter Roman »La Couronne du serpent«.