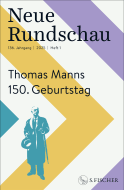
Thomas Manns 150. Geburtstag: Veronika Fuechtner »A Saudade de Thomas Mann«
Ein Text von Veronika Fuechtner

Ich mochte Thomas Mann eigentlich gar nicht. Mit sechzehn las ich Heinrich Manns Henri Quatre. Von da an glaubte ich in meiner adoleszenten, protestdurchtränkten Literaturwut zu wissen, wer der revolutionärere, spannendere und wortmächtigere Bruder sei. Ich war Team Heinrich. Als müsste da eine Entscheidung getroffen werden. Der Thomas Mann, der mir in den achtziger Jahren durch die Schule und durch die Medien vermittelt wurde, wirkte auf mich konservativ und pompös. Ich kannte damals das gemeine Bonmot von dem »hochgezüchteten Marzipanmann aus Lübeck« noch nicht, das ihm sein Kritikerfeind Theodor Lessing verpasst hatte. Aber es entsprach meinem damaligen Bild: norddeutsch, oft dekorativ und ziemlich beige.
Mit dem Studium in den neunziger Jahren wurde es nicht besser. Ich beschäftigte mich intensiv mit Klaus Mann, und wer das einmal getan hat, kann nur schwer die gesammelte Familiengrausamkeit aus den literarischen Werken herausfiltern, geschweige denn Sympathie entwickeln. Da wusste ich bereits, dass die Mutter von Thomas und Heinrich Mann, Julia Mann, geborene Julia da Silva-Bruhns, aus Brasilien kam. Meine Mutter muss es mir irgendwann gesagt haben. Meine Mutter kommt auch aus Brasilien. Dieses Land ist nicht schüchtern, wenn es darum geht, bahnbrechende Errungenschaften für sich zu reklamieren. Der erste bemannte Flug? Alberto Santos Dumont. Das Radio? Roberto Landell. Und ein bekanntes brasilianisches Sprichwort besagt, dass Gott Brasilianer sei. Da schlug die Nachricht, dass der bekannteste deutschsprachige Schriftsteller der Moderne auch irgendwie Brasilianer sei, bei mir keine großen Wellen.
Ich beschäftigte mich intensiv mit dieser Moderne, aber ich schlug zunächst einen großen Bogen um alles, in dem auch nur ein Hauch von, damals nannten wir es: Multikultur mitschwebte. Ich war eine angehende deutsche Germanistin, die tagtäglich die Frage beantworten musste, warum sie so gut Deutsch spricht. Eine wohlwollende Professorin legte mir nahe, ich sollte mich auf türkisch-deutsche Literatur spezialisieren, nachdem ich ihr erzählt hatte, dass ich Deutsch-Brasilianerin sei. Das bestärkte mich noch mehr in dem Vorhaben, mein Forschungsprogramm so deutsch- deutsch wie möglich anzulegen. Ich wollte mit der Wahrnehmung meines Aussehens wenigstens auf dem Papier dezidiert brechen können. Wenn mich jemand fragte, woher meine Familie denn eigentlich komme, sagte ich manchmal wahrheitsgemäß, aber unerwartet: »Ostpreußen.«
Meinen akademischen Absprung in die USA empfand ich als Befreiung. Das germanistische Wissen konnte hier von verschiedenen Körpern getragen werden. Dass es da auch Grenzen gibt, wurde mir erst später klar, aber sie sind immer noch weiter gezogen als in Deutschland. In einem wundervollen Seminar mit Mike Lützeler las ich den Doktor Faustus. Ich wurde immer noch nicht warm mit Thomas Manns Sprache, hier erschien er mir zu pedantisch-pädagogisch, aber ich begann ihn im Kontext des literarischen Exils und seines politischen Engagements zu schätzen. In dieser Zeit begann ich auch, mich mit den Büchern zu beschäftigen, die in der US-amerikanischen Germanistik den deutschsprachigen Kanon erweiterten: von May Ayim bis Feridun Zaimoglu. Ich schrieb über den brasilianischen Schriftsteller Zé do Rock, der die deutsche Orthographie mit seinem ultradoitsh radikal internationalisierte. In einem Artikel über do Rocks Roman fom winde ferfeelt bemerkte der Literaturwissenschaftler Jörg Drews 1995: »Jo, und am End samme natürlich stolz drauf, daß es a brasilianisch deutsche Mynchna is, der wo uns a solchs Gschenk gemacht
hat. Wo mia doch scho amol an Autoa in Mynchn ghabt ham, der wo graoss war und, wenn mas genau nimmt, brasilianisch-deutsch war. Nämli da Thomas Man.« Das war zu einem Zeitpunkt, als in Deutschland die brasilianische Familiengeschichte der Manns, wenn überhaupt, nur als Fußnote firmierte. Drews nahm es genau und schrieb Julia Mann die Bedeutung zu, die zu dem Zeitpunkt vor allem nur in einem Kontext so gesehen wurde, nämlich in der Familie Mann.
Frido Mann hatte einen Teil seiner Kindheit bei Thomas und Katia Mann in Kalifornien verbracht. Sein Großvater hatte ihm beim Spazierengehen in Pacific Palisades von seiner brasilianischen Mutter erzählt. Seit den achtziger Jahren setzte er sich intensiv mit seiner Urgroßmutter auseinander, mit der ihn der frühe Verlust der Kindheitsidylle verband – für sie Paraty, für ihn Pacific Palisades. Er lernte Portugiesisch und bereiste ab Mitte der neunziger Jahre sein »Stück verlorengegangene Heimat« immer wieder, u. a. mit dem Schweizer Schriftsteller Peter K. Wehrli, der einen sehenswerten Dokumentarfilm über Julia Mann drehte. Frido Mann besuchte auch das Gut, auf dem seine Urgroßmutter ihre frühe Kindheit verbracht hatte, die Fazenda Boa Vista. Der Wunsch entstand, »die Vergangenheit mit der Zukunft zu verbinden«, und er verfolgte über Jahre hinweg das Projekt, ein Kulturzentrum in der Fazenda Boa Vista zu etablieren – auch mit Unterstützung der Bundesregierung und des Goethe- Instituts. Diese Vision scheiterte nach vielen Anläufen an der Unmöglichkeit, das Haus zu erwerben. Aber das Goethe-Institut São Paulo unter der Ägide von Dieter Strauss organisierte eine Wanderausstellung mit einem Katalog, der 1999 auf Deutsch und Portugiesisch erschien und der eine erste tiefgehende Auseinandersetzung mit dieser Geschichte darstellte. Es sollten andere folgen, die auch einer deutschsprachigen Leserschaft vor Augen führten, was in der brasilianischen Öffentlichkeit wie auch in der germanistischen Forschung Brasiliens immer präsent gewesen war – wie zentral für Thomas Mann die Geschichte seiner Mutter war.
Brasilianische Intellektuelle sahen Thomas Mann als Seelenverwandten, und seine Literatur inspirierte brasilianische Autor*innen der Moderne wie José Lins do Rego, João Guimarães Rosa und Clarice Lispector. 1929 interviewte der brasilianische Schriftsteller und Soziologe Sérgio Buarque de Holanda Thomas Mann im Hotel Adlon und kommentierte, dass Thomas Mann bei genauerer Betrachtung tatsächlich doch etwas brasilianisch aussehe. Er schrieb, dass Manns Großmutter, Maria Luiza da Silva-Bruhns, mütterlicherseits eine »crioula« sei, also portugiesischer und indigener Abstammung, wie er ausführte. Für seine brasilianische Leserschaft der Zeit ließ dieser Begriff auch einen Bezug zu afrikanischen Wurzeln zu. Thomas Mann soll in dem Gespräch seinen Stil und sein »nicht sehr deutsches Temperament« auf seine Familiengeschichte zurückgeführt haben. Der Exilschriftsteller Ernst Feder attestierte 1950 für Jornal do Brasil den ästhetischen »Einfluss des brasilianischen Índios« auf Thomas Mann und schickte ihm postwendend seinen Artikel mit einer herzlichen Widmung. Auch der Politikwissenschaftler Vamireh Chacon sah Thomas Mann als einen »brasilianischen Bruder« und erklärte in den siebziger Jahren: »Der Zauberer gehört auch uns.«

Bis heute ist die brasilianische Rezeption von diesem Gefühl der Verwandtschaft geprägt. Chico Buarque, der legendäre Autor vieler Sambas, die in Brasilien auswendig mitgesungen werden, veröffentlichte 2014 den autofiktionalen Roman Meu Irmão Alemão vor dem Hintergrund seiner Entdeckung, dass er einen deutschen Halbbruder hatte. In dem Roman stellt sich Chico Buarque vor, dass sein Vater, Sérgio Buarque de Holanda, bei seinem Interview im Adlon Thomas Mann die Freundin ausspannte und mit ihr diesen Sohn hatte. Diese phantasierte familiäre Verwicklung gab einer langjährigen Affinität zur deutschsprachigen Kultur Ausdruck: Buarque schrieb seine eigene Version der Dreigroschenoper als scharfe Kritik der brasilianischen Militärdiktatur und vertonte Die Bremer Stadtmusikanten als Kinderoper.
Die brasilianische Rezeptionsgeschichte wurde in Deutschland lange nicht in das Bild von Thomas Mann integriert, obwohl Thomas Mann es selbst streckenweise durchaus nicht anders sah. Schon vor dem Ersten Weltkrieg wehrte er sich – damals noch vorsichtig und mit Ambivalenz – gegen antisemitische Angriffe damit, dass die Fremdheit, die an ihm wahrgenommen werde, wohl mit seiner Blutmischung zu tun haben müsse. 1930 schrieb er ein Porträt über seine Mutter für die Bayrische Staatszeitung, in dem er die Schönheit ihrer »spanischen Turnüre« lobte und sie mit berühmten Tänzerinnen verglich. Im amerikanischen Exil verarbeitete er seine Beziehung zu seiner Mutter u.a. in der Korrespondenz mit seiner US-amerikanischen Unterstützerin Agnes Meyer, und er beschrieb sich selbst als »überseeisch-lateinisch gemischte[n] Deutsche[n]«. Brasilien wurde in seinen Briefen zu seinem »Mutterland«. Ich überlegte lange, ob ich über diese Geschichte schreiben sollte – die Biographie einer Familiengeschichte, die in dem einen Land so präsent war und im anderen nur in Spuren und Fußnoten existierte. Ich befürchtete, dass meine Fähigkeit, beide Sprachen und Kulturen zu lesen, als identifikatorische Leseübung wahrgenommen werden würde. Und ich war immer noch nicht im Team Tommy.
Ich überlegte lange, ob ich über diese Geschichte schreiben sollte – die Biographie einer Familiengeschichte, die in Mich wunderte es nicht, dass sich so wenige Germanistinnen mit Thomas Mann auseinandersetzten – seine vergleichsweise oberflächlich und ungnädig skizzierten Frauenfiguren laden nicht gerade dazu ein (von wenigen Ausnahmen wie Lotte in Weimar abgesehen). Thomas Mann war für mich ein deutsches Monument so wie Wagner oder Nietzsche, ein Germanistengral, der lebenslange Studien und ergebenste Pilgerfahrten einforderte. Wie sehr das eigentlich eine relativ neue Konstruktion ist und wie lange Thomas Mann in der BRD und der DDR ambivalent gesehen wurde, wurde mir erst später klar.
Ich reiste im Dezember 2008 das erste Mal zusammen mit meiner Mutter nach Paraty. Sie hatte als erfahrene Journalistin keinerlei Hemmungen, wenn es darum ging, Leute aufzuspüren und auszufragen. Ich war ihrer Meinung nach in meinen Vorstellungen von Etikette leider doch etwas zu deutsch geprägt, und ich brauchte ganz klar Hilfe. Wir stiegen gemeinsam in der Pousada do Principe ab, einem Hotel, das dem Urgroßenkel des letzten Kaisers von Brasilien, Dom Pedro II, gehört. Dieser war ein Kenner deutschsprachiger Kultur gewesen und hatte den Großvater Thomas Manns, einen zunächst mittellosen Immigranten aus Lübeck, bei seinem Aufstieg in die Wirtschaftselite des imperialen Brasiliens gefördert. Den beiden wurde eine fast unheimliche Ähnlichkeit nachgesagt, die sich auf Bildern durchaus bestätigt. Aus dem Deutschen Johann Ludwig Hermann Bruhns wurde der Brasilianer João Luiz Germano Bruhns, der katholisch wurde, zu Hause Portugiesisch sprach und den Großteil seines Lebens in Brasilien lebte und wirkte. Bruhns besaß nicht nur die Fazenda Boa Vista, sondern auch andere Ländereien in der Gegend. Seine erste Frau, die Großmutter Thomas Manns, Maria Luiza da Silva-Bruhns, stammte aus einer wohlhabenden Familie, der Ländereien auf Ilha Grande, einer Insel unweit von Paraty, gehörten. Die Familien Bruhns und da Silva versklavten für den Zuckerrohr- und Kaffeeanbau Hunderte von Menschen.
Die Pousada do Principe verspricht auch heute noch, »eine Zeitreise zu unternehmen und den Komfort einer kolonialen Umgebung zu erleben«. Wir wanderten durch die pflastersteinbedeckten Straßen der weiß getünchten und golddekorierten Altstadt aus dem 18.Jahrhundert, ein UNESCO-Welterbe. Die Stadtbewohner erzählten uns verschiedene Versionen von der kafkaesken Saga um die gescheiterte Casa Julia Mann. Der Status quo sei, dass der Weltumsegler Amyr Klink das Haus verwalte. Er habe sich erst für die Geschichte des Hauses begeistert, aber verweigere jetzt die Zusammenarbeit. Manchmal ist von undurchsichtigen politischen Interessen die Rede, von Geldwäsche und von dem Haus als einem günstigen Drogenumschlagplatz. Aber letztendlich scheint die Erklärung am wahrscheinlichsten, dass dieser Ort wunderbar touristisch erschlossen werden könnte, mit einem Yachthafen und einer Luxuswohnanlage, wenn dieses denkmalgeschützte Haus nur endlich vollständig verfallen würde. Im Stadtmuseum sehen wir den Kurzfilm Julia Mann e o Paraiso Perdido von Nena Gama (1998). Der Satz, dass das größte Kulturgut von Paraty nicht die Häuser und Kirchen seien, sondern die Menschen und ihre Verbindungen zueinander, klingt in mir noch lange nach. Wir treffen den Stadthistoriker Diuner Melo, den ich schon von seinen Veröffentlichungen kenne. Er erzählt sehr bewegt von Julia Manns Kindheitsidylle barfuß am Strand, von ihren Brüdern, die aufs Lyceum in Rio geschickt wurden, von den technischen Entwicklungen ihres Vaters, der den Zuckerrohr mit dampfbetriebenen Maschinen verarbeiten ließ, und davon, wie die Trauer um den frühen Tod ihrer geliebten Mutter sie ein Leben lang prägte.
Wir fahren mit einem Taxi zur Fazenda Boa Vista hinaus, die in einer kleinen Bucht gegenüber der Altstadt gelegen ist. Vor dem Weg zum Gutshaus ist eine Absperrung. Ich will umdrehen, da hat meine Mutter sie schon zur Seite geschoben. Zwei Pitbulls bellen uns an, und wir weichen erschrocken zurück, aber sie sind am Haus angekettet. Das Gelände ist verwildert, und das Haus sieht verfallen aus. Es scheint jemand darin zu sein. Direkt vor der Haustür ist ein rotes Auto geparkt. Über dem Balkongeländer hängt ein Neoprenanzug in der Sonne zum Trocknen. Wir sehen ein Schild »Adrenalina Diving Experience«. Aus dem Haus klingt Heavy- Metal-Musik. Wir laufen um das Haus herum durch das Gartengelände an den kleinen Sandstrand, vor dem einige Segelboote vor Anker liegen. Von hier aus lässt sich die ganze Bucht überblicken. Ich denke darüber nach, wie sehr sich dieser Blick auf Paraty von dem Blick auf Lübeck unterscheidet. Und wie viel kälter und ärmer Lübeck in jeder Hinsicht gewesen sein muss für eine siebenjährige Brasilianerin. Wie hatte der brasilianische Schriftsteller João Silverio Trevisan sie beschrieben? Sie war eine barocke Brasilianerin, die viel lachte. München passte da besser.
Ich fahre nach München, um Frido Mann kennenzulernen. Er war tatsächlich nach München gezogen, weil es ihn auch an die mutige Entscheidung seiner Urgroßmutter erinnerte, nach dem Tod ihres Mannes mit ihren jüngeren Kindern Lübeck gen Süden zu verlassen. München war dann über fast vier Jahrzehnte auch Thomas Manns Zuhause. Frido Mann berichtet von seinen Begegnungen mit seinen brasilianischen Verwandten und von einem spontanen Capoeira-Abend in Paraty. Schon seine Urgroßmutter schrieb in ihren Memoiren von der afro-brasilianischen Kultur, und er fühlt sich auch damit verbunden. Vielleicht war diese Verbindung mehr als Affinität. Schließlich, so Frido Mann, wisse man ja in Brasilien nie, was für Mischungen bestehen.

Ich reise 2018, zehn Jahre später, noch einmal nach Paraty, diesmal professionell unterstützt von einer durch Absperrungen ebenfalls unbeirrbaren brasilianischen Doktorandin. Einige Monate vor meiner Reise hörte ich einen Vortrag von dem Anthropologen João Biehl. Für sein Buchprojekt über die brutale Niederschlagung des Aufstandes der deutschstämmigen Religionsgemeinschaft der Mucker hat er zusammen mit dem Fotografen Torben Eskerod den Süden Brasiliens bereist. In Eskerods Fotografien der heutigen Landschaft und der Gesichter ihrer Bewohner spiegelt sich eindrucksvoll die gewaltvolle Vergangenheit des 19. Jahrhunderts. Biehl artikuliert, was mir vorschwebt – das historische und literarische Wissen von Orten und Nachfahren lesbar zu machen. Ich treffe wieder Diuner Melo, der diesmal in einer langen weißen Tunika aus seiner Zeit in Marokko erscheint. Aber im weltoffenen Paraty dreht sich, wie er halb enttäuscht scherzt, niemand nach einem Möchtegern-Araber um. Er erzählt, dass er als Kind selbst viel Zeit auf der Fazenda Boa Vista verbracht hatte, da sie einige Zeitlang seinem Großonkel gehörte.
Er erinnert sich noch, wie das Haus in den 1940er und 50er Jahren aussah, bevor die Innenräume umgestaltet wurden: Es gab die Reste einer kleinen Kapelle, und über dem Anbau mit dem Mahlwerk war ein Dachboden, auf dem die letzte versklavte Familie gewohnt hatte. Die zehn Hütten für die versklavten Familien standen nicht mehr – in jeder hatten zwei bis vier Familien gewohnt. Diuner erzählt, dass Bruhns nicht nur wegen des Todes seiner Frau mit seinen Kindern aus Paraty nach Rio weggezogen war, sondern weil die Cholera drohte sich dort auszubreiten. Ich denke an die Cholera im Tod in Venedig. Thomas Mann kannte die Angst vor Cholera und auch vor Malaria, an der sein Großvater später erkrankte, schon aus den Erzählungen seiner Mutter. Diuner erzählt viel vom Netzwerk der Menschen, die sich in Paraty der brasilianischen Geschichte der Familie Mann verbunden fühlen. Dazu gehört auch die Rechtsanwältin Maria Sene. Sie wirft ihre langen braunen Haare zurück und lacht: »Ich bin Julia, ich bin auch eine Nomadin.« Die Mutter Thomas Manns berührte sie bei ihren Recherchen zutiefst in ihrer »brasilidade«; sie lebte in dieser bunten Landschaft, in der alles mit ihr zusammen aufblühte.
»Julia ist nie Deutsche geworden«, sagt Sabina Wenzel, als ich ihr davon erzähle, wie ich Julia Manns Begeisterung für Goethe im Archiv rekonstruiere. Julia sei in Norddeutschland viel zu sehr aufgefallen: »Da hat sie eher ihr eigenes Leben gelebt. (...) Da war sie auch eher so eine Künstlerin.« Ich hatte gehört, dass sie auch Künstlerin sei, aber Sabina winkt ab – sie sei nur im Herzen Künstlerin. Sie führt eine Kunstgalerie in Paraty. An ihrer Pinnwand hängt ein Foto mit Frido und Christine Mann in der Sonne vor dem ufoförmigen Museo de Arte Contemporáneo de Niterói, das einen spektakulären Blick auf den Zuckerhut freigibt. Darunter hängen zwei Schwarz-Weiß-Bilder von Sabina als kleines Kind auf der Straße vor einer Buchhandlung in Charlottenburg. Das war vor der Flucht mit ihrer Mutter in die Schweiz. Sabinas Tante, die Schriftstellerin Gertrud Kolmar, die ihrer Nichte noch lange aus Berlin schrieb, wurde in Auschwitz ermordet. Nach einem bewegten Leben mit Posten bei der UNO und beim Schweizer Konsulat in Rio ließ Sabina sich in Paraty nieder. Als sie von der Geschichte der Fazenda Boa Vista erfuhr, fuhr sie gleich hin. Da wurde ihr gesagt, Thomas Mann sei auch gerade da gewesen. Das kann doch nur der Frido gewesen sein, dachte sie, und so sei sie eben in die ganze Sache hineingerutscht. Als ich ihr erzähle, dass wir morgen zum Haus fahren, beschließt sie spontan mitzukommen.
Das Gelände hat sich sehr verändert. Wo vorher noch ein paar Segelboote vereinzelt vor Anker lagen, steht jetzt eine ganze Marina. Die zwei Wachmänner sind zunächst misstrauisch, aber sie scheinen Sabina zu kennen. Sie lassen uns eine Weile auf dem Gelände herumstreifen. Das Haus ist jetzt noch weiter verfallen, und es scheint sich niemand mehr darin zu aufzuhalten. Sabina steht auf der Marina und schaut aufs Meer. Der Blick ist nach wie vor atemberaubend. Ich denke daran, wie ihre Exilgeschichte nun mit dieser früheren Geschichte des Verlustes einer Kindheitsidylle verbunden ist. Und das ist die Erfahrung, die in der Familie Mann über die Generationen so tief sitzt: das Ende einer unbeschwerten Kindheit, der Abschied von der Heimat, der Verlust der Eltern und der Verlust der Sprache. In ihren Memoiren erinnert sich Julia Mann, wie sie mühsam die fremdartigen deutschen Silben mit Hilfe eines Bilderbuches nachstammelt. Als Erwachsene sang sie auf Italienisch, und sie schrieb in mehreren Sprachen – in ihren Briefen und Geschichten fließt ab und zu Englisch oder Französisch mit ein. Die Mehrsprachigkeit und das Befremdliche am Deutschen bestimmen auch Thomas Manns Literatur: Johann Buddenbrook schweift gerne ins Französische ab, die Ausrufe der Einwohner von Torre di Venere werden ab und an im Italienischen belassen, in Frau Aarenholds Rede ist noch das »mit Kehllauten reiche« Jiddisch ihrer Kindheit hörbar, und die Damen
vom guten Russentisch dürfen auch mal gerne in ihre »weiche, gleichsam knochenlose Sprache« verfallen. Fremde Akzente werden überall gesetzt und gehört. Anders als andere Exilanten, die sich mit dem Englischen schwertaten, hielt Thomas Mann mit Unterstützung seiner mühelos mehrsprachigen Tochter Erika Vorträge auf Englisch. Ich frage mich, ob seine Mutter manchmal noch mit fast unhörbarem Akzent sprach, nachdem sie schon lange nicht mehr ihre Briefe auf Portugiesisch schrieb.
Wir suchen nach weiteren Spuren auf der Ilha Grande, dem Wohnort von Thomas Manns Urgroßeltern, und in verschiedenen Kirchen- und Stadtarchiven der ganzen Gegend, später auch in Rio, der früheren Hauptstadt des brasilianischen Imperiums. Manchmal werden wir fündig, aber viele Lücken bleiben bestehen, und einige Dokumente widersprechen sich. Ich frage mich, was uns Archive überhaupt sagen können. Die Anthropologin Ann Stoler betont, wie wichtig es sei, dass historische Arbeit nicht nur den Inhalt von Archiven offenlege, sondern auch die Weise, in denen sie konstituiert und erforscht wurden, vor allem wenn es um Kolonialgeschichte gehe. Und die Kulturwissenschaftlerin Anjali Arondekar fordert eine neue Haltung gegenüber Archivarbeit ein, eine »andere Art von Archivromanze«, die nicht nur die Logik der Entdeckung und der Vervollständigung einer vernachlässigten Geschichte einschließt, sondern auch eine Beziehung zu Lücken im Archiv, zu fehlenden Archiven und zum Scheitern von Erzählung. In ihrem bahnbrechenden Essay Venus in Two Acts schreibt Saidiya Hartman über die »Stille des Archivs« in Bezug auf die Erfahrungen der im transatlantischen Menschenhandel aus Afrika verschleppten und ermordeten Millionen von Frauen. Hartman thematisiert den Wunsch nach Dramatisierung dieser Erfahrung, den Versuch mit und gegen das Archiv, das nur vereinzelt Gewalt und Tod dokumentiert und perpetuiert, eine Geschichte zu erzählen. Es ist ein Versuch, in der Vorstellung eine Brücke zu schlagen zwischen Vergangenheit und Gegenwart und auf neue Möglichkeiten des Erzählens zumindest hinzuweisen, auch wenn diese letztlich unzulänglich sind.
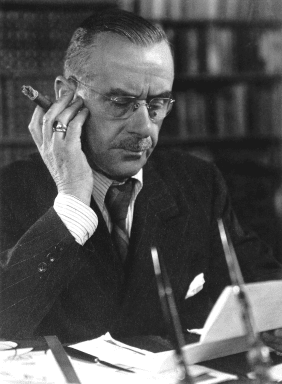
So reich die Archive der Familie Mann scheinen mögen, sosehr die gesamte Forschungsliteratur zu ihnen ganze Bibliotheken füllen könnte, so gibt es doch viele Fragen, die sich nicht beantworten lassen. Wie war es für Julia Manns versklavte Amme, die Mosambikanerin Anna, nach Lübeck zu kommen? Wie war ihre Beziehung zu Julia Manns verwitwetem Vater? Wie haben die beiden Schwestern Julia und Mana, Thomas Manns Tante Stolterfoht, von ihrer Kindheit gesprochen? Wie war der Kontakt zu ihren nach Brasilien zurückgekehrten Brüdern und zum Vater, als er mit seiner zweiten Frau in Brasilien eine neue Familie gründete? Wusste Thomas Mann, dass sein Cousin Ivan da Silva-Bruhns, der Sohn seines Onkels Manoel, in Paris lebte und dort abstrakte Figuren in Teppiche webte? Hieß er mit zweitem Vornamen Paul wie die erste Liebe seiner Mutter oder wie sein brasilianischer Onkel? Als Heinrich und Thomas Mann ihre außereuropäische »Blutmischung« in ihrem gemeinsamen Italienaufenthalt aufzuarbeiten suchten, wie ihr jüngerer Bruder Viktor berichtete, was besprachen sie da genau? Wenn Thomas Mann mit seiner Familie am Mittelmeer oder an der Kurischen Nehrung Urlaub machte, dachte er da an die Strände aus den Erzählungen seiner Mutter? Wie reagierte Thomas Mann, wenn er in Helmolts Weltgeschichte von den Tupis las, den indigenen Einwohnern Paratys, die angeblich durch ihren Kannibalismus davon abgehalten wurden, höhere Kulturformen zu entwickeln? Wie fühlte er sich, wenn er auf seine brasilianische Familiengeschichte angesprochen wurde, wenn seine Mutter in Geburtstagshuldigungen als »portugiesisch-indianischer Mischling« bezeichnet wurde oder wenn sein »mütterlich exotisches Blut- gemisch« von nationalsozialistischen Publikationen als »Ursprung seines anstößigen Gauklertums« thematisiert wurde?
Ich werde nach einem Vortrag gefragt, ob Thomas Mann denn Scham verspürt habe. Ich wehre zunächst ab, aber dann erfahre ich, dass Elisabeth Mann genau von diesem Gefühl ihres Vaters sprach. Ich stelle mir
Thomas Mann als eine Art Coleman Silk vor. Der Protagonist von Philip Roths Roman Der menschliche Makel kommt aus einer Schwarzen Familie der Mittelklasse und erfindet sich als jüdischer Professor für Altphilologie völlig neu. Dann löst die Anschuldigung, dass er sich rassistisch geäußert habe, eine Lebenskrise aus. Für Silk ist im Roman die eigene Herkunft, aber auch die Leugnung der Herkunft mit Scham besetzt. Eine Kollegin überrascht mich mit der Bemerkung, dass Manns Position vergleichbar sein könnte mit der von Alexander Puschkin. Puschkin wie auch Alexandre Dumas père, diese Ikonen des europäischen Kanons, hatten versklavte Vorfahren. Sie werden in der jüngsten Forschung als Figuren von »black otherness« oder »métissage« diskutiert, deren »whiteness«
symbolisch konstruiert wird. Ich lese das Buch A Chosen Exile der Historikerin Allyson Hobbs. Es beschreibt die Trauer über den Verlust von familiären und kulturellen Bindungen, die mit dem Akt des »passing« ein-
hergeht. In Thomas Manns Texten wie Tonio Kröger lese ich diese Trauer.
Ich lese auch eine sehr genaue und empathische Analyse von Mechanismen der Ausgrenzung. Aber in seinen autobiographischen Texten wirkt Thomas Mann auf mich weit davon entfernt, wie Puschkin rassistischen Vorurteilen direkt zu begegnen oder wie Dumas kolonialen Rassismus zu reflektieren. Seine Fiktionen mögen daran arbeiten, rassistisches und antisemitisches Denken auszuhebeln, aber vor allem die frühen Texte sind gleichzeitig zutiefst darin verfangen.
Warum haben wir kein treffendes Vokabular für ein Phänomen, was es doch auch im deutschsprachigen Raum seit vielen Jahrhunderten für viele Gruppen gibt – »passing«? In der Forschung zum Judentum des 19. Jahrhunderts wird der Begriff »assimiliert« eingesetzt, aber letztlich bleibt eine Assimilation vor allem das – eine spürbar bleibende Annäherung. Julia Manns Assimilation in die Lübecker Gesellschaft bedeutete für sie die Fähigkeit, den Haushalt eines Senators zu führen, aber vor allem auch – wie für viele jüdische Intellektuelle der Zeit – eine gewisse Form von Bildung, vor allem eine profunde Kenntnis der Literatur und Musik der Klassik und Romantik. Die Spuren von Julia Manns Deutschwerden und von ihrer Migrationsgeschichte sind überall in der Literatur Thomas Manns zu lesen. Im Zauberberg beobachtet Hans Castorp am Tag nach seiner Ankunft auf dem Berghof von seinem Balkon aus eine schwarz gekleidete Frau »von düsterem, ja tragischem Aussehen« mit einem »alternde[n], südlich blasse[n] Gesicht«, die ruhelos im Garten herumwandert. Es ist eine Mexikanerin, die von den Bewohnern des Sanatoriums »tous-les- deux« genannt wird, denn gleich beide Söhne sind todkrank. Sie spricht kein Deutsch und nur wenig Französisch, und niemand auf dem Berghof spricht Spanisch, und so ist es das Einzige, was sie in ihrer Einsamkeit als Konversationsversuch anbieten kann: »tous-les-deux«. Der Roman erschien, ein Jahr nachdem Thomas Mann von seiner Mutter an ihrem Sterbebett Abschied genommen hatte. »Nachdenklich teilnehmend blickte Hans Castorp auf sie hinab, und ihm war, als verdunkele ihre traurige Erscheinung die Morgensonne.« Die Trauer, die seine Mutter ihr Leben lang mit sich trug, die Trauer über den Verlust ihrer Heimat, die Trauer über die vielen Menschen, die sie in ihrem Leben verloren hatte, und seine eigene Trauer über den Tod der Mutter klingen in dieser Passage mit. Ich werde diesen Sommer nach Lübeck fahren. Ich habe gelesen, dass es dort tatsächlich einen lebensgroßen Thomas Mann aus Marzipan gibt. Dieser mag vielleicht noch beige sein, aber meiner ist es schon lange nicht mehr.
______________________________________________
Dieser Text entstand exklusiv für die NEUE RUNDSCHAU 2025/1

Veronika Fuechtner
Veronika Fuechtner wurde in Rio de Janeiro geboren und ist vor allem in Deutschland aufgewachsen. Sie leitet den Fachbereich Vergleichende Literaturwissenschaft am Dartmouth College (USA) und lehrt dort auch in den Bereichen Vergleichende Literaturwissenschaft, Judaistik, Gender Studies sowie an der Geisel School of Medicine. Fuechtner ist die Autorin von »Berlin Psychoanalytic« (2011), die Mitherausgeberin von »Imagining Germany Imagining Asia« (2013) und »A Global History of Sexual Science 1880 – 1960« (2017).