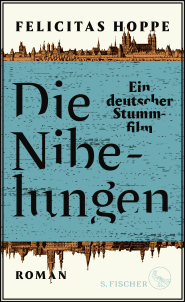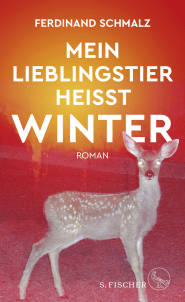Die Nibelungen
Der Stoff ist unschlagbar: ein Bad in Blut, eine schöne Frau, Gold und ein Mord, der grausam gerächt wird. So klingt das Lied der Nibelungen, die Sage von Siegfried, dem Strahlenden, seinem düsteren Gegenspieler Hagen und der schönen Kriemhild. Aber ist das die wahre Geschichte dieser europäischen Helden, die in Island oder Norwegen beginnt, am Rhein entlang spielt, die Donau runter erzählt wird und schließlich im Schwarzen Meer mündet? Niemand weiß, wie es wirklich war, meint Hoppe und erfindet die Wahrheit: hell und schnell, poetisch und politisch. Felicitas Hoppes Roman »Die Nibelungen« ist das erste gesamteuropäische Heldenepos der Gegenwart.
Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021
Die Nibelungen
Der Stoff ist unschlagbar: ein Bad in Blut, eine schöne Frau, Gold und ein Mord, der grausam gerächt wird. So klingt das Lied der Nibelungen, die Sage von Siegfried, dem Strahlenden, seinem düsteren Gegenspieler Hagen und der schönen Kriemhild. Aber ist das die wahre Geschichte dieser europäischen Helden, die in Island oder Norwegen beginnt, am Rhein entlang spielt, die Donau runter erzählt wird und schließlich im Schwarzen Meer mündet? Niemand weiß, wie es wirklich war, meint Hoppe und erfindet die Wahrheit: hell und schnell, poetisch und politisch. Felicitas Hoppes Roman »Die Nibelungen« ist das erste gesamteuropäische Heldenepos der Gegenwart.
Die Nibelungen
Sicher ist nur: Es gab eine Zeit, da gehörten alle Schätze der Welt einer Frau. Bis sie sich, ihrer überdrüssig, eines Tages auf und davon machten, sich an verschiedenen Orten versteckten und die Zauberer aller Länder bezahlten, um verzaubert und nicht gefunden zu werden. Wird der Zauber aber eines Tages gelöst, verwandelt sich der Schatz in natürliches Gold und kann nach Hause getragen werden. Dort allerdings muss er gefüttert werden, sonst zerfällt er zu Asche oder wird jedenfalls krank oder entwischt und stellt sich am Wegrand auf, um sich seine Nahrung selbst zu erbetteln. Oder wird Söldner, zieht in den Krieg, verliert ein Bein und erscheint hässlich hinkend auf der nächstbesten Hochzeit, versetzt Braut und Gäste in Angst und Schrecken, trinkt, bis er ziemlich redselig wird und verrät, er sei in Wahrheit ein Schatz und seine Knochen aus purem Gold.Der Bräutigam, in der Regel ein Offizier zweiter Klasse, schlägt ihm entschlossen den Kopf ab: Zwischen Kopf und Hals stecken drei goldene Münzen, heute kleinster Teil einer größeren Sammlung, die sich inzwischen im Museum für Gegenwartskunst in Basel befindet und für Besucher nicht zugänglich ist. Allerdings, so verriet mir einer der Wärter vertraulich, wäre es wohl besser gewesen, man hätte den Söldner lebendig gemästet, um ihn später, vor Publikum, festlich zu schlachten: Dann wäre er Rheingold gewesen.
Aber das Schatzwesen ist unberechenbar, mit eigenem Willen und Gedächtnis begabt, flüchtig und wechselhaft. Der Schatz spielt nämlich gern die dreizehnte Fee, lässt sich gern bitten, kommt nicht auf Bestellung, und bittet man ihn, kommt er immer zu spät, immer erst dann, wenn die Köpfe der Gäste schon auf der Tischplatte liegen. Denn der Schatz hat seinen eigenen Kopf und seine eigene Art, Ge-schäfte zu machen, mit der man nur mühsam ins Gespräch kommt. Und leider die Neigung, sich ständig zu trennen, sich unablässig weiter zu teilen, um überall und nirgends zu sein. Früher sei das noch anders gewesen, die Schätze hätten sich nicht so herumgetrieben, seien einfach zu Hause geblieben. Nur einmal im Jahr, meistens im Sommer, sagte der Wärter, wenn die Tage länger und die Nächte schlafloser werden, bekamen sie Heimweh nach den anderen Schätzen, brachen aus allen Ländern der Welt auf und trafen sich alle an einem Ort, den keiner von ihnen preisgeben durfte. Sicher ist nur, es zog sie zum Rhein, in die Nähe von Worms, wo sie Jahr für Jahr, völlig unbehelligt, immer dasselbe Stück zur Aufführung brachten, immer wieder von vorn.
Mein Lieblingstier heißt Winter
Der Debütroman des Bachmann-Preisträgers Ferdinand Schmalz
Der Wiener Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht soll einem makabren Wunsch nachkommen. Sein Kunde Doktor Schauer ist fest entschlossen, sich zum Sterben in eine Tiefkühltruhe zu legen. Er beauftragt Franz Schlicht, den gefrorenen Körper auf eine Lichtung zu verfrachten. Zum vereinbarten Zeitpunkt ist die Tiefkühltruhe jedoch leer, und Schlicht begibt sich auf eine höchst ungewöhnliche Suche nach der gefrorenen Leiche. Dabei begegnet er der Tatortreinigerin Schimmelteufel, einem Ingenieur, der sich selbst eingemauert hat, und einem Ministerialrat, der Nazi-Weihnachtsschmuck sammelt. Ferdinand Schmalz nimmt uns in »Mein Lieblingstier heißt Winter« mit auf eine abgründige Tour quer durch die österreichische Gesellschaft, skurril, intelligent und mit großem Sprachwitz.
Mein Lieblingstier heißt Winter
Der Debütroman des Bachmann-Preisträgers Ferdinand Schmalz - nominiert für den Deutschen Buchpreis 2021 und den Österreichischen Buchpreis 2021
Der Wiener Tiefkühlkostvertreter Franz Schlicht soll einem makabren Wunsch nachkommen. Sein Kunde Doktor Schauer ist fest entschlossen, sich zum Sterben in eine Tiefkühltruhe zu legen. Er beauftragt Franz Schlicht, den gefrorenen Körper auf eine Lichtung zu verfrachten. Zum vereinbarten Zeitpunkt ist die Tiefkühltruhe jedoch leer, und Schlicht begibt sich auf eine höchst ungewöhnliche Suche nach der gefrorenen Leiche. Dabei begegnet er der Tatortreinigerin Schimmelteufel, einem Ingenieur, der sich selbst eingemauert hat, und einem Ministerialrat, der Nazi-Weihnachtsschmuck sammelt. Ferdinand Schmalz nimmt uns in »Mein Lieblingstier heißt Winter« mit auf eine abgründige Tour quer durch die österreichische Gesellschaft, skurril, intelligent und mit großem Sprachwitz.
Mein Lieblingstier heißt Winter
Wie ausgestorben liegt er da, der Ort. Dort zwischen Buschwerk und Gestrüpp, wo auch das Gras schon meterhoch verdorrt, streckt ein Triceratops den dreibehornten Kopf empor. Das Nackenschild da in die Schultern reingepresst, das Maul zum Schrei weit aufgerissen. Doch nichts zu hören. Kein urzeitlicher Klang, der Mark und Bein zum Beben bringen würd. So harrt es still, das Ungetüm, vielleicht weil dort unter den Bäumen, hinter ihm im Schatten, schon der Fressfeind lauert. Zwischen Baumstämmen ist schon der dichtbezahnte Kiefer eines Tyrannosaurus zu entdecken. Die kleinen Händchen dicht am Leib. Den Killerblick da auf die Beute schon gerichtet, lauert er, wartet auf den Augenblick, in dem die messerscharfen Zähne er ins Fleisch des Vogelbeckensauriers dann schlagen könnt. Gräulich liegt ein Duft jetzt von Versengtem in der Luft, als wäre ein Vulkan hier in der Nähe ausgebrochen oder so ein Himmelskörper brennend da vom Himmel rausgestürzt, um sich dann in die Erde reinzugraben. Fast unscheinbar dieser Geruch, der doch erzählt vom Untergehen ganzer Welten. Ein Stückchen weiter, da am Wasserloch, ein umgekippter Stegosaurus. Die Rückenschilder teils da in den Schlamm hineingerammt, teils schon von dichtem Schimmel überzogen, weshalb auch Harald drum der Echse auf dem Bauch draufsteht, mit einem Schrubber ausgestattet. Und sich von Norbert diesen Eimer mit den Chemikalien jetzt reichen lässt, mit denen sie den Mikroorganismen auf den Makroechsen nun zu Leibe rücken wollen. Und schrubbend spricht’s aus Harald jetzt heraus, dass bei der allgemeinen Unordnung, die heutzutage herrscht, dass bei dem Chaos, das zu einem rüberschwappt, hat man den Fernseher erst mal eingeschalten, oder es, das Endgerät, dass man sich doch dann fragen muss, also dass er sich fragt: »Wo führt das alles hin?« Er sitze so zu Haus, bei sich zu Haus in seiner Wohnung drin, da auf dem Fernsehsessel, den er zwecks tieferer Entspannung sich gekauft, sitze drin im Fernsehsessel und starre tiefer rein, da in den Fernseher hinein, doch die Entspannung wolle sich beim besten Willen nicht einstellen. Ganz unrelaxt sitze er, der Harald, dann und denke da in sich, dass das doch alles lang schon nicht normal mehr sei. Und frage sich, ob das nur ihm auffalle, dass es nicht mehr normal zugehe in der Welt. Woraufhin Norbert, der am Schwanz des vorzeitlichen Riesen nun den Schrubber angesetzt, einwirft, dass ihm das alles auch ganz abnormal erscheine.
Blaue Frau
Adina wuchs als letzter Teenager ihres Dorfs im tschechischen Riesengebirge auf. Bei einem Sprachkurs in Berlin lernt sie die Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. Nach einem sexuellen Übergriff durch einen westdeutschen Kulturpolitiker strandet Adina nach einer Irrfahrt durch halb Europa in Helsinki. Dort wird Leonides, ein estnischer Politikwissenschaftler und Abgeordneter der EU, zunächst zu ihrem Halt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil.
»Blaue Frau« erzählt aufwühlend vom Ringen um persönliche Integrität einer jungen Frau, unterwegs zwischen Tschechien und Finnland, Estland und Deutschland. In ihren Erfahrungen spiegeln sich auch die jüngsten Machtverhältnisse zwischen Ost- und Westeuropa.
Blaue Frau
Adina wuchs als letzter Teenager ihres Dorfs im tschechischen Riesengebirge auf. Bei einem Sprachkurs in Berlin lernt sie die Fotografin Rickie kennen, die ihr ein Praktikum in einem neu entstehenden Kulturhaus in der Uckermark vermittelt. Nach einem sexuellen Übergriff durch einen westdeutschen Kulturpolitiker strandet Adina nach einer Irrfahrt durch halb Europa in Helsinki. Dort wird Leonides, ein estnischer Politikwissenschaftler und Abgeordneter der EU, zunächst zu ihrem Halt. Während er sich für die Menschenrechte stark macht, sucht Adina einen Ausweg aus dem inneren Exil.
»Blaue Frau« erzählt aufwühlend vom Ringen um persönliche Integrität einer jungen Frau, unterwegs zwischen Tschechien und Finnland, Estland und Deutschland. In ihren Erfahrungen spiegeln sich auch die jüngsten Machtverhältnisse zwischen Ost- und Westeuropa.
Blaue Frau
Jede Nacht sind die Autos zu hören. Das Rauschen der Autos auf den dreispurigen Straßen und das Rascheln der Blätter am Vogelbeerbaum. Das sind die Geräusche. Sie dringen durch das Fenster herein, das einen Spaltbreit geöffnet ist. Das Meer hört man nicht. Die Ostsee, die im Süden liegt, jenseits der Plattenbauten, in einer Bucht mit verschilften Ufern, die im Winter schnell zufrieren wird. Peitschenlampen säumen die Wege. Nachts fällt ihr bleiches Licht auf den Bordstein und auf den Balkon der kleinen Wohnung, der zur Straße zeigt. Die metallenen Lampenschirme schwanken im Wind. Das Schlafzimmer zeigt zum Hof, wo es einen Spielplatz gibt, einen Verschlag für die Fahrräder und den Vogelbeerbaum. Die Wände der Wohnung sind weiß und leer bis auf den Spiegel im Flur. In der Küche hängen zwei Postkarten über der Spüle. Auf der einen Karte fahren gelbe Taxis durch eine Straßenschlucht in New York. Auf der anderen, einer Schwarzweißaufnahme, sitzen zwei Frauen in einem Pariser Straßencafé. Sie tragen Glockenhüte aus den zwanziger Jahren des letzten Jahrhunderts und elegante Röcke. Das sind die Bilder. Die Blumentöpfe im Metallregal auf dem Balkon sind unbenutzt. Spinnweben haben sich dort verbreitet. Die Spinnen leben noch. Es ist September. Am Horizont, wo Lagerhallen und ein riesiger Sendemast die Reihen der Plattenbauten begrenzen, türmen sich Wolken-berge auf. Der Sendemast ist der einzige Orientierungspunkt in den identischen Straßen.
Niemand weiß, wo sie ist. Die Wanduhr zeigt halb drei. Das silberne Zifferblatt stellt den Weltatlas dar. Einen Sekundenzeiger gibt es nicht, nur ein kleines rotes Flugzeug, das die silberne Welt umrundet. Jede Weltumrundung dauert bloß eine Minute, und doch sieht es langsam, fast gemächlich aus. Ein Schatten fliegt unter dem Flugzeug mit und ist ihm manchmal ein kleines Stück voraus, je nachdem, wie der Lichteinfall ihn auf die glänzende Erde wirft. Sie könnte überall sein. Nina. Sala. Adina.
In der Küche gibt es ein paar Töpfe, einen Wasserkocher und eine fleckige Espressokanne. Die Kanne fiept, wenn unter Druck Wasserdampf aus dem Ventil am Kessel tritt. Auf den Tassen im Schrank steht in Großbuchstaben IKEA. Die Wohnung sieht nach einer echten Wohnung aus, nach einem Menschen. Ein paar Bücher sind da, Kerzenständer, Hochglanzmagazine übers Kochen und Reisen. Im Flur liegt ein abgewetzter Läufer. Walkingstöcke stehen an der Garderobe. Das sind die Gegenstände. Sie stellt die Walkingstöcke in den Schrank im Flur. Aus dem Bad ist einlaufendes Wasser zu hören. Aus dem Treppenhaus dringt kein Geräusch. Die Wohnungstür ist abgeschlossen. Die Griffe an den Fenstern sind fest verschraubt. Nur ein schmales Winterfenster lässt sich einen Spalt weit öffnen. Der Spalt ist nicht groß genug, um den Kopf hinauszustrecken. Das ist ihr recht, obwohl im Moment die Sonne scheint und die Wohnung sich aufheizt.