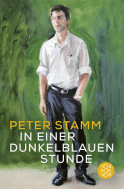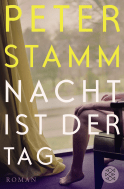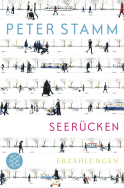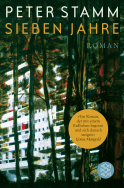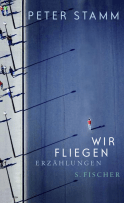Laudatio auf Peter Stamm zum Friedrich-Hölderlin-Preis 2014
Von Michael Hofmann. Michael Hofmann, geboren 1957 in Freiburg, ist englischer Lyriker, Übersetzer und Literaturwissenschaftler
Herr Oberbürgermeister, Hölderlin-Preis-Jury, sehr geehrte Bad Homburgerinnen und Bad Homburger, Geist von Friedrich Hölderlin, lieber Autor und Zugehörige!
Was das hier auch wird, noch nie hab ich etwas Vergleichbares gemacht. Etwas, das, wenn es mir halbwegs gelingen sollte, uns alle zum Erröten bringen müsste: Sie, den Gegenstand meiner Ausführungen, und nicht zuletzt mich selbst. Eine Festrede? Ein Loblied? Ein Hochgesang? Mir fällt es schwer genug, mit mehr als einem Menschen auf einmal eine Unterhaltung zu führen. Und dann auch noch auf Deutsch!
Als Formen, die mir einigermaßen vertraut sind, da wären Rezensionen in Zeitschriften, gelegentliche Voten für Verlage und Gedichte; in der entfernten Vergangenheit auch noch ein, zwei Interviews, aber schon vor zwanzig Jahren. Dieses hier verbindet Elemente von allen, ist aber mit keiner identisch. Ich beschreibe hier kein Buch, stelle mich hinter kein Manuskript, singe kein Hochlied auf eine Person oder eine Sache (»preisen, das ist’s!«, wie der Kollege Rilke mal sagte), ich stelle hier keine Fragen, beschreibe keine Begegnung. Und doch sind Aspekte von allem hier enthalten.
Ich stehe vor Ihnen als Peter Stamms englischer Übersetzer, wobei er auch mein einzig und alleiniger lebender Autor ist (ich habe mich auf alte Bücher von toten Leuten spezialisiert, sogenannten Klassikern: Benn, Kafka, Roth, Koeppen). Peter ist mein Stammbein in der Jetztzeit. Von Peter hab ich alle neun Bücher übersetzt – fünf Romane, vier Bände mit Kurzgeschichten – ins Englische, oder vielmehr zuerst ins Englische und dann ins Amerikanische. (Womit ich, wie mir allzu oft passiert, gleich zwei Sachen auf einmal sagen will: dass ich das erst ins Englische übertrug für einen britischen Verlag, und die acht darauffolgenden Bücher für einen amerikanischen ins Amerikanische; wobei meine Versuche allesamt ziemlich im Englischen verhaftet blieben, und dann mit Hilfe von typisch beflissenen amerikanischen Lektoren ins passabel Amerikanische befördert wurden.)
Neun Originale also, sieben Übersetzungen. Nicht wegen der gelegentlich beschworenen größeren Knappheit und Dichte und Kurzangebundenheit der englischen Sprache, sondern weil man aus vier Kurzgeschichtenbänden dort einfach zwei gemacht hat. Peter Stamm, will sagen, die Stammʼsche Prosa, ist Teil meines Lebens seit Agnes 1998 bis hin zu All Days Are Night, das in diesem November erscheint. Ich hoffe auf viele weitere Titel und Seiten.
Wenn ich sie alle vor mir aufstapele, so denk ich: Das ist ja ein Werk (was beileibe nicht der Fall ist mit x-beliebigen sieben – oder neun – Büchern von den meisten Gegenwartsautoren). Das hier, wie es im Englischen heißt, stacks up, summiert sich, stellt was dar. Es hat Konstanz und Variationen, Schlichtheit und Ernst. Es ist deutlich erkennbar, vielleicht schon unverwechselbar, in Stimme, Stil und Erfahrungsgebiet. Es ist sowohl Werk und eigene Welt. So, wie man in England gerne von Greeneland spricht – nicht Grönland, sondern die fiktionale Welt des Graham Greene. Stammland. Bestimmt auch irgendwo im kalten Norden angesiedelt. Mir fällt in Peters Alter kein Autor ein, der ebenfalls von sich behaupten könnte, dass er es so zu Welt und Werk gebracht hätte.
Es wird wohl einige unter Ihnen geben, die wissen, wovon ich rede, und die mir recht geben werden. Spätestens, wenn Sie sich das nächste Buch (oder Ihr erstes) von Peter vornehmen, dann wird es Ihnen durch den Kopf gehen: So, also wen haben wir hier, worum geht es diesmal. Aber Sie werden mit ziemlich genauen Vorstellungen kommen: eine brenzlige Situation, ein knapp behandelt und gut eingesetzter Hintergrund, eine Krise, ein paar nicht gerade heroische, vielleicht sogar besonders unglückliche Figuren, ein Schluss, der nicht gerade räsoniert, aber dem Leser wenigstens nicht alle Hoffnung nimmt.
Hier ist zum Beispiel der Schlusssatz des Romans Sieben Jahre. Alex, Held plus Antiheld in einer Figur, befindet sich in einem Flughafen. Sein Leben ist vollkommen aus den Fugen geraten, er hat wirklich alles verloren, aber trotzdem oder vielleicht gerade deswegen, ist ihm fast, als würde er fliegen: »Ich lehnte mich mit dem Rücken an das etwas nach außen geneigte Glas und hob den Kopf und sah über den Himmel, der mir auf fast absurde Weise schön zu sein schien.« Vielleicht fällt Ihnen dabei ein anderer Satz im Roman ein, den Alex zitiert – Sie wissen, er ist Architekt – dass man einen Bau nicht wirklich beurteilen kann, bis er zerstört worden ist oder in Ruinen liegt. Alex ist einer, der sich jetzt kein Haus mehr baut. Er hat dem vide, dem néant nachgegeben. Man kann Peter Stamm als Existentialisten der dritten Generation verstehen.
Eine etwas peinliche Beichte. Es kommt mir vor, als hätte ich mir nie besonders Gedanken über Peters Bücher gemacht. Das ist in unserer Arbeitsteilung nicht drin, als Autor und Übersetzer. Ich bin kein Designer, ich nähe. Ich muss keine Meinung von mir geben, nicht nach meiner anfänglichen und immer wieder freudig gegebenen, prinzipiellen Zusage. Ich stehe nicht – in unserer normalen Praxis – als Kritiker da, bloß als Peters Übersetzer. Ich sehe die Bücher, nachdem sie gedruckt worden sind, nicht vorher. Ich habe keinen Einfluss auf sie, muss auch keine Meinung haben, ich muss sie nur ins Englische schreiben. Ich habe dem Entwerfer gegenüber vollstes Vertrauen.
Ich überlasse ihm die Bücher, er vertraut mir die Sätze an. Obwohl ich den Eindruck habe, dass sich Peter, zu einem ganz ungewöhnlichen Grad für einen Erzähler, besonders viele Gedanken zu den Sätzen macht. (Und manchmal, wenn er seine prompten Antworten auf meine gelegentlichen E-Mails schickt, meist auf Englisch, und aus Kasachstan oder aus Amazonas oder wo immer er sich gerade aufhält, dann komm ich mir erst recht mousy and redundant vor.) Es geht mir halt gut bei ihm.
Eine weitere Beichte: mein Lieblingssatz aus dem noch nicht erschienen All Days Are Night: »I’ve got my car in the car park, said Gillian.« »Mein Wagen steht im Parkhaus, sagte Gillian.« Das Englisch ist vielleicht noch einen Tuck knapper and elendiger als das Original. Vielleicht muss man Dichter sein, um so einen Satz zu lieben. Alles steht zweimal da, I und my, car und car park. Das Wichtige darin ist die Geste, das implizite Angebot, und dann die herrlich dumpfe Sprache, in der es vorgebracht wird. Für mich kam es darauf an, Peters sophistication beizubehalten in einer Sprache, die einfacher sein soll als Deutsch.
Ich fürchte, ich stehe zu nahe daran. Ich bin zu ausschließlich mit irgendwelchen englischen Kniffligkeiten oder Problematiken beschäftigt, als dass meine Erfahrungen für Sie interessant wären. Ich bin wie einer, der eine Reise unternommen hat, in ein durchaus interessantes Gebiet, aber mit einer Lupe vorm Gesicht. Eine Subspezies Einhorn. Ich weiß Ihnen wirklich nicht zu sagen, was ich alles gesehen habe. Meine Schwierigkeiten mit deutschen Kommata (dieser Automatismus, diese Ausdrucksarmut, so ganz anders als im Englischen, wo Interpunktion eine vorwiegend persönliche Angelegenheit ist!), oder die direkte Rede ohne Gänsefüßchen. Einmal hab ich über Präpositionen nachgedacht, wie ihre gezielte Anhäufung und Kombinierung im Englischen Schmerz zum Ausdruck bringen könnte. Über solche Sachen denke ich nach. Und vielleicht reicht das auch als Fazit: Schmerz, das Hinnehmen und Nichtwahrhaben von Schmerz, das ist es doch in hohem Maße, worum es in diesen Stammʼschen Büchern geht.
Was ich absolut nicht vermag, ist, Ihnen ein Bild von Peters Welt zu entwerfen, noch weniger ein Porträt von ihm selbst. Ein kleiner Abstecher ins Internet wird Sie Sachen über Peter in Erfahrung bringen lassen, die ich eventuell mutmaßte, aber nicht wissen konnte, und auch nicht wissen muss. Er kocht, er geht spazieren, er schwimmt und gärtnet gerne. Ich freue mich für ihn, finde aber, das steht alles nicht in den Büchern. Stamm weist sich nicht mit seinen Erzählungen aus, es sind Romane mit erfundenen oder beobachteten Figuren, nicht seine carte d’identité. Er macht sein Leben nicht zu Romanen, und macht die Romane nicht aus seinem Herzblut. Ich glaube überhaupt, dass wenig Autobiographisches in den Büchern zu finden ist. Das eine Mal, als ich einen Kommentar von Stamm für die New York Times übersetzte, habe ich mehr direkt über ihn erfahren als in sieben Büchern. Oder neun Büchern, wie man’s nimmt.
Wir haben, wenn ich es so sagen darf, eine sehr herzliche und völlig professionelle Beziehung. Ich bewundere seine Bücher, und er ist mit meinen Übersetzungen zufrieden. Wir sehen uns alle zwei, drei Jahre, in London, in Frankfurt, in New York, und dann reden wir ein bisschen. Ich bin alles andere als neugierig, er selbst ist angenehm diskret. Später in diesem Jahr sind wir zusammen nach Vermont eingeladen, vielleicht kommt es dann zu einem ersten längeren Gespräch übers Übersetzen und Übersetztwerden. Es würde mich freuen, muss aber auch nicht sein.
Nichts gegen Agnes oder Ungefähre Landschaft, aber irgendwann bekam ich das Gefühl, dass sich Peter von Buch zu Buch steigerte, und ich glaube, das war nicht ganz falsch. Die Katastrophen sind irgendwie flotter und mehr businesslike, und dagegen umso ärmlicher das Sichwinden der Figuren, wie sie versuchen, ihrer Lage zu entkommen oder sie gar zu verbessern. Vielleicht ist es auch die souveräne Art und Weise, wie in den Büchern nach hinten und vorne erzählt wird, mit Unterbrechungen. Oder vielleicht ist das alles Quatsch, und ich oder Sie gehen einfach besser mit ihnen um? Dieses Offene, das nicht Schlichtheit ist. Diese Einfachheit, die alles andere als simpel ist.
Immer wieder gibt es Stellen in den Büchern (vom Anfang ganz abgesehen), wo man nicht weiß, wo man ist; und diese Augenblicke, für jemanden wie mich, dessen Lieblingsminuten in Filmen fast immer die ersten fünf sind, bevor sich irgendeine Handlung oder Person etabliert hat, sind ein Genuss. Es ist, wie wenn man eine Plattenspielernadel aufnimmt und sie unvermittelt zwei oder drei Einspielungen weiter verlegt. (Auf diese hatte man gerade keine Lust.) Es klingt vielleicht komisch back-handed (das will es nicht sein), aber die Lücken in den Romanen tragen sehr viel bei. Und für einen Übersetzer haben sie auch noch den Vorteil, dass sie sich leichter reproduzieren lassen.
Peter war immer »good at the world« und hat sich nur verbessert. (Ich bin es nie gewesen, und hab mich nur verschlimmert.) Er schaltet schnell und macht Gebrauch von seinem Wissen. Er kennt sich überall aus, im Dorf wie in der Großstadt. Er weiß, dass der Fleischer dicht gemacht hat, und dass jetzt Dessous verkauft werden im alten Fleischladen. Er weiß, dass die Welt zunehmend vermischt und verwischt wird, dass man jetzt überall wohnt, und gar nicht daran denkt, an seinem Ort zu bleiben; er kennt die Rastlosigkeit, die Reiserei, all die Beschleunigungsapparate, sozusagen die »quick fixtures« des zeitgenössischen Lebens, Autos und Computer und Telefone und so weiter und so fort. The sameness of elsewhere, könnte man sagen. Peter merkt, wie sich das Leben ändert, ein Muster bekommt und verwirft, er bietet mehr als die ewig rückgewandte Melancholie des Dichters, er ist wie ein Ethnograph.
Ja, er hat einen Buchhalter als Vater (las ich online), und studierte selber Buchhaltung, bevor er sich fürs Bücherschreiben entschied, aber da ist mehr im Spiel. Mehr auch, als dass Peter eine Zeitlang Psychologie and Psychopathologie studiert hat, vermutlich so, wie er viel in der Welt herumreist. Wie ist der und der? Was ist das hier für ein Ort? Es gehört einfach zu seiner Ausbildung als ungewöhnlich gerundeter und ernster und selbstbewusster Erzähler.
Er weiß also viel darüber, wie man lebt, und wo und mit was für Perspektiven. Man muss sich nur die Figuren in den Romanen vorknöpfen: ein researcher in Chicago, eine Zollinspektorin und alleinerziehende Mutter in Nord-Norwegen, ein Schweizer Lehrer in Paris, ein Münchner Architekt, eine gescheiterte Schauspielerin, die eine Kultursendung im Fernsehen moderiert. Und das kann man in den Erzählungen noch vervielfältigen: ein nicht mehr ganz junges Paar in Italien auf Urlaub, ein organischer Gemüsegärtner am Bodensee, ein auditor für eine große internationale Firma, gerade in Lettland unterwegs. Man bekommt endlose viele Begebenheiten/Einzelheiten bei Peter Stamm – »the envelope of circumstance« lautet die Formulierung bei Henry James – und wenig Reflexion, wenig Innenleben. Innenleben, denkt man dann, ist eine Art Sekret. Es wird nur dann produziert – in Peters Figuren und in den meisten von uns –, wenn die Existenz schiefgeht und uns eine Krankheit, einen Ehekrach, eine Enttäuschung oder Erschütterung beschert.
Neue Metapher: Es gibt Eisberge, aber anscheinend nur, wenn wir in sie reinfahren. Jene Intensitätsmomente in unserem Leben, wo uns nichts anderes übrigbleibt, als symbolisch zu handeln. Die hat Peter entdeckt und darüber schreibt er.
Ich könnte ganze Seiten damit füllen – und hab auch damit begonnen – mit den Schauplätzen der Romane und Erzählungen und den Beschäftigungen der Figuren. Es gibt immer so viel von Peter zu lernen. So viele Orte, die man nicht kennt, so viele Okkupationen, an die man nie einen Gedanken verlor. Ich glaube, bis auf eine einzige Ausnahme, die Geschichte In die Felder muss man gehen … über den französichen Maler Camille Corot, handeln alle Erzählungen von Heute und spielen in der Gegenwart.
Marken von schnieken Küchen und Badezimmern. Wie geht man mit einem Mobile um (ich selber habe keins). Das kentaurische Zusammenwachsen von Mann und Fahrzeug. Wie ein Architekt denkt, oder ein Geschäftsmann, ein Künstler, ein Zollbeamter, ein Lehrer. Wie ein Open Air sich anfühlen mag, oder eine Höhle – a rave or a cave. Wie es ist, wenn sich jemand gehenlässt. Wie Kinder erwachsen werden und das Haus verlassen; wie Eltern altern und sterben; wie Pfarrer ihren Glauben verlieren, um ihn dann an einem völlig ungeeigneten Ort wiederzufinden; Videoverkäufer, die ein wenig schrullig werden; ein Künstler, der nichts mehr kann, und vielleicht nie etwas konnte; Menschen, die zu gewissen Momenten ihre cities of the plain verlassen für die Bergdörfer, in denen sie manchmal aufgewachsen sind. Männer und Frauen, Kinder, alte Leute, Paare, Alleinlebende, Geschiedene, Ledige, Witwer und Witwen. Erzähler müssen sich besser in der Wirklichkeit auskennen – in der gedeuteten Welt, heißt es bei Rilke – und Peter ist einer der Allerbesten.
Peter schafft ein Knäuel von Umständen in und für jedes einzelne Buch. Jedes hat sein eigenes Bild, seine eigene Perspektive, seine eigene Bedrohung. Wenn man so will, ist jedes Buch von Peter eine Art Gesamtkunstwerk. Jedes ist polygonal. Als Leser wird man sich vielleicht an den diabetischen Mann erinnern, die Frau liegt schwerkrank im Spital, wie er mit seinem Koffer – die Erzählung heißt Der Koffer, Tschechow hätte sie auch nicht anders genannt – in eine fremde Stadt geht, bis an das Ende von einem Pier, und dort sieht er eine Sandbank, auf der sich ein entsorgter Weihnachtsbaum verfangen hat. Aber man könnte sich ebenso an Block Island erinnern (so zwischen Connecticut und Long Island, schwant mir), oder ein etwas unheimliches, sonst nicht näher festgelegtes Hotel außer Saison. Irgendwas in diesen Erzählungen bleibt immer hängen, so wie der verrottete Weihnachtsbaum hängenbleibt. Sie wollen nicht geschluckt werden.
In Agnes besteht das Knäuel – wenn man so will – aus dem Rechercheur (ein Experte also), Chicago, Pullman, dem Erfinder der Luxus-Eisenbahnwaggons und der utopischen Arbeitersiedlungen, den damals brandneuen oder brühwarmen computer screensavers, dem Seurat Gemälde La Grande Jatte, das in Chicago hängt. Wie sieht Glück aus? Besteht das Leben aus lauter kleinen Pünktchen, oder ist das eher das Glück? Was ist Luxus? Was ist Expertentum? Was ist eine Geschichte? Gibt es so etwas wie Wirklichkeit?
In Ungefähre Landschaft ist es Kathrines fast panische Reise nach Süden, nach Paris, der sogenannten ville de lumiere, die sie, glaub ich, dann doch nur im Dunkeln erlebt. Dementsprechend ihre Unfähigkeit, vor allem Männer zu beurteilen. Sie reist Hunderte von Meilen, im Grunde um irgendwelche Fremden aufzusuchen, und unterwegs begegnet sie anderen Fremden. Ihre Flucht in die europäische Dunkelheit.
Nun, Kathrine kommt nach Paris. Das wunderbare, fabelhafte Paris; sie macht im Grunde ihre Grand Tour. Aber alles, was sie dort sieht, was ihr dort begegnet, ist ihr aus Norwegen bereits bekannt. Und dann sagt sie zum Schluss: »Nichts war mehr, wo es sein sollte.« Es singt einer in der Metro, aber das ist auch nur ein Russe, wie ihr Freund, der Schiffskapitän. Der erste Halt, an dem sie aussteigt, heißt ausgerechnet Poissonniere, fischiger Ort. Es gibt ein Shopping-Center, bloß längst nicht so toll, wie sie es sich ausgemalt hatte. Es gibt ein Parfum, aber das heißt Poison, und das ist doch dasselbe wie Fisch, und über Fische weiß sie ja wirklich alles. Schließlich sieht sie die Glaskuppel, von der man ihr vorgeschwärmt hatte. Und da heißt es: »Sie war schön, aber Kathrine hatte sie sich schöner und größer vorgestellt.« Dann geht sie auf die Straße. »Ein Mann ging vorbei, der ein Kostüm trug wie eine Orange«, so heißt es lapidar. Wir befinden uns mitten in der Zauberwelt.
Oder in An einem Tag wie diesem, ein weiterer typischer Peter-Titel, sauber, blank, ein bisschen nordisch, fast abstrakt. Andreas gibt sich mit mehreren Frauen ab, dann, anscheinend todkrank, unternimmt er eine seltsam tiefempfundene Reise (das Automobil ist ja sowieso das Hauptorgan, vor allem der männlichen Ausdrucksfähigkeit), zurück in die Berge, und dann raus an den Atlantik. Ist sein Ziel Leben oder Tod?
Das sind alles absolute Angebote, denk ich, und als Leser hat man keine andere Wahl, als sie anzunehmen. Es haftet an ihnen nichts Falsches, es ist nichts falsch Gedachtes, Unpassendes, Unglaubwürdiges, Hergeholtes, Reingewürgtes. Die Figur verspürt ein Defizit im Lebensgefühl. Oder es kann auch ein Überschuss sein. Mag sein, dass sie sich entitled fühlt, oder bezwungen, oder schlicht neugierig. Oft versteht sie nicht einmal, was sie bewegt. Der Architekt Alex in Sieben Jahre fühlt sich von der polnischen Iwona angezogen, aber aus keinem Grund, den er sich selbst oder anderen nennen könnte. Es gibt keine ausreichende oder gar dargebotene Motivation. Es gibt eine Anziehung, aber das Seil bekommen wir nicht zu sehen. Die Rädchen. Wir kriegen nur die äußeren Tatsachen, die Handlung, das Benehmen, hässlich, störend, befangen. Sogar monströs. Nichts wäre einfacher für den Autor, als uns irgendeine Begründung vor die Füße zu werfen. Peter tut es nicht. So was gibt’s. Wir lesen es und glauben es.
Und dann sind es immer Geschichten. Wie knapp oder fragmentarisch sie sein mögen, oder sogar flüchtig wie die zwei zauberhaften Seiten Coney Island, wie einer auf einem Felsen sitzt und raucht an dem spiegelglatten Atlantik; und zwei hispanische Mädchen kommen auf ihn zu, und eine will sein Bild machen (that’s happiness, you think), alles ist eine Geschichte. »Agnes ist tot. Eine Geschichte hat sie getötet.« So hieß schon der Anfang. Wenn Andreas in An einem Tag wie diesem es vermeidet, den Umschlag zu öffnen, in dem seine Geschichte vermutlich gedruckt steht, wird das ihren Ausgang ändern? Wird es ihn retten? In Nacht ist der Tag geht es um die Frage: Wessen Geschichte wird hier überhaupt erzählt? Gehört sie Gillian oder Hubert, dem Kunstmaler auf dem zweiten Bildungsweg, der plötzlich in der zweiten Hälfte des Romans das Steuer an sich reißt? Wer hat Kraft, die eigene Geschichte zu schreiben oder umzuschreiben, sie oder er oder beide? Und dann zusammen oder getrennt?
Die Oden des Properz beginnen: »sunt aliquid manes«, ja, wirklich, es gibt so was wie Gespenster. Peter wiederum würde sagen: »sunt aliquid historiae«. Es gibt so was wie Geschichten. Etwas, das nicht wir sind, das wir nicht definieren oder kontrollieren können, und das uns wie einen Stuntman in einem Wagen an die Wand fährt – ja, so wie der arme Henry in der Geschichte Die brennende Wand.
Man lernt in Peters Büchern, wie schwer es ist, sein Leben hinter sich zu lassen, oder die Richtung zu wechseln. Wenn es dem jungen Lehrer in der Geschichte Die Verletzung aufgeht, dass er das kecke Dorfmädchen Luzia, mit der gelegentlich verrückten Mutter nicht bekommt, und er selber ein wenig verrückt wird, erinnert mich das an etwas, das ein Westernregisseur mal gesagt hat: Er dachte, er würde zeigen, wie jemand auf ein Pferd über den Horizont reitet. Ist ja ein Western. Denkt man. Dann bekam er aber heraus, dass es richtig lange dauert. Sieben Minuten, zehn Minuten, die genaue Zeitangabe weiß ich nicht mehr. Aber auf jeden Fall nicht zu bezahlen. In Peters Erzählung nimmt der junge Mann den Fernseher und stellt ihn raus auf die Straße. »Nimm mich mit.« Keiner nimmt ihn. Er verbrennt die Aufsätze von seinen Schülern: was die kleinen Materialisten sich zu Weihnachten wünschen. Er befindet sich in der Welt der symbolischen, zauberhaften Handlung.
Übrigens, ist es Ihnen mal aufgefallen, wie viele von Stamms Geschichten an roten Kalendertagen stattfinden: Neujahr in Nacht ist der Tag, der erste Weihnachtstag in der New Yorker Kurzgeschichte In den Außenbezirken, Siebenschläfer in der so genannten Bauerngeschichte; mindestens off-season in Männer und Knaben, oder der bevorstehende Sommerurlaub für die Klavierlehrerin in Der letzte Romantiker. Peters Kalender ist genauso markiert und konturiert und farbengetupft wie seine physischen Hintergründe in den Erzählungen. Das Wetter spielt ebenfalls eine große Rolle. Die Bücher bekommen jedes ihr eigenes Wetter wie ihre Figuren und Situationen und Ortschaften. Ein Vater irgendwo in einer Geschichte füllt Tag für Tag Einzelheiten über das Wetter aus, über Jahre hindurch. Ist das ein Leben? Ja, allenfalls im Futurperfekt.
Dann – bei der Verletzung wieder – gibt der Nachwuchslehrer einen pädagogischen Text in die Flammen. »Ich war überrascht, wie viel Kraft es brauchte, die Bücher zu zerreißen.« Er kramt Notizen und Papiere hervor, verbrennt sie. Er schreibt Luzia einen Brief und verbrennt ihn. Dann fängt er erst richtig an. Er verbrennt alles Flammbare, das ihm unter die Finger kommt, Papier, Pappkartons, ein paar alte Skier aus Holz, einen alten Schemel. Als nächstes kommen die guten Möbel dran, und da steht es wieder, »ich hatte nicht geahnt, wie viel Arbeit es machte, etwas zu zerstören«. Im Film ist es leichter. Er kauft sich eine neue Axt. Er zersägt das Bett von seinen Großeltern und verbrennt es. »Die Zerstörung hatte Gerüche«,ein sehr typischer Stamm-Satz, ein erstauntes Konstatieren. Die Tatsache und der Alarm darüber fallen zusammen ins Haus. Er fährt den alten Volvo irgendwohin, und lässt ihn einfach stehen. Er bricht die Klasse ab, rennt zum Bahnhof. Er hat Angst, dass man ihn noch zurückhält. »Erst als der Zug einen weiten Bogen machte und in den Tunnel fuhr, wurde ich ruhiger.« »Ruhig« ist so ein Stamm-Wort, er könnte es glatt patentieren.
Oder das Gegenteil in der Erzählung Die ganze Nacht. Wie ein junger Mann in New York auf seine Freundin wartet, die vermutlich aus Europa angeflogen kommt. Er will ihr etwas sagen, vielleicht will er mit ihr Schluss machen. Das Vage, das Ungenaue, ist in Stamms Texten genauso prominent wie das Präzise und Unzweifelbare. Es fängt an zu schneien. Ein Riesenschneesturm bahnt sich an. Die Fernsehkanäle sind ganz außer sich. »In den Außenbezirken, hieß es, sei das Chaos noch größer als in der Innenstadt, und von der Küste kamen Meldungen über Hochwasser. Aber die Moderatoren, die man hinausgeschickt hatte und die, dick angezogen, in Mikrophone mit groteskem Windschutz sprachen, waren guter Laune und warfen Schneebälle in die Luft und wurden nur ernst, wenn sie von Sach- oder Personenschäden zu berichten hatten.« Nichts bewegt sich mehr in Manhattan. Die Flughäfen machen dicht. Ihr Flug wird umgelenkt. Nach Boston. Wir bleiben mit ihm, mit seinen symbolischen Handlungen. Er geht raus, um etwas zu essen zu bekommen, im Grunde aber aus Solidarität, aus Entgegenkommen. Er sieht einen Skifahrer. »Über den Times Square lief ein Langläufer.« Es gibt Dinge, die man nicht überlebt, oder die was mit einem machen. Bis sie ankommt, mit dem Zug aus Boston und bis zur Ecke nur in einem Taxi (schickes Mädchen!), hat er vergessen, was er ihr sagen wollte. Er freut sich einfach, sie zu sehen.
So wie es mich freut, Peter zu sehen, und dass er den Hölderlin-Preis bekommt.