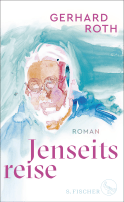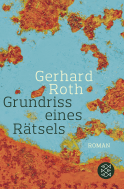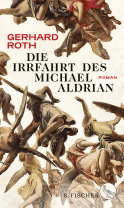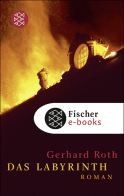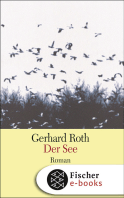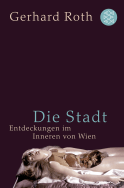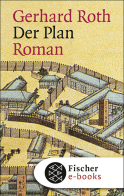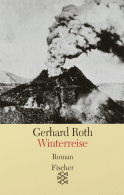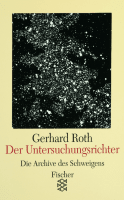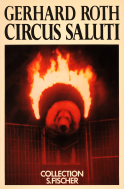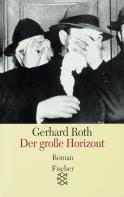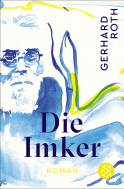
Recherche in Venedig
In diesem Frühjahr erscheint Gerhard Roths neuer Roman »Die Hölle ist leer – die Teufel sind alle hier«. Der Autor Klaus Dermutz hat Roth bei dessen Recherchen in Venedig begleitet und erzählt die Entstehungsgeschichte eines außergewöhnlichen Buchs.

Ein Dutzendmal ist Gerhard Roth bereits in Venedig gewesen, Ende April 2016 reist er mit seiner Frau Senta ein weiteres Mal in die Lagunenstadt. Roth arbeitet an einer Venedig-Trilogie und sucht Schauplätze für die neuen Romane. Roth kam als Jugendlicher zum ersten Mal nach Venedig, Roths Eltern waren mit ihren drei Söhnen Paul, Helmut und Gerhard Mitte der 1950er Jahre nach Italien gereist. Als Reiseziel hatte der Vater Grado ausgewählt, für einen Tag fuhren die Roths nach Venedig. Der Markusplatz bleibt Roth, wie er in der Autobiographie »Das Alphabet der Zeit« (2007) schreibt, als riesiges Kirchenschiff in Erinnerung, der hitzeblaue Himmel erscheint ihm wie ein Deckenfresko, der Sinn der goldenen Mosaiken des Markusdoms bleibt ihm verschlossen. Roth öffnet bei seinen zahlreichen späteren Venedig-Aufenthalten nicht nur »das prunkvolle Schätzkästchen«, sondern auch die Türen zu den dahinter liegenden Kerkern. Der ersten abweisenden Begegnung sollten mehrere Venedig-Reisen folgen, die Roth inspirierten und im Laufe der Jahre den Wunsch reifen ließen, eine Venedig-Trilogie zu verfassen. Der erste Band »Die Irrfahrt des Michael Aldrian« (2017) erzählt die Geschichte eines ehemaligen Souffleurs der Wiener Staatsoper, der in Venedig in ein Verbrechen verwickelt wird.
1. Mai 2016
Vor dem Aufbruch hat Roth die Entscheidung getroffen, mit einem Taxi vier Stunden lang auf dem Lido Schauplätze zu suchen. Der Protagonist des entstehenden Romans »Die Hölle ist leer – die Teufel sind alle hier«, der Übersetzer Lanz, lebt seit zwei Jahren auf der Insel in der Lagune von Venedig. Roth sucht nach Verstecken: Ein umgekipptes, mit einer Plane zugedecktes Boot könnte es sein, auch ein alter Transporter oder ein heruntergekommenes Gelände, dessen Zufahrtstor versperrt ist.
Vor der ersten Recherchetour hat Roth die Straßen, Wege und Kanäle auf dem Stadtplan genauestens studiert. Wir werden, sagt Roth, bis zum Leuchtturm fahren, immer wieder anhalten, sofern ein interessantes Gebäude auftaucht. Er sucht zuerst eine Werft für Boote. Auf der Rückfahrt würden wir die berühmten Hotels ansehen, das 1907 errichtete Excelsior, auf dessen Terrassen 1932 die ersten Filmfestspiele stattfanden, das Grand Hotel des Bains, in dem Thomas Mann sich zur Novelle »Tod in Venedig« anregen ließ und das 2010 geschlossen wurde, sowie das ebenfalls 1907 eröffnete Hungaria Palace Hotel, ein Jugendstil-Gebäude. Den katholischen Gottesacker und die beiden jüdischen Friedhöfe, den alten und den neuen, klammere er bei dieser Erkundung aus, er habe diese Friedhöfe bereits früher besucht.
Von den speziellen Erfordernissen dieser Recherche geht Roth zu einer allgemeinen Darlegung seiner Arbeit über. Wenn er für ein Buch noch keinen Plan habe, setze sich die spätere Geschichte puzzleartig erst durch die Eindrücke zusammen, die er auf der Reise erhalte. Es gebe drei Methoden, die er in seiner 45-jährigen Arbeit als Schriftsteller angewandt habe: Bei der ersten arbeite er frei aus dem Kopf – er habe sehr viele Bücher aus dem Kopf geschrieben. Bei der zweiten Methode fahre er an den Ort, an dem der Roman spiele und mache Notizen, er setze sich dem Zufall aus, lasse ihn zu seinem Recht kommen. Schon während der Reise entstünden von selbst die ersten Ideen und Fragmente. Er mache ausführliche Fotorecherchen und handschriftliche Notizen, lasse sich von Details anregen, manchmal würden ihm winzige Wahrnehmungen helfen, beispielsweise Blüten, die ein Wind ins Wasser einer Anlegestelle geweht habe. Mit diesen Wahrnehmungen komme die Handlung ins Schaukeln. Bei der dritten Methode greife er auf das Material zurück, das oft jahrelang in einer Schachtel gelegen habe, er grabe Notizbücher und Fotografien aus und suche in ihnen, was er für die Arbeit brauche. Mitunter dauere es Jahre, bis er Aufzeichnungen wieder hervorhole und sich durch die wie aus einer fernen Zeit stammenden Notizen eine Schleuse öffne. – Es ist ein ähnliches Bild, das Julien Green einmal fürs Schreiben verwendet hat, statt des Öffnens einer Schleuse sprach Green vom Öffnen der Falltür, wenn er mit dem Schreiben beginne.
Auf dem Lido sucht Roth immer wieder das 2003 unter den Protesten der Bevölkerung geschlossene und dem Verfall preisgegebene Ospedale al Mare auf, wo heute Obdachlose eine Bleibe gefunden haben. Der rote Schriftzug »OaMtopia« – Ospedale al Mare Utopia – auf dem in einer Wiese liegenden Betonträger verknüpft Medizin und Meer zu einer Utopie der Genesung – das könne aber auch ironisch gemeint sein, sagt Roth. Der »Gebäudearchäologe« bezieht aus dem stillgelegten Krankenhaus Energien, um den Ausgesetzten und Ausgelieferten nahe sein zu können. Nach der Eröffnung 1933 wurden im Ospedale al Mare, einem Bauwerk des Faschismus, auch arme, an Tuberkulose erkrankte Kinder behandelt. Nicht nur Hydro- und Heliotherapie brachten Heilung. Die erwachsenen Patienten wurden sogar mit Opern erfreut, und für die Kinder wurden Theateraufführungen im eigens für sie erbauten Teatro Marinoni gegeben.
Als wir zur Stazione San Silvestro zurückkehren, meint Roth, Venedig sei für ihn ein Modell der Welt, hier könne man die Geschichte der Menschheit studieren. In Venedig sei alles vereint, Wasser und Schifffahrt, Kunst und Prostitution, Architektur und Verfall, das Licht des Markusdoms und die Finsternis der Kerker, Schönheit und Leid. Diese Stadt habe in ihrer langen Geschichte Dichter und Künstler magisch angezogen, ihn selbst berühre besonders das um 1495 entstandene Gemälde »Zwei venezianische Damen« von Vittore Carpaccio, das im Museo Correr zu sehen ist.
2. Mai 2016
Wieder regnet es am Vormittag. Auf dem Weg zum Vaporetto erwidert Roth auf die Frage, ob er gut geschlafen habe, er habe schrecklich geträumt, die Zeit für die angenehmen Träume sei offenbar endgültig vorbei. Wieder nehmen wir ein Vaporetto, wir fahren zur Chiesa di San Pietro di Castello auf der gleichnamigen Insel im Nordosten von Venedig. Der Regen hat die Stadt beruhigt, es sind kaum Touristen unterwegs, und die Gondolieri müssen warten, bis sie die blauen Planen von den schwarzen Gondeln ziehen können.
In der Chiesa di San Pietro interessiert Roth sich für Pietro Liberis Gemälde »Il Castigo dei serpenti« von 1660. Die Verdammung der Schlangen beschwört eine Welt herauf, in der die Schlangen sich darangemacht haben, die Menschen auszurotten. Am Ende eines kahlen Baumstammes ohne Zweige und Blätter ist eine Schlange aufgepflanzt, als würde sie bereits die Weltherrschaft übernommen haben. Aber ein alter Mann streckt Arm und Hand aus und gebietet den Schlangen Einhalt. In letzter Sekunde wird das Unheil noch abgewendet, die Menschen liegen schon vom Kampf entkräftet am Boden.
3. Mai 2016
Auf der Fahrt zum Friedhof San Michele verfolgt Roth vom Vaporetto aus, wie die einzelnen Körperteile von Joseph Klibanskys weißem Astronauten auf Schiffe gehoben und abtransportiert werden. Auf einem der Lastkähne sind nur der große Arm und der weiße Stuhl zu sehen, an dessen Lehne sich der frei schwebende Astronaut festgehalten hatte. Als Roth das Schiff mit dem überdimensional großen Rumpf an der Kaimauer erblickt, meint er, es sei der »Sarg des Astronauten«, der weiße Astronaut breche nun über das Wasser zur letzten Reise auf. Gut möglich, dass der auf die Erde zurückgekehrte und auf ein Transportschiff geladene Astronaut in seiner Venedig-Trilogie als Abgesandter intergalaktischer Räume erscheine.
Während der Überfahrt von Fondamenta Nuove nach San Michele fotografiert Roth die Skulptur »The Barque of Dante« des 1945 in Tiflis geborenen Künstlers Georgy Frangulyan. 2007 wurde sie auf der 52. Biennale gezeigt und ist seitdem in der Lagune dem Wellenschlag ausgesetzt. Die Bronzeskulptur zeigt Dante und Vergil am Beginn ihrer Reise ins Reich der Toten. Mit venezianischen Experten hat Frangulyan der zwei Tonnen schweren Skulptur durch Pfeiler und Pontons eine lose Verankerung gegeben, so dass sie sich mit den Wellen heben und senken kann. Dante wendet den Kopf Vergil zu, der gerade ausgestreckte Arm zeigt in die Gegenrichtung – nach San Michele, der Friedhofsinsel.
Auf der berühmten Friedhofsinsel sucht Roth die Gräber von Ezra Pound und Joseph Brodsky auf. Zum Grab von Ezra Pound scheinen kaum Besucher zu kommen. Es finden sich dort weder Blumen noch Geschenke, der Name des Dichters steht auf einer kleinen, von Blättern überwachsenen Steinplatte. Bei Brodsky Grab haben Besucher ein kleines Wodka-Fässchen, eine russische Nussschnitte, einen Stein mit Fuchsgesicht, einen Kugelschreiber und andere Devotionalien hinterlassen. Roth setzt sich in der Nähe des Brodsky-Grabes auf einen Grabstein und spricht über Pounds Verehrung von Mussolini, seinen Antisemitismus, Rassismus und Antiamerikanismus. Nach dem Krieg wurde Pound im U.S. Army Disciplinary Training Center bei Pisa in einen Käfig gesperrt, Tag und Nacht mit Licht bestrahlt, bevor er nach Amerika gebracht und im St. Elizabeth-Krankenhaus interniert wurde. Zwölf Jahre verbrachte Pound im »Institute for the Criminally Insane« in Washington D.C. und er entkam der Todesstrafe nur dadurch, dass er für geisteskrank erklärt wurde. Ernest Hemingway setzte sich dafür ein, dass Pound aus der Heilanstalt entlassen wurde. Nach Europa zurückgekehrt, besuchte Pound seine Tochter Mary de Rachewiltz und lebte bei ihr und ihrem Mann auf der Brunnenburg in der Nähe von Meran. Als Pound zum ersten Mal wieder nach Venedig reiste, ging er mit dem Faschistengruß von Bord des Schiffes.
Am Ende sagt Roth, die beiden Dichter seien unterwegs ins Jenseits. Auf die Frage, was Pound und Brodsky als Obolus für ihre Charonfahrt unter der Zunge liegen haben, erwidert Roth: Brodsky Wodka und Pound ein Bitterkraut. Geht die letzte Reise ins Elysium, in die Hölle oder ins Nichts? Roth antwortet, das Leben sei ein Geschenk, an ein Leben nach dem Tod glaube er nicht.
Wir kommen auf Theodor Fontanes Roman »Unwiederbringlich« zu sprechen, auf jene Verse, die nach dem Sinn und der Summe unserer Existenz fragen: »Was bleibt vom Erdenfeste,/ Was bleibt uns unvergällt?/ (...) Wer hasst, ist zu bedauern,/ Und mehr noch fast, wer liebt.« Ezra Pound gibt in seinem Canto LXXXI eine andere Antwort als Fontane: »What thou lovest well remains,/ the rest is dross/ What you lov´st well shall not be reft from thee/ What you lov´st well is thy true heritage«. In der Übertragung von Eva Hesse lauten diese Verse: »Was du innig liebst, ist beständig,/ der Rest ist Schlacke. Was du innig liebst, wird dir nicht weggerafft/ Was du innig liebst, ist dein wahres Erbe.«
Roth hält inne und sagt nach einer längeren Pause, Brodsky habe mit »Ufer der Verlorenen« das schönste Venedig-Buch geschrieben. Es beginne damit, dass Brodsky bei der Ankunft in Venedig »ein äußerstes Glückgefühl« befalle, ein Geruch sei in seine Nase gedrungen, der für ihn »immer schon ein Synonym für Glück« gewesen ist, »der Geruch von gefrierendem Seetang«. Roth sagt, Brodsky habe der Arbeit eine große Bedeutung beigemessen, Glück oder Unglück als Begleiterscheinung gesehen. Nach der Rückkehr ins Hotel sucht der Verfasser diese Passage, sie lautet: »Es ist eine Tugend – zu der Überzeugung bin ich vor langer Zeit gekommen –, sich an seinem Gefühlsleben nicht allzu gütlich zu tun. Es gibt immer genug Arbeit, ganz zu schweigen davon, dass es draußen genug Welt gibt. Und schließlich gibt es immer diese Stadt. Solange sie existiert, glaube ich nicht, dass ich – noch übrigens sonst jemand – von einer romantischen Tragödie mesmerisiert oder geblendet werden kann.«
4. Mai 2016
Am Vormittag besuchen wir die Sigmar-Polke-Ausstellung im Palazzo Grassi. Von Polkes Arbeiten, sagt Roth am Beginn des Rundgangs, bekomme er einen Energieschub. Er werde vom Erinnern und Vergessen angezogen, dieses Doppelspiel sei in allen Arbeiten Polkes zu spüren, die Bilder kämen wie aus einer fernen Zeit zu uns und seien einem auf eigentümliche Weise nahe. Auch die abstrakten Arbeiten, auf denen z.B. auf einem blauen Viereck der Rest einer kleinen Pflanze zu sehen ist, zögen ihn an, er selbst zeige in seinen Fotoarbeiten Prozesse von Werden und Vergehen, jene Umgestaltung, die ein Metall bis hin zum Rost durchlaufe, Partikel und Essenzen einer alchemistischen Transformation belebten seine Inspiration.
Roth spürt den Explosionen in Polkes Arbeiten nach, er betrachtet jene Bilder, in denen sich Splitter der Zerstörung über die Leinwand ausgebreitet haben. An manchen Stellen, sagt Roth, könne er sich nicht des Eindrucks erwehren, ein Auge habe sich aus dem Körper gelöst und führe in einer zerstörten Landschaft ein Eigenleben. Roth fühlt sich zu jenen Arbeiten von Polkes hingezogen, die, um einen Begriff von Michel Foucault aufzunehmen, »andere Räume« zeigen: Auf »Jeux d´enfants« (1988) sieht man hinter großen Pflanzen zwei Kinder, eines hält einen vom Körper getrennten Kopf in den Händen. Am Bildrand ist der Rücken einer Person zu erkennen, die die spielenden Kinder betrachtet. Der Tod hat auf die beiden Kinder noch nicht sein Grauen übertragen, der abgetrennte Kopf erscheint wie ein aus dem Totenreich geborgener Gegenstand, der einer behutsamen Handhabe bedarf. Es ist, als hätten die beiden Kinder an dem abgeschiedenen Ort eine neue Welt für sich entdeckt, in der die ältere Generation keine Macht über sie hat.
Den Nachmittag verbringt Roth im Caffè Florian, er taucht in die Atmosphäre eines sonnigen Tages ein, genießt das Vertrauen der Kellner, die unter dem weißen Sakko eine schwarze Weste tragen. Das Caffè Florian war im 19. Jahrhundert ein Treffpunkt der Anhänger von Garibaldi, im Caffè Quadri versammelten sich die Habsburger, die Orchester spielten gegeneinander an, die Streitereien entflammten über den Platz hinweg. Roth zeigt auf den Campanile, dessen Einsturz er in seinem Roman »Grundriss eines Rätsels« beschreibt, und erzählt: »Der Campanile hatte vor dem Einsturz 1902 bereits eine leichte Schiefstellung, doch nicht einmal zu diesem Zeitpunkt hat die Baubehörde das ernst genommen. Erst drei Tage vor dem Zusammenbruch hat ein pensionierter Ingenieur den Turm inspiziert. Als er über die Treppe die Hälfte des Turmes erklommen hatte, sah er im Mauerwerk sehr große Sprünge. Das hat sich wie ein Lauffeuer herumgesprochen, die Leute sind gekommen, um zu sehen, was sich ereignen würde. Am Tag, als der Turm zusammenbrach, gab es auf der Piazza San Marco normalen Kaffeehausbetrieb.«
5. Mai 2016
Eine Unterbrechung, ein Innehalten. Roth sagt, er lege einen Ruhetag ein, der Beginn des Aufenthalts sei gut verlaufen, er habe bereits den Großteil der Recherchen erledigt. Die Technik, meint Roth, biete ihm heute bessere Arbeitsmöglichkeiten, er könne jetzt die Fotos auf dem Display der Kamera betrachten und gleichzeitig Notizen machen. Die Aufnahmen hätten sich früher allerdings stärker in sein Gedächtnis eingeprägt. Schrift und Bild seien zwei verschiedene Schienen gewesen, auf denen er sich durch die Stadt bewegt habe, erst nach der Rückkehr habe er die Fotos entwickeln lassen, und die »erste Begegnung mit den Abzügen« habe manche seiner Notizen in einem neuen Licht erscheinen lassen. Heute vermischten sich Notizen und Aufnahmen, der Austausch zwischen den beiden Formen der Aneignung geschehe schneller, aber manchmal auch flüchtiger.
6. Mai 2016
Auf der Fahrt zur Insel Torcello kommen wir am Arsenal vorbei. In dieser Kriegsschiffwerft, erzählt Roth, seien die Produktionsabläufe so rationalisiert worden, dass 1570 im Krieg gegen die Türken und der anschließenden Seeschlacht von Lepanto innerhalb von zwei Wochen hundert Galeeren gebaut werden konnten, im Kriegsfall sicherte dieser schnelle Nachschub die eigene Überlegenheit. Die rasante Produktion könne man als eine Frühform des Fordismus sehen, ein Schiff nach dem anderen sei »ausgespuckt worden«.
Während das Vaporetto an den rötlichen Ziegelmauern entlang fährt, kommen wir wieder auf Dante Alighieri zu sprechen, der im Jahr 1321 Venedig besuchte und kurz nach der Rückkehr in Ravenna gestorben ist. Wir unterhalten uns über den XXI. Gesang des »Inferno«, betrügerische Beamte werden in kochendes Pech getaucht, bewacht von Teufeln. Dante verbindet die Beschreibung der Situation mit der Produktion und Reparatur von Schiffen.
Um zur Basilica di Santa Maria Assunta auf Torcello zu gelangen, geht Roth nicht entlang des kleinen Kanals, er nähert sich über Wiesen und Felder der Kirche. Er überquert dabei die Ponte del Diavolo, bleibt am Scheitelpunkt stehen und blickt in die umliegenden Gärten. Die Ponte del Diavolo ist für Roth eine Brücke in die Vergangenheit, ein gewölbter Steg, über den der Erzähler gehen müsse, um die Schemen und Schatten einer Flucht heraufzubeschwören.
Von der Ponte del Diavolo führt uns der Weg zur Basilika mit Tintorettos Gemälde »Himmelfahrt Mariä« (1554-1555) und dem großen Mosaik vom Jüngsten Gericht. Vom Namen und der Geschichte der Teufelsbrücke angeregt, denkt Roth über die Schöpfung nach. In einer Kirchenbank sitzend und auf die Ikonostase schauend, sagt Roth, er habe bereits oft mit Theologen, Priestern und Bischöfen gesprochen, und keiner habe ihm erklären können, warum Gott den Teufel geschaffen habe. Roth zeigt auf das »Jüngste Gericht«: »Unten befinden sich die Totenschädel, die Marter durch die Teufel, links ist das Fegefeuer, nach oben hin sieht man die höheren Engel, die Cherubim und Seraphim. Das Schlimmste zu Dantes Zeiten hingegen war der Verräter. Zu den Verrätern gehörte auch Brutus, der Julius Cäsar ermordete. Dante hat einige Anspielungen auf weitere Verräter gemacht, aber der ärgste und größte Verräter sei Judas.«
8. Mai 2016
Roth erinnert sich in der Stille des Sonntagnachmittags an seinen Venedig-Besuch während der Recherchen zu »Die Irrfahrt des Michael Aldrian«. Er sei zuvor bereits einmal auf Torcello gewesen, doch im Februar 2008 Jahr sei alles geschlossen gewesen: »Kein Leben, alle Lokale waren damals geschlossen, auch das Cipriani. Trotzdem oder gerade deswegen war es schön, ich hatte Torcello schon damals sehr gern, die Insel hat im Winter mystisch gewirkt.« Roth sagt, es koste ihn viel Kraft, alles genau zu recherchieren. Er habe versucht, bereits in »Die Irrfahrt des Michael Aldrian« den Mord auf der Insel zu beschreiben, aber sie damals zu einer anderen Jahreszeit gesehen. Er werde den Mord dort in den Mai verlegen, durch die Beschreibung der blühenden Akazien und des blühenden Holunders werde der Gegensatz zwischen Tod und Leben größer: »Ein Mord in einer tristen Landschaft ist immer gut, die Skandinavier leben davon, Henning Mankell und all die anderen Autoren, immer gibt es diese dunkle Schwedenlandschaft. Aber eine Landschaft, die in Blüte steht, ist für mich reizvoller.«
9. Mai 2016
Am Vormittag besuchen Senta Roth und der Verfasser das Ghetto Venedigs. Roth bleibt zu Hause, er hat die Führung durch das Ghetto schon drei Mal mitgemacht, er will weiter seine Notizen und Fotografien durchsehen und überlegen, wie sie sich in den Roman integrieren lassen. An jenem Vormittag kommen nur wenige Besucherinnen und Besucher ins Ghetto, bis zur Führung dauert es eine Stunde. Wir sehen uns auf dem Platz um und sprechen über den gerade begangenen 500. Jahrestag: Am 29. März 1516 war die Entscheidung getroffen worden, in Venedig ein Ghetto zu errichten. Einem Hinweis entnehmen wir, dass im laufenden Sommer – vierhundert Jahre nach der Uraufführung von Shakespeares Komödie »Der Kaufmann von Venedig« – dieses Stück im Ghetto gezeigt wird. Wir fragen uns, ob in der Bearbeitung sowohl Antonio, der Kaufmann von Venedig, als auch Shylock, der Jude von Venedig und Mann ohne Vornamen, ihr Leben lang aus Belmont verbannt bleiben werden. Die venezianische Insel Belmont ist eine Utopie, die an den Außenseitern Antonio und Shylock zugrunde geht. In dieser Komödie gibt es weder eine Gemeinschaft noch eine Solidarität der Außenseiter.
Roth kommt auf den bevorstehenden Abschied zu sprechen, er meint, die zehn Tage seien viel zu schnell vergangen: »Ich muss aus einem inneren Antrieb immer schreiben. Ich kann einfach nicht ausspannen. Heute habe ich das erste Mal nichts geschrieben, ich war nach dem Torcello-Ausflug zu müde dafür, aber ich bin sehr glücklich, in Venedig zu sein. Man sieht immer wieder schwerbehinderte Menschen wie vor einigen Tagen den Jungen im Rollstuhl im Vaporetto, und man denkt, wie bevorzugt man in allem ist. Erst wenn man das Selbstverständlichste verloren hat, fällt einem auf, was man besessen hat. Das Selbstverständlichste – dass man zwei Hände hat, zwei Augen, dass man alles essen kann, dass man spazieren gehen kann, ist zugleich das Schönste.«
10. Mai 2016
Der Tag der Abreise ist gekommen. Aufbruch aus Venedig, Rückkehr in die Südsteiermark, wieder über Klagenfurt. Die Zerstörung Venedigs, die Julien Green befürchtete, hat Roth in der »Winterreise« in einer Szene beschrieben, in der der weißbraune Dampfer »Appia« seinen Schatten in eine Straße wirft.
Während eines Telefonats mit Roth Ende November 2016 taucht die Frage auf, womit Venedig verglichen werden könne. Laut Goethe, der im Herbst 1786 gut zwei Wochen in Venedig war, kann man die Stadt »nur mit sich selbst vergleichen«. Am 29. September 1786 hält er fest: »Dies Geschlecht hat sich nicht zum Spaß auf diese Inseln geflüchtet, es war keine Willkür, welche die Folgenden trieb, sich mit ihnen zu vereinigen; die Not lehrte sie ihre Sicherheit in der unvorteilhaftesten Lage suchen, die ihnen nachher so vorteilhaft ward und sie klug machte, als noch die ganze nördliche Welt im Düstern gefangen lag; ihre Vermehrung war notwendige Folge (...). Der Venezianer musste eine neue Art von Geschöpf werden (...).« Jeder Venezianer, schreibt Goethe, fühle sich als »Mitherr des Adriatischen Meeres«, »wenn er sich in seine Gondel legt«.
Vergleicht man Venedig mit sich selbst, lässt sich am Beginn des 21. Jahrhunderts sagen, dass die nicht wohlhabenden Bewohnerinnen und Bewohner Venedig verlassen müssen, nach Mestre oder in andere Orte ziehen, sie können sich die Mieten nicht mehr leisten. Übers Adriatische Meer kommen die Flüchtlinge und billige Arbeitskräfte aus Osteuropa. Venedig ist, wie Wolfgang Scheppe und seine Studierenden in den beiden Bänden der Studie »Migropolis. Venice. Atlas of a Global Situation« (2009) die soziokulturelle Entwicklung darstellen, das Modell einer globalisierten Stadt geworden. Der Titel ist für den Philosophen Scheppe »die Fügung der griechischen Wortwurzel für Stadt mit dem Terminus der Migration. Wir untersuchen die globale Mobilität von Menschen, Waren und Bildern am Beispiel Venedigs. Der Titel spielt aber auch mit seinem Gleichklang zu Monopoly, dem Spiel. Das hat einen Grund: Das Spielbrett ist die einzige gesellschaftlich gelernte Form, Raum und Ökonomie auf eine visuelle Weise zusammenzuschließen. Es liefert also die Grundidee zu einer Kartographie der globalisierten Stadt. (...) Wenn eine Stadt ein gewaltiges Geschäft mit mehr als zwanzig Millionen Touristen im Jahr anzieht, ist es eine Notwendigkeit der globalisierten Welt, dass auch eine sogenannte Parallel-Ökonomie entsteht. Eine Schattenwirtschaft, die in Venedig im hellen Licht der Promenaden stattfindet. Das macht dieses Phänomen in Venedig deshalb so sichtbar und führt zu Konflikten mit den mächtigen Vertretern des wahren Geschäfts. Die Protagonisten dieses Schwarzmarkts sind Hersteller, die in vielen Fällen auch die Produzenten der echten Brand-Products sind. Und diejenigen, die das Risiko tragen: Illegal genannte Immigranten, die ihre lange Reise einmal angetreten haben, um Arbeit zu finden, aber im modernen Europa der Grenzsicherungen weder arbeiten noch existieren dürfen. Sie sind daher angewiesen auf informelle Formen des Marktes. Ihrer Armut entspricht die knappe Kasse bei vielen Tagestouristen, die sich nicht mehr als eine falsche Gucci-Tasche aus Plastik als Souvenir leisten können. Die in der laufenden Regierungsperiode entstandene Militarisierung Venedigs hat diese, einst die Stadt kennzeichnende, Subsistenzwirtschaft aber in allerjüngster Zeit fast völlig aufgelöst. (...) In der heutigen Wirklichkeit der Stadt ist ihre historische Besonderheit nurmehr ein Verkaufsargument der lokalen Tourismuswirtschaft. Ihre Gesetze aber werden im Alltag aller, die in Venedig noch leben, ganz von den Mechanismen der Globalisierung bestimmt. Deren Spuren und Zeichen, obgleich omnipräsent, bleiben dem touristischen Blick verschlossen.«
Venedig ist zu einer »Dual City« geworden, der soziale Zusammenhang der Metropole zerbrochen. Roth plant, diese Stadtentwicklung als Hintergrundfolie für »Die Hölle ist leer – die Teufel sind alle hier« zu nehmen. Seit dem ersten Besuch als Jugendlicher Mitte der 1950er Jahre und seit der »Winterreise« von 1978 habe sich diese Stadt enorm verändert, es gelte, Spuren und Zeichen dieser Veränderung darzustellen. Einst habe alles in Torcello begonnen, Torcello sei für Venedig – wie John Ruskin im dreibändigen Werk »The Stones of Venice« Mitte des 19. Jahrhunderts schreibt – »the widowed mother of the city«. Und man könnte folgern, die Globalisierung von Venedig habe Torcellos Witwenschaft vertieft.
Den anderen Räumen, die an der Peripherie der Gesellschaft liegen und im Zentrum ihre Spuren hinterlassen, ist eine Heterotopie eigen. Für Michel Foucault erreicht die Heterotopie »ihr volles Funktionieren, wenn die Menschen mit ihrer herkömmlichen Zeit brechen«, schreibt er in »Andere Räume«. – Mit dem zentralen Thema der Reise geht es Gerhard Roth immer mehr um Aufbruch als um Ankunft, nicht um eine Heimkehr ins Tradierte, vielmehr um ein Hineingeschleudertwerden in andere Räume.
Über Klaus Dermutz
Klaus Dermutz, geb. 1960 in Judenburg (Österreich), 1992 Promotion in Graz in Theologie mit einer Arbeit über den polnischen Theaterregisseur Tadeusz Kantor. Veröffentlichungen in Die Zeit, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Rundschau, Theater heute. Von 2001 bis 2009 Mitherausgeber der Buchreihe ›Edition Burgtheater‹. Buchveröffentlichungen über die Theaterarbeit von Christoph Marthaler, Peter Zadek, Gert Voss, Andrea Breth, Klaus Michael Grüber sowie ›Das Burgtheater 1955-2005‹. Weitere Publikationen waren der Anselm-Kiefer-Gesprächsband ›Die Kunst geht knapp nicht unter‹ und die Ernst Happel-Biographie ›Genie und Grantler‹, zuletzt erschienen ›Barca – Evolution des Fußballs‹ und der Debütroman ›Sepsis‹. Klaus Dermutz lebt in Berlin.