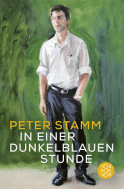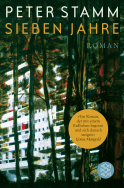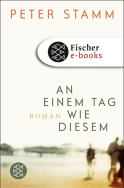Solothurner Literaturpreis
Am 13. Mai fand im Rahmen der Solothurner Literaturtage die Preisverleihung des Solothurner Literaturpreises 2018 an Peter Stamm statt. Bei uns können Sie seine Rede und die Laudatio von Nicola Steiner nachlesen.

Peter Stamm:
Dankesrede Solothurner Literaturpreises, 13.5.2018
Liebe Leserinnen und Leser,
Wenn Menschen mir sagen, sie könnten ohne Bücher nicht leben, so kommt mir das immer wie das Eingeständnis einer Schwäche vor. Damit will ich nicht sagen, dass ich ohne Bücher leben möchte, aber vielleicht wäre es mein Ziel, dass die Bücher sich für mich immer überflüssiger machten, bis ich sie irgendwann nicht mehr brauchte und sie nur noch manchmal in ihren Regalen betrachtete als Zeugen des Weges, den ich gegangen bin. Es mag seltsam klingen, wenn ein Schriftsteller das sagt, aber mit den Jahren ist in mir die Überzeugung gewachsen, dass alles, was wirklich zählt, dass das Wesentliche sich nicht in Worte fassen lässt. Als junger Autor notierte ich mir eine Stelle in Thomas Bernhards »Ritter, Dene, Voss«
Wir strengen uns unser ganzes Leben nur an
um zwei drei Seiten unsterblicher Schrift
mehr wollen wir nicht
aber es ist doch gleichzeitig das Höchste
So erhebend diese pathetischen Worte für einen jungen Schriftsteller waren, schien ich doch schon damals an ihnen zu zweifeln, an der Macht und der Unsterblichkeit der Literatur. Vor allem natürlich meiner Literatur. Die erste Version meines Romans »Agnes«, die ich 1993 als dreissigjähriger schrieb, endet – auch nicht ohne Pathos – mit den Worten:
»Ich habe kein Verlangen, mit meinen Büchern zu sagen: »Hier ist jemand gewesen, hier hat ein Mensch, haben Menschen gelebt.« Nur an Agnes möchte ich erinnern. Nicht, weil sie bes¬ser war als wir anderen, aber weil es der einzige Weg für mich ist, sie nicht so schnell zu vergessen, sie noch ein wenig bei mir zu behalten, bevor sie ganz in der Entfernung verschwindet.«
Seither haben immer wieder Protagonisten meiner Erzählungen und Romane an der Literatur gezweifelt, sich von ihr abgewandt. Agnes besitzt fast keine Bücher, von Kathrine in »Ungefähre Landschaft« heisst es, dass ihr Mann Thomas sich so lange über ihre Bücher lustig gemacht habe, bis sie sie irgendwann »der Bibliothek geschenkt oder einfach weggeworfen« habe. Als Andreas in »An einem Tag wie diesem« seinen Haushalt auflöst, ergeht es seiner kleinen Bibliothek nicht besser:
»Er hatte die Bücher aus dem Regal genommen und auf dem Boden zwei Stapel gemacht. Er schaute sie noch einmal durch und zog ein Buch von Jack London heraus und jenes von dem Aupairmädchen. Alle anderen warf er weg.«
Der Ich-Erzähler in »Die Verletzung«, einer Kurzgeschichte aus dem Band »Wir fliegen«, verbrennt scheinbar grundlos seine gesamte Bibliothek:
»Am nächsten Tag machte ich weiter. Ich war jetzt systematischer, stapelte meine ganzen Bücher neben dem Ofen und verbrannte eines nach dem anderen. Ich brauchte den ganzen Morgen dafür. Dann holte ich meine Notizen aus den Schubladen, meine Tagebücher, die Zeitungsartikel, die ich aufbewahrt und nie gelesen hatte. Ich verbrannte alles.«
Von der Buchhändlerin Anja in der Erzählung »Im Wald« aus der Sammlung »Seerücken« heisst es, sie hätte »mit Büchern nichts mehr am Hut. Seit sie hier draußen wohnen, erscheint ihr das Lesen als Zeitverschwendung, erst recht das Fernsehen. Nur Musik hört sie noch dann und wann.«
Thomas in »Weit über das Land« geht noch einen Schritt weiter:
»Auch das Lesen hatte er aufgegeben, nicht einmal mehr die Zeitung schaute er an. Selbst das Transistorradio, das in seinem Zimmer stand, schaltete er kaum ein, sogar Musik kam ihm nur noch vor wie eine Ablenkung vom Wesentlichen.«
Und als Christoph, der Held meines letzten Romans, das Manuskript seines Romans in einem Restaurant liegenlässt, macht er sich nicht einmal die Mühe, es wiederzubeschaffen:
»Ich überlegte, ob ich die Kneipe suchen sollte, in der ich meinen Rucksack liegengelassen hatte, aber ich bezweifelte, dass ich den Ort wiederfinden würde, ich war nicht einmal mehr sicher, ob es ihn überhaupt gab.«
Schreiben ist Nebensache. Lesen ist Nebensache. Die Literatur braucht das Leben mehr, als das Leben die Literatur. Sie ist immer weniger, manchmal sehr viel weniger, sie ist nie genug.
Ein Schriftsteller, der nicht schreibt ist kein Schriftsteller. Einer der nicht mehr schreibt, nicht mehr liest ist hingegen vorstellbar. Christoph, der Fotograf und Vortragsreisende aus meiner Erzählung »Fremdkörper«, träumt davon, seine Diavorträge über das Hölloch nur noch aus Stille und Dunkelheit bestehen zu lassen: »Wenn er sehr konzentriert wäre, wenn er es schaffte, seine Konzentration auf das Publikum zu übertragen, müsste es möglich sein, ganz auf Bilder zu verzichten und schließlich auch auf Worte und nur noch in der Dunkelheit zu sein und die Zeit vergehen zu lassen, eine Stunde, zwei Stunden.«
Das könnte das Ende dieser Rede sein oder ihr Anfang. Ich würde hier stehen, stumm, wir alle würden den Raum wahrnehmen, die anderen Menschen darin und uns selbst. Vielleicht würden wir entfernte Geräusche aus der Stadt hören, ein unterdrücktes Husten aus einer anderen Sitzreihe, die Schritte eines Gastes, der enttäuscht den Raum verlässt, das Zuschlagen der Tür. Vielleicht würden wir einen Duft wahrnehmen, der uns vorher nicht aufgefallen ist, ein Parfum, das uns an jemanden erinnert, Küchengerüche aus einem benachbarten Restaurant. Wir würden darüber nachdenken, was uns hierhergebracht hat, ob es eine gute oder eine schlechte Entscheidung gewesen sei zu kommen. Wir würden unserer Sitznachbarin, die der eigentliche Grund für unser Hiersein ist, zuflüstern, wollen wir gehen? Warte, würde sie sagen, vielleicht kommt ja noch was.
Wir wären angespannt, aufmerksam, voller Erwartung. Aber nach kurzer Zeit würde unsere Konzentration nachlassen – sowohl Ihre als auch meine – wir würden anfangen uns zu langweilen. Die ersten von Ihnen würden aufstehen und gehen, andere würden folgen, dann immer mehr, bis nur noch ein paar wenige hier sitzen würden, die ganz Ausdauernden oder die, die eingeschlafen wären. Ich frage mich, wie lange es dauern würde, bis ich ganz alleine hier stehen würde.
»Indem man schweigt, erhält man das Schweigen nicht«, sagte Peter Handke in einem Gespräch mit Herbert Gamper. »Aber indem man die Stille und das Schweigen und die Leere in eine Form fasst, erhält man die Stille und die Leere und das Schweigen.«
So wird mir das Vorrecht nicht zuteil, das meine Figuren haben: nicht mehr zu lesen, nicht mehr zu schreiben, zu verstummen, sich als fiktive Figuren der Fiktion zu verweigern und ihr so in gewissem Sinne zu entkommen. Schon seit Jahren beschäftigt mich der Gedanke, eine Geschichte ganz ohne Personen zu schreiben. Aber selbst wenn meine Figuren mich irgendwann verlassen werden und nur noch die menschenleeren Orte bleiben, werde ich weiterschreiben müssen, um ihr Verschwinden darzustellen. Vielleicht werden meine Texte dann noch ein bisschen leiser, ein bisschen kürzer, die Sprache noch ein bisschen einfacher.
Es war nie meine Absicht, schreibend Welten zu erschaffen. Es war nie meine Absicht, schreibend der Wirklichkeit zu entfliehen sondern im Gegenteil, mich ihr zu stellen. Meine Texte bezogen sich immer auf eine Welt, die ausserhalb von ihnen lag. Wegbeschreibungen durch unbekannten Landschaften, habe ich sie einmal genannt. Literatur kann die Wirklichkeit nicht ersetzen, aber sie kann – für mich als Autor und für meine Leserinnen und Leser – ein Instrument sein, ein Hilfsmittel, die Wirklichkeit klarer zu sehen. Das Sehen jedoch, kann die Literatur uns nicht abnehmen.
Und jetzt erst ergibt es einen Sinn, dass meine Figuren sich von der Literatur abwenden, dass meine Literatur sich selbst überflüssig zu machen versucht. Wenn sie ein Hilfsmittel ist, die Welt klarer zu sehen, dann müsste es unser Ziel sein, irgendwann auf dieses Hilfsmittel verzichten zu können. Dann würde der Text immer durchsichtiger, bis er endlich verschwände.
Das Verstummen eines Autors kann nur das Ende einer langen Entwicklung sein, die ohne das Lesen und das Schreiben nicht möglich gewesen wäre. Das Schweigen des jungen Mannes ist lächerlich, das Schweigen des alten ist seine Bestimmung. Ich meine kein gravitätisches Schweigen sondern ein heiteres im Sinne Wittgensteins: »Worüber man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen.«
Und so schreibe ich weiter, bis ich irgendwann ganz in der Stille angekommen bin und das Verstummen zu meinem letzten Werk wird. Vielleicht versöhnt sich dann der alte Mann mit dem jungen, wie am Ende meines letzten Romans, als die beiden sich auf einem Spaziergang begegenen und es dem jungen vorkommt, »als verbinde uns etwas, was viel tiefer reicht als Worte, als würden wir eins, ein vierbeiniges Wesen, zugleich alt und jung, am Anfang und am Ende.«
»Und während ich zurück nach Hause gehe, stelle ich mir vor, so zu enden wie er, von allem befreit dem Leben zu entkommen, ohne eine Spur zu hinterlassen. Hinzufallen auf einem eisigen Weg und nicht wieder hochzukommen und mich irgendwann zu ergeben. Mein Atem wird ruhiger, die Kälte spüre ich nicht mehr. Ich denke an mein Leben, das noch gar nicht stattgefunden hat, unscharfe Bilder, Figuren im Gegenlicht, entfernte Stimmen. Seltsam ist, dass mir diese Vorstellung schon damals nicht traurig vorkam, sondern angemessen und von einer klaren Schönheit und Richtigkeit wie dieser Wintermorgen vor langer Zeit.«
Ich danke der Jury und den Stiftern für den Solothurner Literaturpreis.